MÄRCHEN AUS DER SCHWEIZ ...
"Die Hennenkrippe"
"Riesenbirne und Riesenkuh"
"Die beiden Hirten"
"Der Fuchs und die Schnecke"
"Das unheimliche Spinnrad"
"Die Schlüsseljungfrau"
"Der Wittnauer Hans"
"Der Haarige"
"Der Wanderbursche auf der Tanne"
"Der Schneider und der Riese"
"Die Käsprobe"
"Der Bärenprinz"
"Der Teufel als Schwager"
"Junker Prahlhans"
"Der faule Hans"
"Der starke Hans"
"Die drei Schwestern"
"Die Erlösung"
"Der Bräutigam auf dem Wasser"
"Das Knöchlein"
"Der junge Herzog"
"Der einfältige Geselle"
"Der Schneider und der Schatz"
"Der Glasbrunnen"
"Das Kornkind"
"Das Bergmännlein"
"Hans und Urschel"
"Die zwei Brüder und die vier Riesen"
"Die Schwanenjungfrau"
"Die Adlerbraut"
"Die Taube"
"Von den drei goldenen Äpfeln"
"Die Schlangenjungfrau"
"Der Habersack"
"Von den zwei Freunden"
"Vom Menschenfresser"
"Vom Brode und von den drei guten Ratschlägen"
"Vom Vögelein, das goldene Eier legte"
"Von der feuerspeienden Schlange"
"Von den drei goldenen Schlüsseln"
"Bohne, Bohne, ich schneide dich!"
"Das Katzenschloß"
"Vom Mägdlein ohne Arme"
"Der Bärensohn"
"Von den drei Brüdern"
"Vom Vöglein, das die Wahrheit erzählt"
"Der Rabe"
"Der Schuster"
"Der Sohn der Eselin"
"Der Drachentödter"
" Von den zwei Schwestern"
"Die Schlangenkönigin"
"Der Schweinehirt"
"Das Zwerglein Türliwirli"
"Die weißen Vögel vom Arpsee"
"Die drei Brüder"
"Der schlaue Bettler und der Menschenfresser"
"Das Bettelmädchen"
"Vom Pflasterbub zum Prinzen"
"Der Drächengrudel"
"Aschengrübel"
"Die Geisterküche"
"Das schneeweiße Steinchen"
"Goldig Betheli und Harzebabi"
"Die drei Raben"
DIE DREI RABEN ...
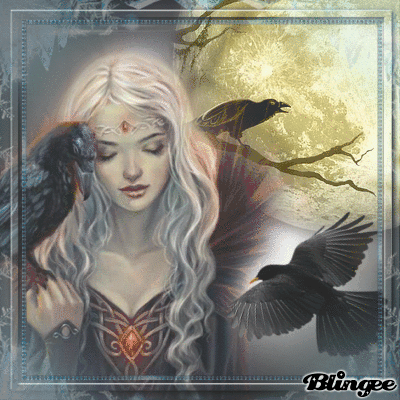
Es war einmal ein Mädchen, das hatte seinen Vater, so lang es denken mochte, immer nur traurig gesehen. Endlich konnte es nicht mehr anders und fragte ihn nach der Ursache seiner Traurigkeit. Da vernahm es, daß es drei Brüder gehabt, die der Vater einst im bösen Zorn zu Raben verwünscht hatte.
Von dem Augenblick an fand es daheim keine Ruhe mehr, und sobald es unbemerkt davon gehen konnte, machte es sich auf den Weg, um seine Brüder aufzusuchen. Am Abend kam es in einen Wald, da wohnte eine Fee, welche dem Mädchen schon lange gut gewogen war; die behielt es in ihrer Laubhütte über Nacht, und am änderen Morgen, als das Mädchen ihr sein Anliegen erzählt hatte, führte sie es bis an den Rand des Waldes und sagte da zu ihm:
"Gradaus über Feld und mitten im Feld
Da stehen die drei schönsten Linden auf der Welt",
und dann ließ sie es allein weiter gehen. Und nachdem es noch einen halben Tag gegangen war, sah es mitten auf einem weiten Feld drei alte Linden, und auf einer jeden saß ein Rabe. Als es aber näher hinzukam, flogen die Raben von den Linden herunter, setzten sich ihm auf Schulter und Hand und fingen an zu sprechen: "Ei, sieh doch, unser herzliebes Schwesterchen kommt und will uns erlösen."
"Ach Gott", sagte das Mädchen, "was ist es ein Glück, daß ich euch gefunden habe. Sagt mir doch nur, wie ich es anstellen soll, damit ihr erlöst werdet." "Freilich ist es ein schweres Stück", antworteten die Raben, "drei Jahre lang darfst du kein Menschenwort reden, und versiehst du es nur ein einziges Mal, so müssen wir eben Raben bleiben unser Leben lang. Auch darfst du uns nicht mehr hier besuchen."
"Das will ich euch schon zuliebe tun", sagte das Mädchen und begab sich sogleich auf den Heimweg. Es kam wieder in den Wald, wo die Fee wohnte. Allein da stand heute an der Stelle der Laubhütte, wo es über Nacht gewesen war, ein stattliches Schloß, aus dem sprengte eben ein Zug von Jägern, und einer blies das Jagdhorn, daß der Wald davon erschallte.
An der Spitze ritt aber der Herr Graf, dem das Schloß und der Wald und das ganze Land herum gehörte. Als der das wandernde Mädchen erblickte, ritt er heran und fragte: "Woher des Landes, und was willst du hier?" Allein das Mädchen gab keine Antwort, sondern verneigte sich bloß mit Anmut, und der Graf wurde nicht satt, ihre liebliche Gestalt zu betrachten.
"Nun, wenn dir Gott die Rede versagt hat", sprach er, "so hast du doch holde Zucht und Sitte, und wenn du mit mir auf das Schloß kommen willst, so soll es dich drum nicht reuen."
Mit stummer Gebärde willigte das Mädchen ein, und der Graf brachte es sofort zu seiner Mutter ins Schloß. Vor dieser verneigte es sich wieder, sprach aber nicht ein Wort dazu. "Wo bringst du die Dirne her?" fragte die alte Gräfin. "Es scheint, sie hat eine schwere Zunge, was soll sie im Schloß?"
"Sie soll meine Gemahlin werden", sagte der Graf, "seht nur hin, ist sie nicht anmutig? Und wenn sie auch nicht spricht, so hat sie doch sonst kein Fehl." Darauf schwieg die alte Gräfin, aber sie behielt einen heimlichen Groll im Herzen.
Am anderen Tage feierte der Graf mit hohen Freuden sein Hochzeitsfest. Aber die Hochzeit war kaum vorüber, so kam ein Gesandter von dem Kaiser, der ließ alle seine Untertanen zu einem großen Kriegszug aufbieten, und auch der Graf mußte ohne Verzug Abschied nehmen von seiner jungen Gemahlin.
Zuvor bestellte er in dessen einen Diener und empfahl ihm, daß er für die junge Frau Sorge tragen sollte wie für seinen Augapfel. Der Graf war jedoch kaum fort, so begann die alte Gräfin ihre verborgene Tücke auszulassen. Sie bestach den Diener, und als die junge Gräfin nach Jahresfrist einen wunderlieblichen Knaben gebar, nahm ihn der Diener auf der Alten Geheiß weg und trug ihn in den Wald hinaus, damit ihn die wilden Tiere auffräßen.
Bald darauf kam der Graf auf Urlaub nach Hause. Da sagte die Alte zu ihm: "Dein stummes Weib ist ein Zauberweib, sie hat ein totes Kind geboren." Und der Diener, der herbeigerufen wurde, sagte: "Ja, Herr Graf, draußen im Wald liegt es, da habe ich es begraben."
Wieder verging ein Jahr, da kam der Graf zum zweiten Mal auf Urlaub. Da hatte unterdessen seine Gemahlin einen zweiten Knaben geboren, den hatte der Diener wieder hinausgetragen, und die Alte sagte: "Dein stummes Weib ist des Teufels, das zweite Kind war gar kein Kind, sondern ein behaartes Tier." Und der Diener sagte: "Ja, Herr Graf, es war ein schwarzer Hund, draußen im Wald habe ich ihn verscharrt."
Nun wurde der Graf zornig und befahl, daß seine Gemahlin gleich der untersten Magd im Schlosse dienen solle. Wieder nach einem Jahr war der Kriegszug des Kaisers beendigt, und der Graf kehrte als Sieger nach seinem Schlosse zurück. Unterdessen hatte seine Gemahlin ihren dritten Knaben geboren, den hatte der Diener wieder in den Wald hinausgetragen, und die Alte sagte: "Dein stummes Weib hat den Tod verdient, das dritte Kind war ein garstiges Ungetüm." Und der Diener sagte: "Ja, Herr Graf, es ist gleich durch das Fenster nach dem Wald hin geflogen."
Nun ließ der Graf seine Gemahlin in den Turm werfen, denn er wollte sie am folgenden Tag bei lebendigem Leib verbrennen. Und als der Holzstoß im Schloßhof errichtet war, auf welchem sie. verbrannt werden sollte, ließ er sie hinauf führen, und das ganze Gericht mußte herum stehen.
Dann trat der Herold hervor, verkündigte der jungen Gräfin den Tod und fragte das Gericht, ob jemand da sei, der die Angeklagte zu verteidigen wüßte. Aber alles schwieg, und man hörte keinen Atem; nur die arme Gräfin seufzte leise.
Da erscholl plötzlich aus der Ferne ein Horn, und wie ein Sturmwind jagten als bald drei Ritter in silberblanker Rüstung auf schneeweißen Rossen in den Schloßhof herein. Sie trugen alle drei einen Raben im Schild, und jeder hielt im Arm einen wunderlieblichen Knaben.
Und ehe der falsche Diener, der gerade neben dem Holzstoß stand und schon eine Fackel zum Anzünden bereithielt, sich dessen versah, hatte ihn einer mit seiner Lanze durchspießt, und alle drei riefen: "Da sind wir ja, liebe Schwester! Heute sind die drei Jahre um, und da hast du auch deine Kinder wieder; die hat dir die Fee im Walde aufgezogen!"
Da war eine Freude und ein Jubel, ihr könnt euch denken wie! Die alte Gräfin lief vor Verdruß in die weite Welt hinaus, und der Graf lebte mit seiner Gemahlin in lauterer Liebe bis ans Ende.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
GOLDIG BETHELI UND HARZEBABI ...
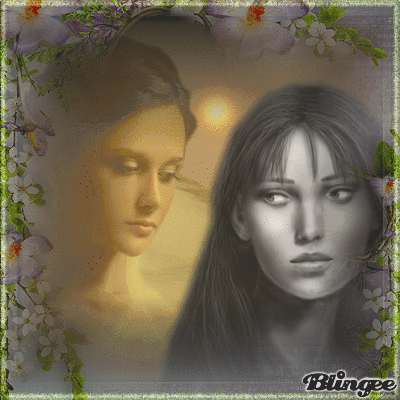
Lebte einst, niemand weiß vor wie langer Zeit, eine Frau, die dem Betheli, ihrem Stiefkinde, recht bös war, dagegen ihrem eigenen, dem Babi, alles nachsah, selbst das Gröbste. Babi hatte immer recht, Betheli immer unrecht; Babi behielt immer den Vorzug, bekam die Haut voll zu essen, was es nur wollte, und ging hoffärtig gekleidet daher, während Betheli oft hungerte, daß ihm fast die Ohren abfielen und es in Lumpen armselig da stand. Babi hatte immer Feiertag, Betheli mußte Mühsal und hartes Leben erdauern. Tag und Nacht sollte Bethelis Spinnrädchen schnurren, und so wohl ihm es auch dabei ausfiel, Stiefmutter war nie, nie zufrieden.
Einmal fiel sein Wirtli zu Boden, trollte und trollte in ein Mauseloch hinunter. Stiefmutter beharrte durchaus darauf, Betheli müsse jetzt in das Mauseloch hinabschlüpfen und das Wirtli selber wieder holen. Arm Betheli weiß nun nichts anderes, als zu gehorchen; es probiert, und Mauslöchlein macht ihm Platz. Und es ist, als ob es von unsichtbaren Händen unaussprechlich weit hinunter in eine ganz andere Welt getragen würde. So geschah es. O wie herrlich sah es da unten aus, welch ein prächtiges Schloß glitzerte ihm entgegen!
Wie es nahe davor stand, sah Betheli vor den Pforten spielende Hündchen, gar liebe, gescheite Tierchen, die reden konnten wie Menschen. Sie grüßten das erstaunte Mädchen freundlich und wußten sogar seinen Namen, indem sie riefen: Wau, wau, es goldig Betheli kommt! Bald erschienen und traten Betheli entgegen mehrere Kinder; sie waren so hold und klug, ich kann nicht beschreiben wie.
Betheli machte große schüchterne Augen; aber es fühlte sich von den wunderbaren Kindern so wohltätig angeblickt, daß ihm ganz heimelig wurde, zumal, da es sich wieder als das goldig Betheli begrüßen hörte.
Die Kinderlein sahen ihm indessen wohl an, wie sehr es hungerte, und fragten gleich: "Goldig Betheli, mit wem willst du essen, mit uns oder mit den Hündchen?"
"Setzt mich nur zu den Hündchen, es ist lang gut genug für mich", sagte demütig das Mädchen. "Nein, du sollst mit uns zu Tische gehen", riefen einstimmig die holden Kinder, welche ihm sofort zweierlei Gewänder zur Auswahl vor hielten, ein hölziges und ein goldenes.
Betheli langte nach dem hölzigen, indem es sagte: "Das ist gut genug für mich." Es geschah jedoch dem bescheidenen Kinde zum Lohn das Gegenteil, sie zogen ihm das Goldkleid an und führten es in einen glänzenden Saal des Schlosses, wo ein goldener Tisch mit den allerbesten und süßesten Speisen und Getränken bedeckt stand.
Hungrig Betheli bekam es jetzt einmal so gut, fast wie des lieben Herrgotts Engelchen bei der himmlischen Mahlzeit. Die lieblichen Kinder spendeten Betheli von allen guten Sachen, lobten und küßten es, so daß ihm war wie im Paradies. Zum Abschied schenkten sie ihm obendrein vielen kostbaren Schmuck und unter anderem einen goldenen Wirtel.
Dann schoben und hoben sie es wieder durch jenes Mauslöchlein hinauf in der bösen Stiefmutter Stube. Da stand Betheli wie ein lichter Engel strahlend im Goldkleid.
Kaum hatten sich Mutter und Babi vom größten Erstaunen erholt und Betheli über alles haarklein ausgefragt, als beschlossen wurde, Babi müsse ebenfalls in die andere Welt hinunter und zum mindesten ebenso schöne Sachen wie Betheli heraufholen.
Mutter und Tochter zweifelten gar nicht daran, daß, wenn dem verachteten einfältigen Betheli solche Aufnahme zuteil ward, dem Babi natürlich noch weit mehr Ehre widerfahren würde. Und sie ließen einen Wirtel durch das Mausloch hinab, und Babi setzte ihm nach.
Da wirklich das Löchlein wieder Platz machte und Babi verschwand, hoffte die Mutter oben und hoffte das Meitli unten während der Fahrt in die andere Welt das Allerbeste.
Babi, dort angelangt, ging die gleichen Wege, wie Betheli sie beschrieben hatte, bis es zu den Hündchen und dem Schloß gelangte. Schon lachte ihm das Herz im Leib. Die Hündchen bellten sogleich: Wau, wau,Es Harzebabi kommt! Wau, wau, es Harzebabi kommt! Und das riefen sie in mürrischem Tone, machten trübe Augen und ließen die Schwänzchen hängen.
Wohl eilten auch jene holden Kinder herbei, allein ihr Blick leuchtete nicht so sonnig in Babis Herz wie in Bethelis. Sie fragten das Babi, mit wem es essen wolle. "Mit euch", sagte es, "das Betheli hat auch mit euch gegessen."
Dann legten sie ihm zwei Paar Kleider vor, ein hölziges und ein goldiges. Babi sprach, es wolle das goldige; Betheli habe auch ein goldiges, und es wolle einen goldigen Wirtel und anderen Goldschmuck. Allein sie ließen es ihm nicht, es mußte das hölzige anziehen, sofort mit den Hündchen auf dem Boden zu Gast essen, Abfall und Treber.
Zum Abschied ward sein Holzgewand mit Pech und Harz überstrichen, und es wurde dabei immer nur Harzebabi geheißen. Einen Wirtel bekam es, aber einen alten, hölzigen. Sie waren froh, es bald loszuwerden, und machten, daß Harzebabi schnell durch das Mausloch in die Oberwelt stieg.
Hier oben blieb Betheli zeitlebens in Ehre und Ansehen und hieß immer Goldig Betheli, während Babi verachtet blieb und oft hören mußte: Wau, wau, es Harzebabi kommt!
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DAS SCHNEEWEISSE STEINCHEN ...
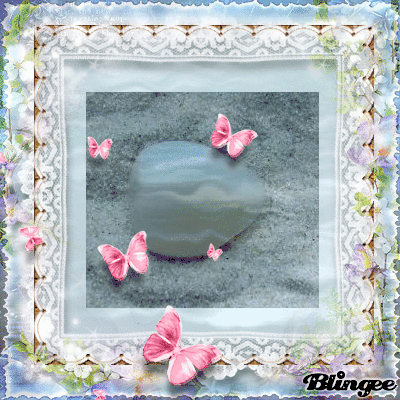
Es war einmal ein Hirtenbube, der mußte alle Tage auf dem Berge Geißen und Schafe hüten. Dabei konnte er singen wie ein Vogel und jodeln, daß man es weit und breit im Tal unten hörte. Eines Tages bekam er Durst und suchte lange auf der ganzen Weide herum nach einem Trunk Wasser, endlich fand er unter einer hohen Tanne ein Weiherlein. Da kniete er nieder und schlürfte begierig das Wasser in den trockenen Gaumen.
Indes er also über das Weiherlein gebeugt lag, sah er unten im Wasserspiegel, daß auf der Tanne oben ein Vogelnest war. Nicht faul, kletterte er wie ein Eichhörnchen hinauf und suchte und griff nach dem Ast, den er im Wasser gesehen hatte; aber von einem Nest fand er nicht Staub und nicht Flaub. Unverrichteterdinge mußte er wieder herabsteigen.
Als er unten war, lugte er noch einmal in das Wasser, und siehe da! Abermals sah er das Nest ganz deutlich. Was gibst, was hast, war er wieder oben im Baum, aber auch diesmal konnte er das Nest nicht entdecken. Das trieb er so zum dritten und vierten Mal. Endlich fiel es ihm ein, er wolle im Wasser alle Äste zählen bis zum Nest hinauf. Gedacht, getan, und nun ging es.
Er kletterte und zählte richtig, und als er bei dem rechten Aste angelangt war, griff er zu und hielt plötzlich ein schneeweißes Steinchen in der Hand, und nun bekam er auch das Nest selber zu sehen. Da ganz vorne auf dem Ast lag es, daß er sich verwunderte, wie es ihm so lange hatte entgehen können. Da ihm das schneeweiße Steinchen gefiel, steckte er es in die Tasche und stieg herunter.
Am Abend trieb er seine Geißen und Schafe heim und sang und jodelte dabei nach seiner Gewohnheit aus Herzenslust. Aber was geschah? Wie er ins Dorf kam, sperrten die Leute Maul und Augen auf, denn sie hörten ihren Geißbuben wohl singen, aber kein Mensch sah ihn.
Und als er vor seiner Eltern Haus kam, sprang der Vater heraus und rief: "Um Himmels willen, Bub, was hast du gemacht? Komm herein in die Stube." Vater und Mutter wußten vor Schrecken nicht, wo aus und ein, und der Bube wußte nicht, daß er unsichtbar war, bis es ihm der Vater sagte.
"Bist du etwa auf einem Hexenplatz gewesen?" fragte der Vater. "Nein", sagte der Bube und erzählte von dem Vogelnest. "Gib weidlich das Steinchen heraus!" riefen Vater und Mutter. Da gab er es dem Vater in die Hand, aber was geschah? "Herr Jesus, Ätti, wo bist du?" riefen die Mutter und der Bube. Denn jetzt war der Bube wieder sichtbar, aber der Vater war dafür unsichtbar geworden.
Dem war es jedoch, als ob er eine Kröte in der Hand hätte, und er warf das Steinchen auf den Tisch. Aber was geschah? Da sahen sie den Tisch nicht mehr. Jetzt fuhr der Vater auf, tappte nach dem Tisch und erwischte glücklich das Steinchen. Wie der Wind sprang er mit dem selben aus dem Haus und warf es mitten in den Ziehbrunnen hinunter.
Aber hei! Wie das da drunten blitzte und krachte, nicht anders, als wenn Himmel und Erde zusammenstürzen müßten. Was gibst du mir, wenn ich es wieder heraufhole?
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE GEISTERKÜCHE ...

Ein Sigrist hatte einen Sohn, der war so wild und unbändig, daß der Vater mit sich zu Rate ging, wie er seinen Übermut dämmen könnte. Fürs erste stellte er einen Strohmann in den Kirchturm und schickte dann den Knaben bei Nacht in den Turm hinauf, noch die Uhr aufzuziehen. Aber der Junge schlug einfach den Popanz über die Stiege hinunter und brachte ihn lachend in die Stube herein gehuckelt.
Da merkte der Vater, hier müsse man etwas Klügeres tun, und ließ ihn das Schneiderhandwerk lernen, um ihn in die Fremde zu schicken, damit er sich hier die Hörner abstoße. Der Junge blieb aber der gleiche. Auf seiner Wanderschaft wollte er einst mitten im Walde in einem einsam liegenden Häuschen übernachten, aber niemand öffnete, und er erbrach zuletzt die Türe. Kein Mensch war drinnen, doch brannte auf dem Tisch ein Licht.
Während er sich es darin bequem machen wollte, kamen zwei Männer in die Stube getreten, die ihn einige Zeit anstutzten, dann aber nach kurzem Gespräche ihm gestanden, das Haus habe gar keinen Herrn mehr, denn es sei gespenstisch. Ihnen aber diene dies dazu, ihre Diebereien hier verbergen zu können.
Als der Geselle um das Nähere fragte, vernahm er, eine weiße Frau hüte hier einen Schatz und erscheine regelmäßig um die Geisterstunde. Nun verbündeten sie sich zu dritt, heute diesen Schatz zu heben. Bis Mitternacht war es aber noch lange, der Hunger war nicht gering, und weil die Diebe Mehl und Schmalz im Hause hatten, suchte der Geselle ein Mahl zu rüsten, machte in der Küche ein Feuer, und in kurzer Zeit küchelte er schon am Herde.
Da hörte er, noch ehe die Mitternachtsstunde da war, aus dem Schlot herunter eine Stimme rufen: "Flieh, oder ich falle!" "Nur zugefallen!" antwortete er unbesorgt, und gleich fiel ein Schenkel durch den Kamin herab auf den Herd. Er schleuderte den selben in einen Winkel der Küche, tat die Pfanne wieder übers Feuer und röstete weiter an den Schmalzküchlein.
Bald hörte er die Stimme aus dem Schlote abermals, und er gab abermals die selbe Antwort; da lag der andere Schenkel vor ihm am Herde. Er warf ihn zum ersten, und so ging es fort, bis zuletzt alle Glieder und Stücke eines Menschenkörpers da waren. Sobald er auch den Kopf zu den übrigen Teilen geworfen hatte, fügte sich alles zusammen, ein großer Mann richtete sich hinten in der Küchenecke auf und trat zu ihm heran.
Der Bursche fragte ihn höhnisch, wo er denn sein Weib habe. "Sie wird nachkommen", antwortete der Mann. "Um so besser", sagte der Geselle, "setze dich also derweilen dort in jene Ecke." Der Mann gehorchte, und der Geselle trug nun sein fertiges Gebäck auf.
Als er mit der Schüssel über den Hausgang in die Stube gehen wollte, kam ihm eine schneeweiße Frau entgegen. "Aha", sagte er, "das ist wohl diejenige, welche hier den Schatz hütet. Nun ja, so mag sie vorderhand zu Tisch kommen und ihren Mann, der dort im Winkel sitzt, mit hereinbringen."
So ging er mit der Schüssel voran in die Stube, und das Paar folgte ihm. Alle saßen zu Tisch, jedoch wollten die Geister nichts genießen. Nach dem Essen forderte der Geselle die Frau auf, ihm die Mittel anzugeben, wie sie erlöst werden könne, und versprach ihr, standhaft und beherzt zu bleiben.
Nun leuchtete sie ihm bis zu einem altertümlichen Bette voran, in welchem ein gewichtiger Schlüssel lag. Dieser paßte im Hauskeller zu einer Eisentüre, und nach dreimaligem Umdrehen ging das Schloß auf. Die Frau trat mit dem Licht hinein.
Da erblickten sie im Gewölbe einen Hahn mit feurigem Kamm, der sich auf dem Rücken eines gewaltigen Zottelhundes ausspreizte. Der Hund aber kauerte knurrend auf einer großen Kiste, während der Hahn dazu krähte, daß er sich selber fast überpurzelte. Der Schneider ließ sich von allem nicht dumm machen. Aller Grimassen ungeachtet, verscheuchte er erst die Ungetüme und schloß, sobald sie zum Keller draußen waren, die Türe zu.
Dann legte er wohlbesonnen sein Schurzfell ab. Mit dem zweiten Schlüssel, den ihm nun die weiße Frau einhändigte, öffnete er die Kiste, und sie lag bis oben voll Gold. Sogleich aber warf der Geselle sein Schurzfell darüber, weil er wußte, daß man jedem Geisterschatze, der nicht mehr entweichen soll, etwas von unsern eigenen Sachen beilegen muß. Kaum war dies geglückt, so sagte er der weißen Frau und ihrem Manne: "Jetzt könnt ihr gehen", und augenblicklich waren beide verschwunden.
Nachher haben sich die drei, der Schneider und die Diebe, die Schätze friedfertig geteilt, und der alte Sigrist sah seinen Sohn als reichen Mann wiederkehren.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
ASCHENGRÜBEL ...
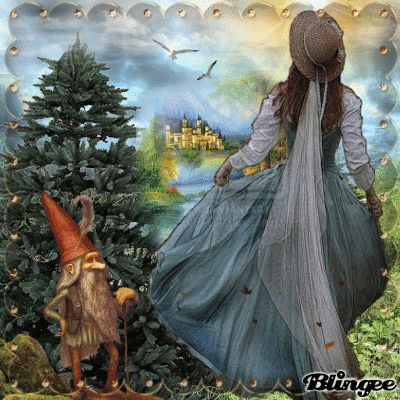
Ein kleines Mädchen hatte seine beiden Eltern früh verloren. Sie hatten ihm nichts hinterlassen als nur ein wunderschönes, strahlendes Kleid und dazu ein Testament; kein Mensch wußte aber, wo dieses hingekommen war. Also nahm das Mädchen das Kleid in ein Tüchlein und suchte sich einen Dienst.
Es mußte froh sein, endlich in einem vornehmen Haus eine Unterkunft zu finden, wo es die niedrigste Küchen- und Stallarbeit zu besorgen hatte. Deswegen nannte man es nur das Aschengrübel. Sein schönes Kleid aber versteckte es gleich anfangs unter einer Tanne.
Nach einiger Zeit war im Orte Musik und Tanz; da ging es lustig zu, und am fröhlichsten war der Sohn des vornehmen Hauses, in welchem Aschengrübel das armselige Leben führte. Da bat auch das Mädchen ihre Herrschaft um Erlaubnis, auf den Tanzplatz zu gehen. "Ja", sagte die Meistersfrau, "gehen und zusehen darfst du, aber beileibe nicht tanzen."
Da ging es zu der Tanne hin, wusch sich unterwegs an einer Quelle Gesicht und Hände von Staub und Ruß blank und zog sein stählendes Kleid an, und da war es eine wunderschöne Jungfrau.
Als es nun auf dem Tanzplatz erschien, blickte alles nach ihm hin, und der vornehme Jüngling kam allen anderen zuvor, und weil er Aschengrübel nicht erkannte, so lud er es zum Tanze ein. Aber es ließ sich nicht dazu bewegen, so dringlich er es auch bat. Zeitig entsprang es und kam wieder unter die Tanne zurück; hier legte es sein Kleid weg und machte sich Gesicht und Hände wieder rußig.
Da kam plötzlich ein winziges Männchen hinter der Tanne hervor, das grüßte mit freundlichen Worten, und - hast ihn nicht gesehen - da war der Kleine wieder verschwunden, wie er gekommen war.
Von der Zeit an hatte aber der vornehme Jüngling keine Ruhe mehr, bis er es zuwege gebracht hatte, daß wiederum ein Tanz abgehalten wurde. Aschengrübel fragte die Herrschaft auch wieder um Erlaubnis, hinzugehen. "Ja", sagte die Meistersfrau, "gehen und zusehen darfst du, aber beileibe nicht tanzen!"
Da tat es wie das erste Mal, und als es in dem strahlenden Kleide auf dem Tanzplatz erschien, da hatte der Jüngling wieder nur Augen für die schöne Jungfrau und bat sie noch dringlicher als das erste Mal, mit ihm zu tanzen, und als Aschengrübel es weigerte, so wollte er ihm mit Gewalt einen Kuß geben. Aber es entschlüpfte ihm wie ein Mäuschen vor der Katze und kam wieder zu der Tanne zurück. Da kam auch das winzige Männchen wieder, das grüßte noch viel freundlicher als zuvor.
Dem Jüngling kam aber die schöne Jungfrau nicht mehr aus dem Sinn, und er hatte keinen Trost und keine Freude auf der Welt, bis wieder Tanz war. Aschengrübel tat wieder nach Gewohnheit, und als es in dem strahlenden Kleid auf den Tanzplatz kam, da faßte der Jüngling es bei der Hand und wollte es nicht mehr loslassen, bis es ihm versprochen hätte, daß es seine Frau werden wollte.
Nun hätte es sich in den Boden verkriechen mögen, weil es ihm endlich sagen mußte, daß es nur das Aschengrübel sei, das im Hause seiner Eltern die armselige Küchen- und Stallarbeit verrichte. Allein der Jüngling hatte es ebenso lieb wie vorher und setzte sofort den Tag fest, an welchem die Hochzeit gefeiert werden sollte.
Aschengriibel bedingte sich aus, bis dorthin noch unbekannt bleiben zu dürfen, und der Bräutigam mußte versprechen, den Namen seiner Braut geheim zu halten. Dann ging Aschengrübel zu der Tanne, und da kam auch das winzige Männchen, das schmunzelte vor lauter Freundlichkeit, als es grüßte.
Als aber der Hochzeitstag da war und Aschengrübel zum letzten Mal nach der Tanne kam, um das strahlende Kleid anzuziehen, funkelten des Männchens Augen vor heller Freude und Güte, und es sagte: "Da hast du auch etwas zur Mitgift." Damit übergab er ihm ein Buch, und als es das selbe öffnete, da war es das Testament ihrer Eltern, das sie zur Erbin einer großen Herrschaft einsetzte.
Hocherfreut eilte Aschengrübel zu ihrem Bräutigam, der Bräutigam führte Aschengrübel zu seinen Eltern, und da ward eine Hochzeit gefeiert, ihr habt in eurem Leben noch keine schönere gesehen.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER DRÄCHENGRUNDEL ...
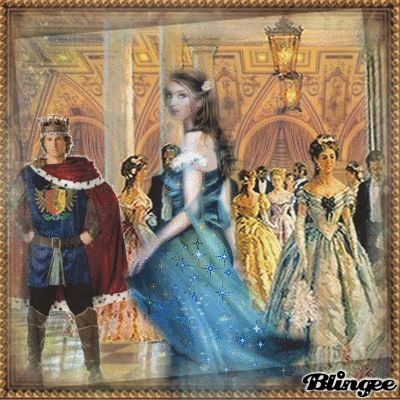
Ein Ehepaar hatte eine Tochter, die ihre ganze Freude war. Sie bewohnten ein Häuschen unten im Tale und galten als reiche Leute. Nach einigen Jahren erkrankte die Frau und fühlte, daß sie sterben werde. Da bat sie ihren Mann, er möchte, wenn sie gestorben sei, keine andere heiraten oder sie hätte so schönes Lychhaar wie sie. Der Mann gelobte es, und als seine Gattin gestorben war, trauerte er lange um sie. Unterdessen war seine Tochter zur blühenden Jungfrau herangewachsen.
Nach einigen Jahren kam den Vater die Lust an, wieder zu heiraten, und er hielt Brautschau ringsum im Lande, fand aber keine mit so feinen goldenen Haaren, wie sie seine Frau besessen hatte, und doch gab es eine ganz in seiner Nähe, und das war seine eigene Tochter. Er hatte sie lieb und fand, sie sei ganz die Mutter, wie er sie vor zwanzig Jahren gefreit, so daß er beschloß, sie zu heiraten.
Eines Tages eröffnete er der Tochter sein Vorhaben, aber sie lachte ihn nur tüchtig aus. Als sie aber sah, daß es sein größter Ernst sei, da wurde sie traurig und ging fort. Sie liebte den Vater schon, aber nur als Vater und nicht als Bräutigam. Nach einigen Tagen kam sie wieder zum Vorschein, da sie glaubte, der Vater hätte sein sonderbares Vorhaben aufgegeben, aber er bestürmte sie nur noch mehr, und nun nahm sie zu allerlei Ausreden Zuflucht.
Eines Morgens sagte sie, sie wolle seine Gattin werden, wenn er ihr drei Kleider kaufe; das eine müsse glänzen wie die Sonne, das andere wie der Vollmond und das dritte wie die Sterne am Firmament. Der Vater war hoch erfreut über ihren Entschluss, reiste sofort ab und hatte keine Ruhe, bis er die drei Kleider gefunden hatte. Als er sie nach Hause brachte und vor seiner Tochter ausbreitete, da glänzte das eine wie die Mittagssonne, das andere war fahl und blaß wie Vollmondschein, und das dritte funkelte wie die Sterne über den Bergen.
Die Tochter konnte ihre Augen nicht abwenden von den schönen Kleidern, erschrak aber, als der Vater sie abermals fragte, ob sie ihn jetzt heiraten wolle. Da sagte sie: "Jetzt noch nicht, aber wenn du mir noch einen Wagen kaufst, der von selber fährt, dann will ich deine Frau werden!" Sie dachte, einen solchen Wagen gebe es auf der ganzen Welt nirgends.
Er ging wieder auf Reisen und brachte einen Wagen zurück, der keine Pferde brauchte und von selbst fuhr. Jetzt durfte die Hochzeit nicht mehr länger hinausgeschoben werden. Sie fügte sich scheinbar in das Unvermeidliche, machte sich aber einen eigenen Plan zurecht, bestieg in der Nacht den fremden Wagen, fuhr die ganze Nacht durch und den nächsten Tag auch noch, bis am Abend eine große Stadt sich vor ihren Augen ausdehnte.
Vor dem Tore stand ein Bettelmädchen in schlechten Kleidern. Sie stieg aus, ging mit dem Mädchen nach Hause, tauschte mit ihm die Kleider, damit sie niemand kenne in der Stadt, und übergab ihm den Wagen zur Obhut. Dann wanderte sie durch das Tor in die Stadt und suchte sich eine Stelle. Sie ging nicht lange, so stand sie vor einem prächtigen Hause.
Als sie staunend zu den Fenstern hinaufschaute, fragte sie ein Herr, was sie suche. Sie sagte, eine Stelle, und wenn es auch eine schlechte sei und sie wenig dabei verdiene. Nun, sie solle hier nur eintreten, solche Leute könne man in diesem Haus schon brauchen.
So kam sie in das schöne Haus und mußte in der Küche neben dem Drachen oder dem Herde stehen und die niedrigsten Dienste verrichten, weshalb sie nur der Drächengrudel genannt wurde. Das große Haus, in dem sie diente, aber war der Königspalast, der von dem Kronprinzen und seiner Mutter bewohnt wurde.
Als die Woche um war, fragte sie ihre Herrschaft am Sonntagmorgen, ob sie nicht in die Messe gehen dürfte. Diese betrachteten das schmutzige Mädchen von oben bis unten und sagten, wenn sie versprechen wolle, sich in den hintersten Winkel zu setzen, wo sie niemand sehe, so könne sie gehen. Sie gelobte es, eilte in ihre Kammer und zog die schönen Kleider hervor, die ihr der Vater geschenkt und die sie mit auf die Reise genommen.
Sie legte die Küchenkleider ab, warf das Sonnenkleid über und ging durch ein Hintertürchen fort zur Messe. Nach dem Hochamt kam der Prinz ganz verwirrt nach Hause und sagte zu seiner Mutter: "Ich habe in der Kirche eine Jungfrau gesehen, so schön wie die Sonne selbst, die möchte ich zur Frau!"
Die Mutter erwiderte: "Wenn sie so schön ist, wie du sagst, so habe ich nichts gegen deine Wahl einzuwenden. Bring sie das nächste Mal her, damit ich sie kennen lerne!" Der Drächengrudel aber war längst in der Küche und sah wieder so schmutzig aus wie vorher.
Am nächsten Sonntag fragte sie wieder, ob sie zur Messe gehen dürfe. Wenn sie sich halte wie am ersten Sonntag und gut verberge, hieß es, so dürfe sie gehen. Da stieg sie hinauf in ihr Kämmerlein, zog das Mondkleid an und wanderte zur Kirche. Als das Hochamt vorüber war, stellte sich der Prinz vor das Portal, um die schöne Jungfrau zu erwarten.
Als sie zur Türe hinaustrat, ging er auf sie zu. Sie aber wich zur Seite, doch konnte er ihr schnell noch ein Ringlein an den Finger stecken. Sie eilte wie das erste Mal auf weiten Umwegen ins Schloß zurück, huschte durch ein Nebenpförtchen hinein, bei dem sie niemand bemerken konnte, und stieg die Treppen hinauf in ihr Stüblein, wo sie das schöne Kleid auszog und wieder in die Lumpen schlüpfte.
Am dritten Sonntag hatte sie wieder die Erlaubnis erhalten, zur Messe zu gehen. Für diesen dritten Kirchgang wählte sie das Sternenkleid aus, das sie noch nie getragen und sie am herrlichsten schmückte. Nach der Messe war der Prinz wieder zur Stelle.
Doch sie wich ihm schnell aus, und als er ihr nachfolgte, sprang sie davon. Er lief ihr nach, doch er erreichte die Fliehende nicht, die davon schoß wie eine Gemse. Im Fliehen aber flog ihr ein Schuh von den Füßen, den der Prinz aufhob und in die Tasche steckte.
Als der Prinz zu Hause war, den Schuh der Mutter vorwies und ihr erzählte, wie es ihm ergangen sei, da war der Drächengrudel schon in der Küche in seinen alten verfleckten Kleidern und hantierte mit Pfannen und Tellern. Der Prinz war sehr aufgeregt und sagte zur Mutter: "Sie ist mir leider entwischt, aber hier habe ich den Schuh von ihrem Fuß, und nur die werde ich heiraten, der dieser Schuh gehört!"
Da erwiderte die Mutter: "Ich will dir helfen, mein Sohn. Wir laden auf morgen alle vornehmen Töchter des Landes zu einem großen Mahl ein, lassen den Schuh von jeder anprobieren, und welcher er paßt, nun, die soll deine Frau werden!" Der Prinz war damit einverstanden. Die Boten wurden im Lande herumgeschickt, auf alle Schlösser und Burgen mit dem Auftrag, zum Hoffeste einzuladen.
Am nächsten Tag erschienen die vornehmen Töchter alle am Hofe, jede im schönsten Kleid, denn jede dachte, der Prinz werde sich vielleicht heute schon eine Frau auswählen. Die einen hatten sich schneeweiß gekleidet wie Schlehdorn, andere rot wie Heckenrosen und andere wieder grün, in allen Farben.
Als sie alle im Saale Platz genommen, wurde der Schuh hereingebracht und ihnen mitgeteilt, daß der Prinz diejenige zur Frau begehren werde, deren Fuß in diesen Schuh hineinpasse. Jede wollte zuerst hineinschlüpfen, aber den meisten war er zu klein, und doch waren mehrere da, deren Füße hineinpaßten, obwohl es dem Prinzen schien, daß die, welche er dreimal in der Kirche gesehen, nicht dabei und also keine die Richtige sei.
Der Drächengrudel war in der Küche und half das Essen bereiten. Die herrlichsten Gerichte wurden vom Koch zubereitet und zuletzt auch Küchlein. Da fragte der Grudel den Koch, ob er nicht auch ein Küchlein backen dürfte. Der Koch machte ein langes Gesicht und schnauzte ihn an. "Nun, wenn es nicht gerät, so werde ich es selbst essen", sagte der Grudel und bat so lange, bis der Koch sagte: "Meinetwegen, es ist besser, du fressest dein eigenes Backwerk als meine feinen Gerichte!"
Da machte sich der Grudel an die Arbeit, und als das Küchlein gebacken war, duftete es nicht nur sehr fein und war das best geratene, sondern auch das schönste von allen, und der Koch fand selbst, man dürfe es obendrauf auf die Platte legen und mit den anderen hineintragen in den Speisesaal. Der Grudel aber hatte das Ringlein des Prinzen vom Finger gezogen und in das Küchlein hineingesteckt.
Die Platte wurde aufgetragen und das schöne Küchlein, das zuoberst lag, dem Prinzen, der heute nicht lustig sein mochte, vorgelegt. Er schnitt es entzwei, und da fiel das Ringlein heraus. Die Traurigkeit war wie auf einen Schlag weggewischt, und seine Augen leuchteten. Er ließ den Koch kommen und fragte ihn, wer das oberste Küchlein gebacken habe. Der Koch erschrak und dachte, es sei etwas nicht in Ordnung.
Der Prinz sagte: "Wenn es der Drächengrudel ist, so sage ihm, er solle die schönen Kleider anziehen, die er sonntags in der Kirche getragen hat!" Der Koch eilte in die Küche zurück und sagte zum Grudel: "Du sollst hinaufgehen und die Sonntagskleider anziehen und vor dem Prinzen und der ganzen vornehmen Gesellschaft im Speisesaal erscheinen."
Der Grudel hüpfte in sein Zimmer hinauf, wusch und kämmte sich, ließ wie jeweilen am Sonntag die Haare über die Schultern niederfallen und zog alle drei Kleider an, das Sonnenkleid zuerst, dann das Mondkleid und zuoberst das Kleid des Firmamentes. Sie besaß aber nur einen Schuh, der zu den Kleidern paßte, da der andere unten im Saal war, aber das machte nichts.
Sie trat in den Saal, schlüpfte vor der ganzen Tafelrunde schnell in den Schuh, der noch am Boden lag und ihr saß wie angegossen, und nun richteten sich aller Augen auf sie. Der Prinz stürzte zu ihr hin, führte sie neben seinen Platz an den Tisch, den er leer gelassen, und hieß sie vor allen Anwesenden seine Braut.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
VOM PFLASTERBUB ZUM PRINZEN ...

Ein reiches Ehepaar hatte einen Sohn. Der Vater hatte seine Gelder in einer anderen Landschaft angelegt. Als der Sohn herangewachsen war, sagte er zu ihm: "Du kannst mich jetzt begleiten, wir holen die Zinsen. Das nächste Mal kennst du dann den Weg und kannst dann allein gehen!" Der Sohn begleitete den Vater, und sie holten den Zins. Nach einem Jahr sagte der Vater: "Geh und hole mir den Zins, den Weg kennst du ja!"
Der Sohn begab sich auf den Weg und erhielt den Zins, mußte aber in der Stadt über Nacht bleiben. Im Verlauf des Abends ging er spazieren. Da sah er eine Gruppe von Leuten, die einen toten Menschen auspeitschten. Als er fragte, was das zu bedeuten habe, erhielt er zur Antwort: "Das ist hier so der Brauch: wer stirbt, ohne seine Schulden zu bezahlen, wird ausgepeitscht!" Das schien ihm eine Barbarei zu sein. Er fragte, wie groß die Schulden des Toten seien. Als man ihm die Summe nannte, griff er in den Sack, zog die Zinsen heraus und bezahlte die Schuld, damit der Tote nicht länger mehr geprügelt werde. Dann zog er nach Hause.
Der Vater fragte ihn, wo er das Geld habe. Da zeigte der Sohn den leeren Sack und erzählte seine Erlebnisse. Der Vater wurde sehr böse und schrie ihn an: "Du dummer Narr, der Tote hat ja die Schläge nicht gespürt, lasse mir solche Streiche in Zukunft!"
Nach einem Jahr hieß ihn der Vater wieder den Zins holen, "aber die Dummheiten laß mir sein", ermahnte er ihn. Der Sohn unternahm die Reise und erhielt den Zins. Auf der Rückreise kam er bei einem großen Gebäude vorüber. Zuunterst in der Mauer war ein kleines Loch, und drin bemerkte er eine Frauenhand, die winkte. Er fragte, wer drin sei.
Da rief es aus dem Gefängnis: "Hilf mir heraus, ich bin eine gestohlene Jungfrau!" Er ergriff ein Messer, vergrößerte das Loch und zog sie heraus. Dann begleitete er sie in die nächste Stadt, suchte eine Wirtschaft, in der er das Mädchen für die Kost verdingen konnte, und drückte dem Wirt den ganzen Zins für sie in die Hand.
Zu Hause angekommen, fragte der Vater, wo er den Zins habe. Er erzählte, wie er dazugekommen, das Geld für ein Werk der Nächstenliebe auszugeben. Da wurde der Vater böse und jagte ihn fort. Da zog er in die Stadt zu dem Mädchen. Dieses erzählte ihm, sie sei eine Königstochter, sie hätte dem Vater geschrieben, und er habe ihr Geld gesandt. Sie lud ihn ein, sie nach Hause zu begleiten, denn sie hatte schon Neigung zu dem tapferen Burschen gefaßt.
Sie mußten über das Meer reisen. Der Kapitän des Schiffes sah wohl, daß die Königstochter in den Begleiter verliebt war. Ihm gefiel sie aber auch, und er machte mit den Matrosen aus, ihn ins Meer zu werfen. Als sich ein Sturm erhob, rief man den Burschen aus der Kabine und bat ihn, auch Hand anzulegen. Als er helfen wollte, wurde er gefaßt und ins Meer geworfen. Er konnte sich an einem Brett festklammern, das ihn über Wasser hielt, und während das Schiff fortzog, wurde er ans Ufer einer Insel geschwemmt.
Die Königstochter weinte und trauerte um den verlorenen Geliebten. Der Kapitän aber brachte sie ihrem Vater, dem König, und sagte, er habe ihr das Leben gerettet und verlange sie zur Frau. Der König war damit einverstanden. Die Tochter aber sehnte sich nach ihrem wirklichen Retter und schob die Heirat immer hinaus; noch ein Jahr wenigstens sollte der Kapitän warten.
Der unglückliche Bursche auf der Insel schaute jeden Tag aus, ob nicht ein Schiff käme, dem er ein Zeichen geben könne. Aber weder Segel noch Mäste zeigten sich, und so verstrich ein ganzes Jahr. Da kam eines Tages ein Hase durchs Wasser geschwommen, der anfing zu reden: "Setze dich auf meinen Rücken und sage mir, wohin ich dich tragen soll!"
Der Bursche nannte die Gegend, wo die Königstochter zu Hause war, und der Hase trug ihn durchs Meer ans Land. Zum Abschied sagte das Tier: "Ich bin der Tote, den man ausgepeitscht und für den du bezahlt hast. Als Hase muß ich meine Schulden abbüßen, aber jetzt bin ich erlöst!" Damit verschwand er.
Der Bursche wanderte zu und kam in die Residenz. Als Pflasterjunge wurde er im Palast des Königs angestellt. Auf dem Schiff hatte er der Königstochter oft auf einer Flöte vorgespielt. Diese Flöte, die er immer bei sich getragen, hatte er gerettet. Nach Feierabend setzte er sich auf die Mauer und spielte seine alten Weisen. Die Königstochter hörte ihn und sagte: "Wenn er nicht ins Wasser gestürzt wäre, so würde ich sagen, das sei mein Geliebter, der da unten spielt, denn grad solche Melodien hat er geblasen!"
Unterdessen war die Hochzeit angesagt worden, denn das Jahr war um. Zum Hochzeitstage war der Pflasterbub als Flötenspieler eingeladen worden. Beim Gastmahl schlug nun der König vor, jeder der Gäste möchte etwas aus seinem Leben erzählen. Als der Kapitän an die Reihe kam, erzählte er, wie er seine Braut vor dem sicheren Tode gerettet habe.
Da wurde auch der Flötenspieler aufgefordert, seine Schicksale zu erzählen. Er sagte: "Gestattet mir zuerst eine Frage an den Kapitän: Welchen Tod erleiden diejenigen auf den Schiffen, die falsch schwören?" Der Kapitän gab zur Antwort: "Die werden lebendig gevierteilt!"
Da fing er nun an mit seiner Lebensgeschichte, erzählte, wie es ihm ergangen sei, wie der Kapitän ihn ins Meer geworfen habe und wie er wunderbar gerettet worden sei. Die Königstochter erkannte ihn und stürzte in seine Arme. Der Kapitän wurde gefesselt und in den Turm geworfen. Er sollte nach seinem eigenen Urteil gevierteilt werden, aber der Flötenspieler verwendete sich für ihn; er habe seinerzeit einen Toten losgekauft und er finde, ein Lebendiger sei noch mehr wert. Da wurde der Kapitän aus dem Lande gewiesen, und der Bursche heiratete nun die Prinzessin.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DAS BETTELMÄDCHEN
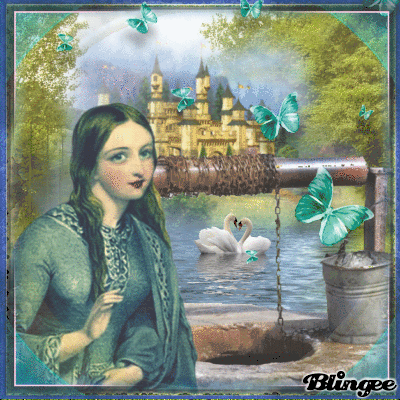
Es lebte ein alter Burgvogt, der wünschte, daß einst sein Sohn, der junge Graf, heirate, damit das Burgvogtrecht in der Verwandtschaft bleibe. Der Vater gab nun ein Mahl, an dem er sich äußerte, daß sein Sohn demnächst heiraten werde. Der Sohn erwiderte dem Vater, daß er geneigt sei zu heiraten, nur solle man ihm die Wahl überlassen und nichts dagegen einwenden, ob er nun bald ein reiches oder ein armes Mädchen nach Hause bringe, die Hauptsache sei, daß sie ihm gefalle.
Daraufhin unternahm er einen großen Spaziergang und kam durch ein Dorf, wo er ein Mädchen am Brunnen waschen sah, das ihm sehr gefiel. Wieder zu Hause angelangt, ließ er die Schneiderin kommen und eine Magd, die ungefähr von der selben Größe war wie das Brunnenmädchen, und ließ für die Schöne ein Kleid anmessen. Als das Kleid fertig war, ließ er den Wagen anspannen und fuhr mit dem neuen Kleid in das Dorf vor das Haus des Mädchens, wo er ausstieg.
Er fand Mutter und Tochter zu Hause. Er bat die Mutter um die Hand ihrer Tochter; er habe sie am Brunnen gesehen und wünsche sich keine andere zur Frau. Die Mutter entgegnete: "Das ist gewiß nur ein Traum oder ein Scherz von Euch, Herr, ich bin arm und kann dem Mädchen nichts geben. Wenn Eure Neigung aber eine ernste ist, so will ich nicht dagegen sein!" Da fragte er die Tochter, und diese erwiderte ihm dasselbe wie die Mutter. Da sagte der Herr zu dem Mädchen: "Ja, es ist mir ernst, nur mußt du mir versprechen, in allen Fällen gehorsam zu sein!"
Sie versprach es mit Herz und Hand, und nun packte er das schöne Kleid aus, sie zog es an, und es paßte ihr gut; dann nahm er sie mit in den Wagen, fuhr mit ihr nach Hause und hielt Hochzeit.
Das arme Mädchen hatte sich bald in die vornehmen Verhältnisse hinein gefunden. Nach zwei Jahren gebar sie ein Mädchen. Als es zwei Jahre alt war, sagte der Burgvogt zu seiner Frau: "Du hast mir versprochen, immer gehorsam zu sein; das Volk beginnt zu murren, daß das erstgeborne Kind nicht ein Bub ist, drum wäre es besser, wenn wir das Kind entfernten!" Die Mutter erwiderte: "Was ich versprochen, bin ich bereit zu halten!" Sie gab dem Kleinen ihren Segen und ließ es fortnehmen; sie wußte nicht, wohin es kam, und fragte auch nicht.
Nach weitern zwei Jahren gebar sie einen Sohn. Zwei Jahre verflossen, und da trat der Graf wieder vor sie und sagte: "Das Volk murrt, daß der Kleine der Sohn eines ehemaligen Bettelmädchens ist, drum ist es besser, wenn er fortkommt!" Die Mutter hatte nichts dagegen einzuwenden und erteilte ihrem Söhnchen den Segen. Beide Kinder wurden, ohne daß die Mutter es wußte, zu Verwandten gebracht und dort standesgemäß erzogen.
Nach einigen Jahren trat der Graf wieder vor seine Frau und sagte: "Das Volk murrt gegen mich, daß ich dich geheiratet habe; wenn ich Frieden haben will, so müssen wir uns trennen. Geh du wieder in dein Elternhaus, dann werde ich eine Vornehme heiraten, und das Volk wird wieder zufrieden sein!" Die Frau wurde traurig und sagte: "Ich habe dir versprochen, in allen Teilen zu gehorchen, und werde mein Wort halten, ohne zu murren!"
Da holte ihr der Gemahl die Bauernkleider, die er aufbewahrt hatte; sie zog ihr schönes Gewand aus und schlüpfte in das Bettelkleid. Der Graf gab ihr einiges Geld mit, und sie zog wieder nach Hause. Die Mutter suchte sie zu trösten: "Ich habe es dir gesagt, es geht so lange, dann bist du ihm verleidet!"
Nach zwei Jahren ließ sie der Graf wieder in seine Burg rufen und sagen, sie möchte das Schloß putzen und fegen helfen, denn er wolle wieder heiraten. Sie gehorchte und fegte das Schloß mit den anderen Dienstboten von oben bis unten, Dem Burgvogt gingen dabei die Augen über. Dann sagte er zu ihr: "Wenn ich nun Hochzeit halte, so sollst du allein mir aufwarten!" Sie nickte stumm und ging an die Arbeit.
Am Hochzeitstage saß neben dem Grafen ein blutjunges, schönes Mädchen. Er fragte seine Aufwärterin, wie ihm die Braut gefalle. Sie antwortete: "Sie gefällt mir gut, nur wünsche ich, daß sie Euch immer gefallen möge bis an Euer Ende und sie nicht einst so hart abgewiesen wird wie ich!"
Da fiel ihr der Graf um den Hals und rief aus: "Ich wollte nie eine andere heiraten; die du da siehst und als meine Braut wähnst, ist unsere Tochter, die ich von dir genommen habe, und der schöne Jüngling neben ihr ist unser Sohn. Jetzt bist du wieder meine Gemahlin und lebst im Schlosse mit mir, und wir halten treu zusammen, bis der Tod uns trennen wird!"
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER SCHLAUE BETTLER UND DER MENSCHENFRESSER ...

Es war einmal ein Bettler, der verirrte sich im Walde und kam zu einer Höhle. Da wohnte ein Riese, der war ein Menschenfresser. Seine Frau aber, die er einst aus dem Dorfe geraubt hatte, war ein gutes Weib, der es leid tat, daß ihr Mann so böse war. Sie war allein zu Hause, als der Bettler kam, und sie gab ihm zu essen und zu trinken, soviel er wollte.
Als er sich es am besten schmecken ließ, da hörte man plötzlich vom Eingang her ein erschreckliches Schnaufen und schwere Tritte; das war der Menschenfresser. Der Bettler zitterte am ganzen Leibe, aber die Frau hieß ihn schnell unter das Bett kriechen, wo er sich versteckte.
Der Riese kam herein und warf das Holz, das er für den Herd gesammelt, auf den Boden, daß die ganze Höhle erbebte und dem Bettler Hören und Sehen verging. Dann spürte es überall herum und sagte dabei in einem fort: "Ich rieche Menschenfleisch, ich rieche Menschenfleisch." Nicht lang, so hatte er den armen Mann gefunden und zog ihn hervor.
"Den sollst du mir heute Abend braten", sagte er zu seiner Frau. "Aber vorher sollst du mich noch zum Imbiß bedienen, kleiner Kerl", fuhr er fort, "zeig her, was du kannst."
Da mußte ihm der Bettler zuerst die Stiefel ausziehen, dann das haarige Gesicht waschen, darauf den Kopf vom Ungeziefer reinigen und zuletzt kochen. Das verstand er, denn er hatte sich immer selber sein geringes Essen bereitet, und er kochte dem Menschenfresser eine großmächtige Schüssel voll Nudeln.
Die schmeckten dem Riesen, denn er hatte dergleichen noch nie gegessen. Er wurde ganz freundlich und hieß den Bettler mithalten. Dem war es aber nicht ums Essen, er tat nur dergleichen und schüttete jeden Löffel voll in seinen Bettelsack, den er vorn um den Hals gebunden hatte.
Als die Schüssel leer war, sagte der Riese: "Ich möchte noch mehr."
"Ich möchte auch noch mehr", sagte der Bettler.
"Schaff her! Oder ich fresse dich!" schnarchte der Menschenfresser.
"Ich wüßte einen Rat", meinte der listige Bettler, "wir müssen uns die Bäuche aufschneiden, so können wir noch einmal von vorn anfangen."
Der andere war zufrieden, wenn der Bettler es zuerst täte. Dieser holte ein Messer in der Küche, schnitt seinen Bettelsack auf und schüttete die Speise in die Schüssel; der Riese fiel sogleich drüber her und hatte sie - was gibst, was hast - verschlungen.
Da fing er wieder an: "Ich möchte noch mehr."
"Ich auch", sagte der Bettler.
"So ist es an mir", sprach der dumme Riese, nahm das Messer und schnitt sich den Bauch auf von unten bis oben, so daß er sogleich tot hinfiel. Und der Bettler hat ihn nicht verbunden, sondern ist froh gewesen, daß er so gut davongekommen ist.
Die gute Menschenfressersfrau aber dankte dem lieben Gott, daß sie den Unmenschen los war, und sie gab dem Bettler alle Schätze ihres Mannes, und er nahm sie zu seiner Frau. Sie zogen darauf ins Dorf, kriegten noch Kinder und Großkinder, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE DREI BRÜDER ...
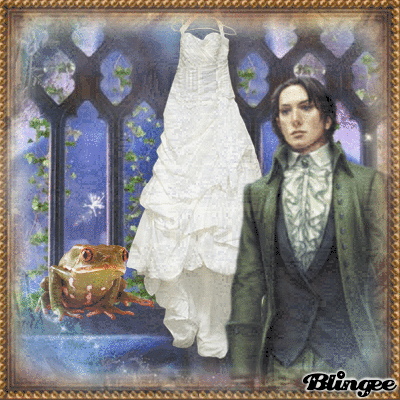
In Kandersteg gab es ein Elternpaar mit drei Buben. Der jüngste hieß Hans. Den mochten die anderen zwei nicht leiden, weil er ein bißchen dumm war. Da die Eltern nur ein kleines Gütchen besaßen, dachten sie, es lohne sich nicht, drei Teile daraus zu machen, und da ihnen alle drei Kinder gleich lieb waren, wußten sie nicht, wem sie einmal das Gütchen übergeben sollten. Da sagte der Vater zu ihnen: "Es wäre jetzt Zeit für euch, zu heiraten, aber alle drei könnt ihr nicht hier bleiben, einer muß das Haus haben und was dazugehört, und die anderen müssen fort. Aber wem soll das Haus gehören?"
Die Mutter dachte, sie wisse schon, wie sie es anstellen werde. Sie holte drei Büschel Flachs und gab einem jeden ein Büschel in die Hand. "So, geht jetzt damit zu euren Schätzen und laßt den Büschel spinnen. Wer mir das schönste Garn zurückbringt, der soll heiraten und das Gut erhalten."
Die beiden älteren Brüder dachten: ‚Meine ist sicher im Spinnen !' Der Hansel aber hatte keinen Schatz und wußte nicht, wohin er gehen sollte. Er steckte den Flachsbüschel in den Sack und spazierte durch das moosige Gras. Da hörte er eine Stimme, die ihm zurief: "Hans, wo willst du hin?" Er schaute sich um, sah aber niemanden. Da rief es zum zweiten Mal: "Hans, wo willst du hin?" Da er aber niemanden sah, dachte er: ‚Schrei du nur zu', und lief fort.
Als es aber zum dritten Mal rief, ging er einige Schritte zurück und sah nun eine Kröte, die in den Halmen drin saß und ihn fragte, wohin er wolle. Er sagte: "Die Mutter gab mir diesen Büschel Flachs, und jetzt suche ich eine Spinnerin, aber ich werde wohl keine finden!" Da rief die Kröte: "Gib mir den Flachs!" Er sagte: "Nun, was willst du damit anfangen?" Die Kröte versetzte: "Doch, gib her, ich will ihn dir spinnen, und am Tag, an dem deine Brüder ihr Gespinst abholen, kannst du auch kommen!" Da sagte er: "Ich weiß doch keine Spinnerin, so nimm den Büschel", und er warf ihn ins Wasser, und die Kröte schwamm damit fort. Keinem Menschen sagte er, was ihm begegnet war.
Am Tage, an dem das Garn abgeholt werden sollte, liefen die älteren Brüder fort, beide Sieges gewiß. Hans dachte, er wolle auch hingehen und nachsehen, und da hing das Garn an der Staude im Wasser, wo die Kröte gesessen hatte. Er nahm es, und nun schwamm die Kröte heran und sagte: "Bring das Garn deiner Mutter, das Haus wirst du bekommen und das Vermögen auch; dann geh zum Pfarrer und laß dich mit mir auskünden, und wenn der Pfarrer nicht will, so bestehe darauf.
Kauf für dich und mich das Hochzeitskleid, häng das meine in der Sakristei auf und bestimme den Hochzeitstag. Und wenn ich nicht komme, so werde nur nicht ungeduldig; wenn du ausharrst, so werde ich schon zur rechten Zeit erscheinen!"
Hans brachte das Garn seiner Mutter. Diese prüfte es und verglich es mit den beiden anderen Bündeln und sagte: "Hansel, das deine ist das schönste, du bekommst das Haus und das Feld, und die anderen zwei müssen ausziehen, und nun laß dich mit deinem Schatz verkünden!"
Hansel ging zum Pfarrer und bat ihn, auf der Kanzel die Verkündung anzuzeigen. Aber der Pfarrer sagte, er sei ein dummer Kerl, das solle wohl ein Scherz sein, daß er eine Kröte heiraten wolle, aber Hansel bestand darauf, und der Pfarrer mußte nachgeben. Die Leute schauten den Hansel noch für einen größeren Narren an als bisher, als sie hörten, was er vorhatte. Hans ließ sich aber nicht stören. Er ließ das Kleid anfertigen und bestimmte den Hochzeitstag.
Die Kirche war gesteckt voll, das Hochzeitskleid seiner Braut hing in der Sakristei, und Hansel saß im Stuhl. Die Leute und der Pfarrer dachten, das sei nur Spaß. Als Hansel vor dem Altar stand, kam eine Kröte durch den Chor dahergehüpft. Sie hüpfte ins Kleid hinauf, das am Nagel hing, und da stand auf einmal ein schönes Fräulein neben Hansel vor dem Altar.
Die anderen machten große Augen und beneideten ihn. Der Pfarrer gab sie zusammen, und sie lebten in gutem Frieden.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE WEISSEN VÖGEL VOM ARPSEE ...

Ein armer Geißbub trieb alle Tage seine Ziegenherde zu dem Arpsee hinauf. Als er einst zur Mittagszeit sein schwarzes Ledertäschchen öffnete, um Mahlzeit zu halten, flogen drei weiße Vögel heran und ließen sich auf dem See nieder. Solch große Vögel hatte er noch nie gesehen. Ihr Federkleid war schneeweiß, der Hals lang und dünn und der Schnabel gelb. Sie schwammen eilig gegen ihn heran und schienen vor ihm keine Furcht zu hegen.
Die Vögel gefielen dem Geißbuben sehr, und er ergriff Steine, um den einen oder anderen tot zu werfen; er traf aber nicht. Die Vögel ließen sich durch sein böses Vorhaben nicht erschrecken und rückten dem Ufer immer näher. Da trat er ans Wasser heran, ergriff den Vogel, der ihm zunächst war, am Halse und zerrte ihn ans Land. Aber im Nu ließ er ihn wieder fahren und fuhr zusammen wie noch nie in seinem Leben, denn der Vogel fing an zu reden:
"Ach, was willst du mich so grob behandeln, ich bin nur der geringste der drei Vögel, und wir sind gar keine Vögel, sondern verwunschene Jungfrauen. Der schöne Schwan mit dem goldenen Schnabel ist eine Prinzessin vom Land der Radamanten. Wir zwei anderen sind Kammerzofen, und wir sind alle drei von einem Hexenmeister verwandelt worden, weil die Prinzessin nicht heiraten wollte. Jetzt müssen wir so lange Vögel bleiben, bis wir drei Sachen erhalten. Drei Pflanzen müssen es sein, und wenn du uns diese verschaffen kannst, so werden wir wiederkommen und dann bald erlöst werden!"
"Nennt mir die drei Pflanzen", sagte der Bub. "Naterkraut, Baldrian und Nachtschatten müssen es sein." Der Geißhirt sagte, er kenne die Kräuter nicht, aber seine Mutter sei Kräutersammlerin und werde sie schon kennen.
"So geh und komm bald wieder", sagte der Schwan und schwamm zu den Gefährten zurück, dann flogen sie alle drei zusammen auf und verschwanden hinter dem Berge.
Der Bub trieb die Herde bald darauf nach Hause und erzählte seiner Mutter, was ihm heute begegnet sei. Drei schöne weiße Vögel seien auf dem Arpsee herum geschwommen, er habe den einen erwischt, und der habe ihn angesprochen und die drei Kräutlein von ihm verlangt zur Erlösung. Die Mutter sagte: "Wenn nur das fehlt, so ist bald geholfen; ich kenne die Kräuter wohl, sie wachsen hier in der Nähe."
Sie sammelte sie noch im Verlauf des Abends und legte sie zu der Speise ins schwarze Täschlein. Am nächsten Morgen zog der Bub mit den Ziegen wieder hinauf zum See. Als er aufblickte, flogen die Vögel schon daher, ließen sich auf dem blauen kühlen Wasser nieder und schwammen eilig auf ihn zu. Der Bub zog die drei Kräutlein heraus. Die Schwäne ruderten mit aller Kraft zu ihm hin, und er steckte jedem eines der Kräutlein in den Schnabel.
Der eine fing wieder an zu reden und sagte: "Wir danken dir sehr, lieber Bub, für den großen Dienst, den du uns erwiesen hast; wir fliegen jetzt wieder zurück ins Land der Radamanten, wo man uns mit Hilfe der drei Kräutlein erlösen wird; der Zauberer aber muß sterben. Wenn du willst, so nehmen wir dich mit. Du brauchst nur zwei von uns an den Flügeln zu ergreifen, dann geht es durch die Lüfte, und bevor die Sonne sinkt, sind wir zu Hause!"
Der Geißbub sagte: "Ich danke schön, ich bleibe lieber Geißbub im Walliserland, als daß ich mit euch zu den Radamanten fliege!"
Da flogen die Vögel auf und verschwanden.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DAS ZWERGLEIN TÜRLIWIRLI ...
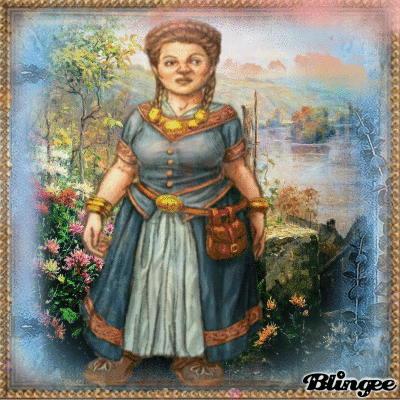
Ein Oberemser Bursche heiratete das Türliwirli, die Tochter eines Zwerges. Die Frau bat ihn eines Tages, er möchte ihr versprechen, sie nie beim Namen zu nennen, was er auch gelobte. Im Juni ging er ins Alpwerk, und als er spätabends nach Hause kam, sagte ihm die Frau, heut hätte sie böse Zeit gehabt, denn diese Nacht werde es gefrieren, und da hätte sie das grüne Korn geschnitten und zwischen Tannenreiser gelegt. Der Mann fuhr auf und rief: "Du vermaledeites Türliwirli", doch kaum hatte er das gesagt, war sie zur Tür hinaus und verschwunden. In der Nacht gefror es, und die Saaten der Nachbarsleute gingen zugrunde.
Der Mann hatte drei Kinder, die er zu Hause ließ, wenn er auf die Arbeit ging. Da kam denn jeden Morgen die Mutter, wusch und kämmte sie, so daß der Vater, wenn er heimkehrte, die Stube aufgeräumt fand und die Kinder gewaschen und ordentlich angezogen. Da fragte er, wer das tue, er habe doch das Haus geschlossen und den Schlüssel versteckt. Die Kinder riefen, die Mutter sei gekommen und hätte das alles besorgt.
Der Vater hatte ein großes Verlangen nach seinem Weibe, und er hätte ihr gerne Abbitte geleistet, wenn sie sich nur gezeigt hätte. So sagte er den Kindern, sie sollten doch die Mutter fragen, wie sie es nur anstelle, ins verschlossene Haus zu kommen.
Als die Kinder die Mutter darum befragten, erwiderte sie, sie wisse doch schon, wo der Schlüssel stecke. Der unglückliche Vater bat nun einen Freund, aufzupassen, und wenn die Frau ins Haus trete, die Tür zu schließen und ihn zu rufen. Das geschah auch, und nun eilte der Vater ins Haus und bat die Frau um Verzeihung. Nun lebten sie noch manches Jahr glücklich zusammen.
Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER SCHWEINEHIRT ...
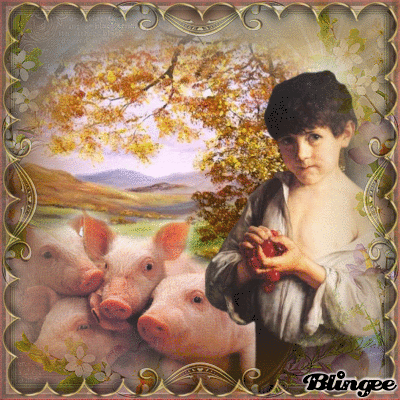
Vor hundert Jahren war in einem großen Königreich ein kleiner Schweinehirt. Der saß eines Mittags müd am Feld und sah in der Ferne die Pflüger sitzen beim Imbiß, wo sie fleißig löffelten und abschnitten und einschenkten, derweil er selbst einen gewaltigen Hunger empfand und doch vor Abend nichts kriegen sollte. Da sprach er zu sich selbst: "O daß ich doch ein Bauer wäre gleich diesen, wie zufrieden wollte ich sein."
Und siehe da! Plötzlich, wie wenn er es nur so träumte, war die ganze Gegend rings um ihn her verändert. Ein Baumgarten stand an der Stelle des gepflügten Feldes, der grenzte an einen wohlhabenden Bauernhof, und hier, mitten unter dem Hühner- und Taubenvolk, das im Hof herumspazierte, stand er selber, der arme Schweinejunge, als stattlicher Bauer und war ganz in Gedanken versunken, weil er gerade den heutigen Ertrag seines gesamten Wiesen- und Ackerlandes noch einmal überschlug.
Da ritt ein Kornhändler vor dem Hoftore vorüber, der weckte den Bauer aus seinen Gedanken auf, denn er hatte sich ein Räuschchen getrunken, war lustig und klimperte nur so mit der Geldkatze: "He,
Bäuerlein, wie teuer das Mäs?"
Der Bauer antwortete: "Kann es nicht wohlfeiler geben, hab es Euch schon gesagt; wir gehen zugrunde, wenn es nicht bald um das Halbe mehr gilt."
Der Kornhändler aber strich sich höhnisch das dicke Bäuchlein, verbeugte sich mit Spott im Gesicht und ritt unter Singsang davon. "O daß ich doch so ein Kornhändler wäre", seufzte der Bauer hinter ihm drein, "wie zufrieden wollte ich sein!"
Da saß er plötzlich vor einem eigenen vollen Kornmagazin und riß sich die Haare vom Kopf und kratzte sich hinter den Ohren bis aufs Blut. Jetzt eben war der Krieg aufs höchste gestiegen, und das Heer litt Mangel. Dem Wucherer hatte das Korn noch nicht gegolten, was er verlangte, und gerade brach ein Rudel Soldaten mit Gewalt in das Magazin, trug Sack um Sack auf bereitstehende Wagen, gab dem Kornhändler bald Scheltworte, bald Püffe und zog unter dem Befehl eines dickbäuchigen, rotbäckigen Obersten, der zu Pferd saß, jauchzend und hohnlachend davon.
"O daß ich doch so ein Kriegsoberst wäre, wie zufrieden wollte ich sein!" rief der Kornhändler. Stracks stand er als Oberst vor einem Kriegsgerichte, wo der Minister des Königs ihm das Urteil lebenslänglicher Gefangenschaft sprach, weil er gewaltsam wider Recht und Billigkeit verfahren und dem eigenen Volke sein heiligstes Eigentum entrissen habe. Es half nichts, daß der Oberst einen außerordentlichen, aber im Felde verlorenen Befehl zur Rechtfertigung anführte und sich auf den schuldigen Gehorsam berief. Der Minister hieß ihn durch die Schergen abführen und blickte stolz auf den Verurteilten und die ganze tief untertänige Versammlung.
"O daß ich doch so ein fürstlicher Minister wäre", rief der Oberst aus, "wie zufrieden wollte ich sein!" Und alsbald saß er in einer elenden Kutsche mit seiner weinenden Frau und ein paar schluchzenden Kindern und fuhr durch ein düsteres Tor, während faule Äpfel und Eier zum Fensterchen herein flogen, daß er mit Not ihnen ausbeugen konnte. Jetzt trat ein Offizier an den Schlag, zuckte die Achseln und sagte: "Ja, Herr Minister, es sind freilich nur Lügen und Ränke, mit welchen Seine Majestät der König zur Ungnade gereizt wurden, aber es ist gut, in möglichster Eile davonzujagen und in den nächsten zwölf Jahren dieses Land nicht wieder zu betreten, da ja doch Eure Güter und Häuser nun eingezogen werden und alle Freundschaft verschwunden ist. Der König . . . "
"O daß ich ein König wäre", stöhnte der Minister, "dann erst wollte ich zufrieden sein!" Aber schon lag er krank in einem königlichen Lehnsessel, den vier Heiducken mühsam eine verborgene Treppe hinunter zwängten. Der Krieg hatte fortgewährt, der König war selbst in das Feld gezogen, war krank geworden durch die ungewohnten Anstrengungen und sollte jetzt einem nächtlichen Überfall des Feindes entzogen werden. Dabei vermochte er auf keinem Beine zu stehen und litt fürchterliche Schmerzen von der Gicht.
Da schrie er ganz überlaut:
"O daß ich doch der armseligste Sauhirt meines Landes wäre und nur gesund, nur gerettet aus dieser Leibesgefahr! Wie zufrieden wollte ich sein!" Und siehe! Das geschah. Plötzlich saß der
König wieder als kleiner Schweinehirt am Rand des Feldes; er erkannte sich in seinen Lumpen und nahm einen tollen Freudensprung über die größte Sau hinweg, denn jetzt war er wirklich zufrieden.
Otto Sutermeister, Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE SCHLANGENKÖNIGIN ...
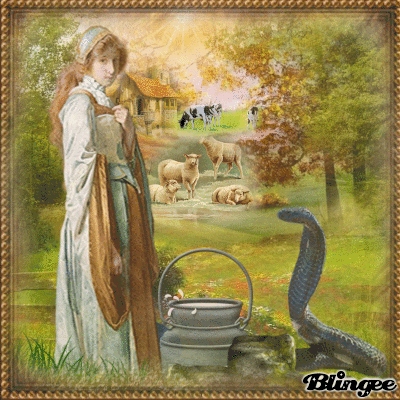
Eines Tages fand ein Hirtenmädchen auf einem Felsen eine kranke Schlange liegen, die eben am Verschmachten war. Das dauerte das Mädchen, und es reichte ihr den Milchkrug hin, den es an der Hand trug. Die Schlange ließ sich nicht zweimal einladen, sie lappte begierig von der Milch und erholte sich zusehends, bis sie endlich wieder so viele Kräfte gewonnen hatte, daß sie davon kriechen konnte.
Bald darauf meldete sich bei dem Vater des Mädchens ein armer, junger Hirt, der bat ihn, daß er ihm seine Tochter zur Frau geben möchte. Der alte Hirt war aber ein reicher und stolzer Mann und sagte spöttisch: "Wenn du erst einmal so viel Herden hast wie ich, dann geb ich dir meine Tochter."
Das ging aber gar nicht lang. Denn von der Zeit an kam alle Nächte ein feuriger Drache und verwüstete dem Alten die Triften, daß er bald kein Futter mehr für seine Herden finden konnte und ihm eine um die andere zugrunde ging.
Da kam der junge Hirt wieder, denn er war jetzt so reich wie der Vater, und bat um die Hand des Mädchens; nun konnte der Alte sie ihm nicht mehr verweigern.
Am Hochzeitsmorgen aber kam plötzlich in das Zimmer der Braut eine Schlange, auf der selben saß eine schöne Jungfrau, die sagte: "Da hast du meinen Dank dafür, daß du mich in der Not mit Milch
gespeist hast!"
Damit nahm sie eine glänzende Krone von ihrem Haupt und warf sie der Braut in den Schoß. Hierauf verschwand sie samt der Schlange wieder, wie sie gekommen war. Die Braut aber hob die Krone auf und hatte lauter Glück und Segen damit ihr Leben lang.
Otto Sutermeister, Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz. Aarau 1873, Kanton Bern
VON DEN ZWEI SCHWESTERN ...
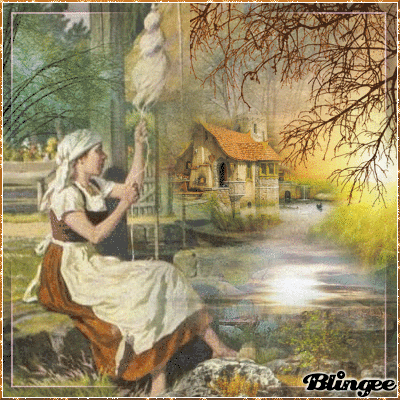
Einmal war ein Mann und ein Weib, welche zwei Töchter hatten; die eine war hässlich, aber gut, die andere dagegen schön, aber böse. Die Mutter liebte die schöne mehr als die hässliche und gab dieser letztern immer viel zu arbeiten.
Einmal schickte sie die selbe mit dem Rocken hinaus zu spinnen. Das gute Mädchen kam zu einem Bache, aber unversehens trug ihr das Wasser den Rocken fort. Sie getraute sich nicht ohne Rocken nach Hause zu kommen und lief dem Wasser nach, um den Rocken aufzufangen.
So lief sie weit, immer weiter, bis sie zu einem Hause kam. Es dämmerte schon und müde war sie auch. Sie klopfte also und drinnen fragte ein Weib: »Wer ist es?« - »Ein armes Mädchen, welches Euch um Einlass und Nachtherberge bittet.«
Da kam das Weib heraus und sagte: »Ich getraue mich nicht; denn wenn der wilde Mann ('l Salvan) kommt, so schlägt er dich tot.« Aber das Mädchen bat so lange, bis das Weib sie hinein ließ und unter einer Truhe versteckte. Plötzlich kam der wilde Mann und fragte: »Was ist da für ein Gestank von getauftem Fleisch?« Das Weib wollte lange mit der Antwort nicht heraus; zuletzt sprach sie: »Es ist ein armes Mädchen; wenn du mir versprichst ihm nichts zu tun, so will ich dir sagen, wo sie ist.«
Das Mädchen aber kam so gleich unter der Truhe heraus, erzählte ihre Geschichte und der wilde Mann tat ihr nichts zu Leide. Hierauf bediente sie ihn gar sittig beim Abendessen und er war ihr gut. Am Morgen, als sie fort ging, schenkte er ihr ein schönes goldenes Kleid. Voll Freude eilte sie nach Hause.
Als die Mutter das schöne Kleid gesehen hatte, sagte sie zur zweiten Schwester: »Gehe auch du hin und hole dir ein Kleid.« Sie ging in das Haus des wilden Mannes und bediente ihn auch beim Essen, aber sie sagte immer: »Ich will auch ein goldenes Kleid!«
Der wilde Mann aber wurde zornig und warf sie noch in der selben Nacht zum Hause hinaus.
»Allö bone pitscholö la gö va bön ö allö burtö mal.« So heisst es fassanerisch; zu deutsch aber lautet es: »Den guten Mädchen geht es gut und den bösen schlecht.«
Rätoromanien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DER DRACHENTÖDTER ...
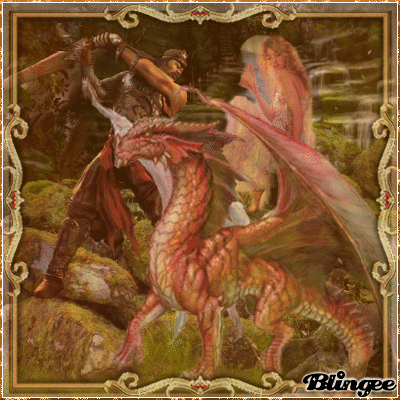
Einst gingen drei junge Ritter auf Abenteuer aus, und ihr erstes Ziel war eine Höhle in tiefem Walde, in der eine wunderschöne Königstochter von drei grausigen Drachen gefangen gehalten wurde. Vor die Öffnung der Höhle gekommen, hieß der jüngste und mutigste der Ritter die anderen ihm ein Seil um den Leib binden und ihn so in die Tiefe hinab lassen. Die Begleiter taten ihm den Willen und versprachen, des Gesellen zu harren, bis er ein Zeichen gebe, um dann ihn und die gerettete Prinzessin wieder an das Tageslicht empor zu ziehen.
Der junge Ritter gelangte glücklich in den innersten Raum der Höhle, wo ein anmutiges Mädchenbild dem nahenden Retter durch Tränen entgegen lächelte. Dann lud sie ihn zum Sitzen ein und flüsterte ihm zu, er möge sein gutes Schwert bereit halten, denn es werden ihre Peiniger bald erscheinen, drei Grausen erregende Drachen, der eine mit einem Kopfe, der zweite mit drei, und der letzte und fürchterlichste gar mit sieben Köpfen.
Und kaum hatte das zarte Königskind also gesprochen, als ein Heulen anhub und eine scheußliche Drachengestalt sich auf den jungen Ritter warf. Aber jener hob das Schwert mit Macht, und es fuhr die Klinge nieder, das Haupt des Drachen zerspaltend. »Nun kommt aber der zweite,« sagte die Jungfrau, »seht Euch vor, mein edler Ritter.« Und ehe sie noch die Worte vollendet, polterte das dreiköpfige Ungetüm heran, noch grausiger anzusehen, als das erlegte, und öffnete die entsetzlichen Rachen, um den Jüngling zu zermalmen. Allein des Ritters Arm war nicht erlahmt, und ein kräftiger Hieb trennte die Häupter vom Rumpfe.
Da bebte die Höhle in ihren tiefsten Gründen, und ein Geheul ging durch die Felsen, wie die Stimme des Donners im Hochgebirge. Das letzte und fürchterlichste Scheusal, jener Schuppen bepanzerte Lindwurm mit sieben Köpfen, stund racheschnaubend vor dem jungen Manne, mit dem Schwanz um sich schlagend, daß die Felstrümmer empor stoben. Der Ritter besann sich indes nicht lange, und tat mit seinem zweischneidigen, mächtigen Schwerte so wackere Arbeit, daß der Lindwurm, einen Strom von dunklem Blut ausgießend, in kurzer Zeit den männlichen Streichen erlag.
Nun sank die Jungfrau, überströmenden Dankes voll, an die Brust des Jünglings, gelobte ihm, als ihrem künftigen Herrn und Gemahl, ewige Treue und gab ihm zum Angebinde ein gülden Ringlein. Deß freute sich der Ritter baß und zog am Seil, den Mitgesellen zum Zeichen, daß die Tat glücklich vollbracht und sie sich bereit machen möchten, die Gerettete und den Retter aus dem grausen Gefängnis ans Tageslicht zu fördern.
Die aber, so oben stunden, waren argen Sinnes und verabredeten unter sich einen schlimmen Plan, um sich den Ruhm des fremden Werkes wohlfeil zu erwerben.
Vom bösen Geist getrieben, zogen sie zwar die Jungfrau empor, ließen dann wohl das Seil zum zweiten Mal herab, scheinbar zur Rettung des Gespielen, im Herzen aber den Vorsatz hegend, den
Unglücklichen auf halbem Wege wieder in die grausige Tiefe stürzen zu lassen.
Ein guter Geist mußte indessen dem jungen Ritter eine warnende Ahnung eingehaucht haben; denn statt sich selbst dem Seile anzuvertrauen, schlang er das selbe um einen Baumstamm und gab neuerdings das Zeichen zum Emporziehen. Die verräterischen Freunde am Rand der Höhle taten, was ihnen ihr arges Herz eingegeben, und ließen die Last zurückfallen, ohne anders den Tod des Mitgesellen erwartend.
Darauf traten sie hin vor die Königstochter, erzählten die erfundene Mähre und forderten jene auf, einen von ihnen zu ihrem Gemahl auszuwählen. Die Prinzessin aber war klugen Sinnes und erbat sich Bedenkzeit auf drei Tage, worauf sie dann alle zur nahen Königsstadt ritten.
Der junge Ritter, der doch das Beste getan, trauerte verlassen in seinem dunklen Schlund. Da erbarmte sich seiner ein alter, grauer Fuchs, und der sprach zu ihm: »Halte dich an meinem Schwanz und folge mir, ich will dich retten, wie du die schöne Jungfrau gerettet hast.« Der Ritter tat, wie ihm geheißen, und sah bald wieder das goldene Licht der Sonne. Der Fuchs aber war plötzlich verschwunden.
Wohlgemut ging der Jüngling fürbaß und kam in die Königsstadt. Dort herrschte große Freude, und als er nach der Ursache frug, erfuhr er, daß die Prinzessin im Begriffe stehe, einem ihrer vermeintlichen Retter die königliche Hand als Gemahlin zu reichen. Da begab sich der Ritter in die Küche des Königspalastes und frug den Koch, ob er ihm nicht Arbeit geben könne. Dieser bejahte es, und so hantierte der junge Mann an einem mächtigen Kuchen für die Königstafel, in den er geschickt das gülden Ringlein der Prinzessin warf.
Das Glück wollte nun, daß gerade die Prinzessin das Stück Kuchen erhielt, welches das Ringlein barg. Darob erstaunte die königliche Jungfrau nicht wenig, und sie hieß den, so den Ring in den Teig getan, im Saal erscheinen. Der Ritter kam, und Entsetzen packte die falschen Gesellen.
Die Prinzessin erhob sich von ihrem Königsstuhl, führte ihren tapferen Retter vor ihren greisen Vater, und der Reichsherold verkündete unter Paukengeschmetter, daß der alte König den Gemahl seiner Tochter zu seinem Nachfolger auserkoren habe. Die zwei verräterischen Freunde aber wurden von vier Pferden in Stücke zerrissen.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden, erzählt in Crestas bei Trons
DER SOHN DER ESELIN ...
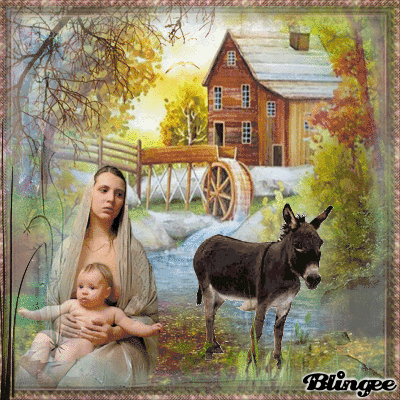
Es war einmal ein Müller, der hatte eine schöne Mühle und ein braves Weib, aber er hatte keine Kinder und dies machte ihm grosses Herzeleid. Oft sagte er zu seinem Weibe: »Wenn uns der Himmel doch ein Kind schickte!« Aber der Himmel schickte ihm wohl viele Kunden und auch manchmal Regen, dass der Bach, welcher die Mühle antrieb, stets Wasser genug hatte, aber von Kindern schien er nichts wissen zu wollen. Doch unverhofft - kommt oft! - sagt ein altes Sprüchlein, an welches der Müller nicht mehr recht glaubte.
Eines Tages blieb seine Mühle plötzlich stehen. Er ging hinaus um nachzusehen, was den Rechen verstopfe und fand einen Korb, welcher auf dem Wasser schwamm. Sogleich zog er den selben heraus und darin lag zu seiner Verwunderung ein kleines Kind, welches heftig zu schreien begann. »Das kommt mir eben recht«, rief der Müller voll Freude, »wir haben keine Kinder und das ist ja ein recht starkes und gesundes Knäblein!«
Er nahm das Kind sogleich heraus und brachte es jubelnd seinem Weibe. Beide hatten die grösste Freude daran und beschlossen es zu behalten und aufzuziehen; weil sie aber keine Amme hatten, so ließen sie es an einer Eselin säugen und nannten es darum »Sohn der Eselin.« Der Knabe wuchs fröhlich heran und wurde mit der Zeit groß und so stark wie ein Stier.
Als er nun groß war, sagte er zum Müller: »Lieber Vater, ich bin nun groß und möchte gern etwas Rechtes lernen, dass ich in die Welt gehen kann, um mein Glück zu suchen.« »Was willst du denn für ein Handwerk lernen?« fragte ihn der Müller. »Ich möchte ein Schmied werden«, lautete die Antwort. Dessen war der Müller wohl zufrieden und gab ihn zu einem Schmied in die Lehre. Da blieb der Junge drei Jahre und wuchs und wurde so stark, dass er die Kraft von sechs Männern bekam.
Als die Lehrzeit aus war, bat er beim Abschied den Meister noch um die Erlaubnis, sich einen eisernen Stock schmieden zu dürfen. Als er die selbe erhalten hatte, schmiedete er den Stock, aber dieser war ihm immer noch nicht schwer genug und er raffte alles Eisen, das er fand, zusammen und verschmiedete es, so dass kaum ein Nagel übrig blieb; der arme Meister machte wohl ein gar trübseliges Gesicht dazu, getraute sich aber kein Wort zu sagen.
So dann nahm er ein großes Leintuch, leerte sechs Staar Türkenmehl hinein, lud es auf und ging damit, den gewaltigen Eisenstock in der Faust, auf die Wanderschaft in die weite Welt.
Zuerst kam der Schmied zu einem kleinen Häuschen, da wohnte eine arme Familie, die bat er um die Erlaubnis sich seine Polenta kochen zu dürfen. Das Weib suchte einen Kessel nach dem anderen her, aber sie waren ihm viel zu klein; da schleppte sie endlich den großen Waschkessel herbei und damit war der Schmied zufrieden, denn er war ihm gerade recht.
Er kochte nun alles Mehl, das er mit sich getragen hatte, und aß, ließ aber doch noch so viel übrig, dass die arme Familie noch lange Zeit zu essen hatte.
Darauf ging er wieder weiter und kam in einen großen finsteren Wald. Darin wohnte ein Riese, der war so stark, dass er zum Zeitvertreib die grössten Bäume samt den Wurzeln ausriss, als wären es
nur zarte Setzlinge.
Der Riese ging auf den Schmied los und sie gerieten bald in Streit, aber der Schmied war nicht faul und schlug den Riesen so wacker auf die Beine, dass er zu Boden fiel. Demütig bat er den Schmied um Verzeihung und dieser sagte: »Steh auf und komm mit mir, wir wollen in die Welt gehen unser Glück zu versuchen; denn wir sind zwei, die keine Furcht haben und ihren Mann suchen!«
Sie gingen mit einander und kamen an einen Ort, wo viele Mühlen standen, die gehörten einem noch grösseren Riesen, der sie alle bloß mit einer Handkurbel leicht in Gang setzte. »Mein Lieber«, sagt« der Schmied, »komm mit uns, wir gehen in die Welt.« »Schon recht, ich komme«, sagte der Riese und so gingen alle drei weiter.
Sie kamen zu einem hohen Berge, da sass ein anderer Riese, welcher einen großen Haufen Nebel in einem Sack hatte. Wenn er regnen lassen wollte, brauchte er nur die Nebel aus dem Sack heraus zu lassen. Der Schmied lud ihn ebenfalls ein mitzukommen und der Riese war es zufrieden.
Sie gingen nun alle vier weit, weit weg, über Berg und Thal, bis sie auf eine große weite Ebene kamen. Es waren dort viele Rinder, welche weideten und nicht weit davon stund eine Hütte. Da sagte der Schmied zum kleinsten Riesen: »Geh hin, hole dir einen Stier und brate ihn dort in der Hütte.«
Der Riese ging, ergriff einen Stier, schlug ihn mit der Faust auf die Nase und tötete ihn; dann trug er ihn in die Hütte, schürte ein Feuer an und briet ihn. Als der Stier schon fast gebraten war, sah der Riese ein kleines altes Männchen mit eisgrauem Bart daher kommen; dieses Männchen hatte eine erschreckliche Kraft und schlug den Riesen so, dass er auf die Erde fiel und ihm Sehen und Hören verging.
Bald kam der Schmied mit den zwei anderen und sie sahen, dass der Riese halb tot war; auch der gebratene Stier war fort. Nach und nach erholte sich der Riese und erzählte ihnen alles. Am zweiten Tage blieb der zweite Riese in der Hütte und briet einen Stier, aber das Männchen kam wieder und schlug ihn, bis er bewusstlos auf dem Boden lag. Am dritten Tage erging es dem dritten und stärksten Riesen auch nicht besser als den beiden ersten.
Am vierten Tage blieb der Schmied in der Hütte und setzte sich mit seinem eisernen Stocke in den Winkel. Plötzlich kam der Alte wieder und ging auf ihn los; aber der Schmied war nicht faul, packte ihn am Bart und warf ihn mit solcher Gewalt an eine Mauer, dass das Blut hoch aufsprizte. Doch war das Männchen nicht tot, sondern machte sich schnell auf und davon; der Schmied aber lief ihm nach und sah gerade noch, wie es bei einem Mausloch hineinschlüpfte und verschwand.
Er fuhr nun mit der Spitze seines Stockes in das Loch und machte es grösser; das Loch wurde unten immer weiter und weiter, so dass sich ein Mann hätte bequem hinab lassen können. Nun rief der Schmied die Riesen, ließ starke Seile holen und ließ zuerst den kleinsten Riesen hinab.
Als dieser ein Stück unten war, schrie er, es sei ihm zu kalt, sie sollten ihn hinauf ziehen. Auch der zweite und der dritte Riese versuchten es, waren aber nicht im Stande die Kälte auszuhalten. Dann befahl der Schmied den Riesen ihn hinab zu lassen und auf ihn zu warten, bis er zurück käme.
Es ging weit hinab, das Loch erweiterte sich immer mehr und endlich war er unten. Da war eine große schöne Ebene, darauf standen drei prächtige Paläste, davon war der erste von Glas, der zweite
von Silber und der dritte von Gold.
Der Schmied ging zuerst in den gläsernen Palast.
Dort kam ihm eine schöne Jungfrau entgegen und sobald sie ihn sah, rief sie: »Ich bitt' Euch, geht fort, denn wenn der Drache kommt, so frisst er Euch!« Der Schmied aber sagte, er habe keine Furcht und wolle da bleiben. Plötzlich kam ein fünfköpfiger Drache und stürzte mit Wutschnauben auf den Schmied los; dieser aber führte mit seinem eisernen Stock einen so wuchtigen Hieb, dass er ihm alle fünf Köpfe zerschmetterte. Darauf schnitt er ihm die Zungen aus und nahm sie zu sich; die Jungfrau aber, welche nun befreit war, führte er zum Orte, wo das Seil nieder hing und rief den Riesen zu, sie sollten sie hinauf ziehen, was sogleich geschah.
Nun ging der Schmied in den silbernen Palast. Dort kam ihm wieder eine Jungfrau entgegen, die noch schöner war als die erste und auch diese rief ihm zu: »Flieht, flieht, ich bitte Euch; denn wenn der Drache kommt, so frisst er Euch!« Der Schmied aber hatte keine Furcht und blieb. Plötzlich kam ein siebenköpfiger Drache, aber mit zwei wuchtigen Streichen zerschlug ihm der Schmied seine sieben Köpfe, schnitt ihnen abermals die Zungen aus und steckte sie zu sich. Die erlöste Jungfrau aber ließ er wieder von den Riesen hinauf ziehen.
Darauf ging der Schmied in den goldenen Palast. An der Pforte stund eine Jungfrau, die war noch viel schöner als die beiden anderen. Auch sie warnte den Schmied vor dem Drachen, aber der selbe blieb und wartete. Da kam der neunköpfige Drache, aber mit einigen schweren Schlägen zerschmetterte ihm der Schmied die neun Köpfe und schnitt ihnen wieder die Zungen aus. Dann führte er die erlöste Jungfrau an den Ort, wo die Seile hingen und rief den Riesen zu, sie sollten zuerst die Jungfrau, dann ihn selbst hinauf ziehen.
Als er halb oben war, schnitten die Riesen treulos die Stricke ab und führten die drei Jungfrauen, welche Königstöchter waren, in die Stadt, um mit ihnen Hochzeit zu halten. Der Schmied aber war gar unsanft zurückgefallen und hatte sich schier weh getan. Zornig ging er auf der Ebene hin und her.
Da erblickte er wieder jenes alte Männchen, fasste es beim Barte und drohte ihm mit dem Tode, wenn es ihm nicht sage, wie er hinaufkommen könne. Da sagte ihm der Alte, er solle einen Adler fangen, deren viel dort auf einem nahen Berge waren, ihn wohl mit Fleisch füttern und sich dann darauf setzen; er solle aber wohl darauf achten, dass ihm das Fleisch nicht ausgehe, bevor er oben sei.
Der Schmied fing nun einen Adler, fütterte ihn und versah sich mit Fleisch; dann setzte er sich auf den Adler und dieser trug ihn hinauf. Als er schon fast oben war, ging ihm das Fleisch aus; aber schnell entschlossen riss sich der Schmied ein Stück Fleisch aus dem Schenkel und gab es dem Adler, welcher ihn nun vollends hinauf trug und absetzte.
Der Schmied ging und kam bald in eine große Stadt; da hörte er, dass heute drei Riesen mit den drei Töchtern des Königs, welche sie befreit hätten, Hochzeit hielten. Voll Zorn ging der Schmied in den Saal, wo das Hochzeitsmal war, sagte dem Könige, dass er seine Töchter erlöst habe und legte zum Beweise die Drachenzungen vor.
Da aber die Riesen nicht gutwillig weichen wollten, sondern sich zusammen taten, um über den Schmied herzufallen, so entstand ein großer Kampf, welcher damit endete, dass der Schmid mit seinem eisernen Stock alle drei Riesen erschlug. Sodann heiratete er die schönste der drei Jungfrauen und hielt gar fröhliche Hochzeit.
Dem Erzähler aber haben sie vom Male nichts gegeben, sondern nur ein großes Bein an den Ellbogen geworfen, dass ihm der Arm davon noch heute wehe tut.
Rätoromanien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DER SCHUSTER ...

Es war einmal ein armer Schuster, der hatte schon viele Jahre in seinem Dorfe gearbeitet, war aber bei allem Fleiße doch noch nie auf einen grünen Zweig gekommen. Darüber missmutig fasste er den herzhaften Entschluss in die Welt zu gehen, um sein Glück zu versuchen. »Wer weiß, ob ich es nicht unvermutet irgendwo finde«, sagte er zu sich selbst; »ich bin dessen so gut würdig, wie die reichen Schelme, denen ich bisher die Stiefel gemacht habe.« Er packte seine Habseligkeiten zusammen und ging, ohne viel Zeit mit Abschiednehmen zu verlieren.
Am dritten Tage abends kam unser Schuster in ein Wirtshaus und fragte den Wirt, ob er zu essen und ein Bett bekommen könne. »Zu essen und zu trinken, so viel Ihr wollt«, sagte der Wirt, »aber beherbergen kann ich Euch nicht, denn ich habe viele Gäste und alle Betten sind vergeben.« »Nun so gebt mir zu essen und zu trinken, das übrige wird sich finden!« sagte der Schuster und er aß und trank, dass es eine Art hatte; denn vom weiten Wege war er hungrig und durstig geworden.
Während des Essens erzählte ihm der Wirt, es sei da in der Nähe ein Schloss, darin ließe sich wohl schlafen; allein so viele dahin gegangen seien, nie sei mehr einer zurück gekommen. Da sagte der Schuster: »Nun wohl, Ihr sollt sehen, ob ich mich getraue, ich will heute in dem Schlosse schlafen!« »Ei, lasst das sein«, sagte der Wirt, »Ihr könnt Euch ja auf das Heu legen oder hier im Tischwinkel bequem machen.«
Aber der Schuster nahm Licht, Leder und Hammer und ließ sich den Weg zum Schlosse zeigen. Als er dort war, zündete er das Licht an, setzte sich in einem großen Zimmer nieder und klopfte darauf los, dass es eine Freude war. Auch sang er ein Liedchen dazu und hatte gar keine Furcht, wie schaurig auch die rostigen Windfähnchen auf dem Dache knarrten.
Als es zwölf Uhr Mitternacht war, kamen zwei Riesen, packten den Schuster und schlugen ihn, der Schuster aber sagte kein Wort, so weh ihm die Schläge auch taten und dies war sein Glück, denn sonst wäre er verloren gewesen. Die Riesen misshandelten ihn bis zum Gebetläuten; dann gingen sie fort und ließen ihn wie tot auf dem Boden liegen.
Endlich kam er wieder zu sich, aber er fühlte so große Schmerzen, dass er anfangs meinte, alle Glieder an seinem Leibe seien gebrochen; doch nach und nach gelang es ihm sich wieder aufzurichten und zum Fenster hinzuschleppen. Er sah in den Garten hinab; da war in der Mitte ein Brunnen und aus dem selben blickte der Kopf eines wunderschönen Mädchens, welches ihm freundlich zuwinkte.
Mit vieler Mühe ging er in den Garten hinab; da erzählte ihm das Mädchen, sie sei eine verzauberte Königstochter und harre auf einen Retter. »Weil du in der letzten Nacht so mutig ausgehalten hast«, sagte sie, »bin ich jetzt schon bis an die Schultern über dem Wasser und wenn du nur noch zwei Nächte duldest, so bin ich befreit und will deine Gemahlin werden und dich reich und angesehen machen mehr als du nur je geträumt hast. Geh wieder hinauf, da und da ist eine Salbe, damit salbe dich.« Und er ging hinauf, salbte sich und war heil und gesund.
Dann ging er wieder in den Garten und redete und koste den ganzen Tag mit der schönen Prinzessin. Beim Einbruch der Nacht machte er sich bereit wieder Schläge zu empfangen. Als es zwölf Uhr war, da kamen vier Riesen und schlugen ihn noch ärger als die vorige Nacht. Aber wenn es ihm recht wehe tat, so dachte er an die schöne Prinzessin und an sein künftiges Glück und hielt stumm alles aus. Als die Riesen fort waren, raffte er sich langsam auf, salbte sich und war wieder frisch und stark, als wäre ihm nichts zu Leid widerfahren. Dann ging er in den Garten und blieb den ganzen Tag bei der Königstochter, welche heute schon bis zu den Knien aus dem Wasser war.
In der dritten Nacht kamen acht Riesen, die schlugen ihn wieder, dass er unsägliche Schmerzen litt; aber er hielt stumm alles aus. Zuletzt warfen sie ihn in ein Loch voll Messer und gingen fort. Er war am ganzen Leibe zerstochen und blutig und nur mit der grössten Anstrengung vermochte er sich aufzuraffen und an den Ort zu schleppen, wo die Salbe war. Als er sich gesalbt hatte, war er wieder heil und gesund und ging in den Garten hinab. Dort kam ihm die Prinzessin schon entgegen und dankte ihm; dann holten sie Wagen und Pferde und fuhren in die Stadt, um lustige Hochzeit zu halten.
Da sassen sie alle bei einem großen Male und warfen mir ein Bein an den Ellbogen, dass mir der Arm davon noch jetzt weh tut.
Rätoromanien: Christian Schneller: Märchen und Sagen aus Wälschtirol
DER RABE ...
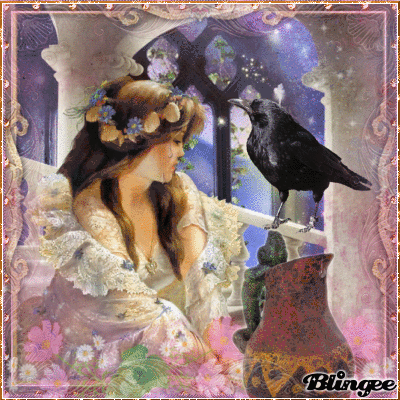
Es war einmal ein Graf von uralter Herkunft, aber von gar geringem Vermögen. Dieser ging eines Tages, über die Zukunft seines einzigen, holdseligen Töchterleins sinnend, durch den Wald. Da rief ihm von einer Eiche herab eine krächzende Stimme zu, einen Augenblick zu verweilen. Der gute Graf schaute empor und erblickte einen Raben mit glänzendem Gefieder.
Dieser sprach zum Grafen: »So du mir dein Töchterlein zur Frau gibst, erhältst du des Goldes die Fülle.« Dessen war der Graf wohl zufrieden, ging heim und führte die Tochter zum befiederten Bräutigam, der sagte zu ihr: »Schöne Jungfrau, geht mit mir in die Kapelle meines Schlosses, kniet hin vor dem Altar einen ganzen Tag, füllt den bereit stehenden Krug mit Euren Tränen und begießt, wenn ich am Abend heimkomme, damit mein Gefieder. Tut Ihr solches, ohne den Inhalt des Kruges zu verschütten, so hat die böse Hexe, die mich in einen Raben verwandelte, keine Macht mehr über mich und vor Euch wird stehen ein junger, schmucker Ritter.« Sprachs und flog von dannen, der Jungfrau durch das Dickicht den Weg zu einem fernen, prächtigen Schloß zeigend.
In der Kapelle angelangt, kniete des Grafen Töchterlein hin und tat, wie ihr geheißen worden. Als sie aber am Abend mit dem vollen Tränenkrug in den Hof treten wollte, um des Raben zu harren, tat sie einen falschen Schritt und verschüttete einen Teil des kostbaren Inhaltes. Da schwebte der Rabe herbei und sagte, daß er mit nichten erlöst sei, und die Jungfrau ihr frommes Werk von Neuem beginnen müsse.
Und die Rabenbraut erhob sich früh Morgens vom Lager und hatte mit dem sinkenden Abend das Krüglein mit ihren Tränen wieder gefüllt. Aber auch diesmal ging es ohne ein paar verschüttete Tropfen nicht ab, und abermals kam der Rabe herbei geflogen und ermahnte gar rührend die Weinende, doch am dritten Tag des Inhaltes zu achten, weil er sonst noch hundert Jahre als Rabe verzaubert durch die Wälder fliegen müsse.
Und das Mägdlein nahm sich die guten Worte mehr als je zu Herzen, weinte bitterlich den dritten Tag hindurch, und als der dritte Abend heraufgedämmert kam, richtete sie ein kräftig Gebet zum Himmel empor und gelangte bebenden Herzens aber sichern Schrittes ohne Unfall auf den Schloßhof, wo der Rabe ihrer wartete.
Dann goß sie den Inhalt des Kruges auf das glänzende Gefieder des Vogels, und vor der errötenden Jungfrau stand auf einmal ein herrlicher Ritter, welcher ihr für seine Befreiung mit warmen Worten dankte, der künftigen Herrin die im Schlosse aufgehäuften Schätze an Gold und Edelsteinen zeigte und sie dann mit prunkendem Gefolge in die halb zerfallene Burg ihres Vaters geleitete, wo eine prachtvolle Hochzeit gefeiert wurde.
Dann kehrten sie alle in das große Schloß des jungen Fürsten zurück, um dort für viele, viele Jahre in ungetrübter Freude zu leben.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden, erzählt in Crestas bei Trons
VOM VÖGLEIN, DAS DIE WAHRHEIT ERZÄHLT ...
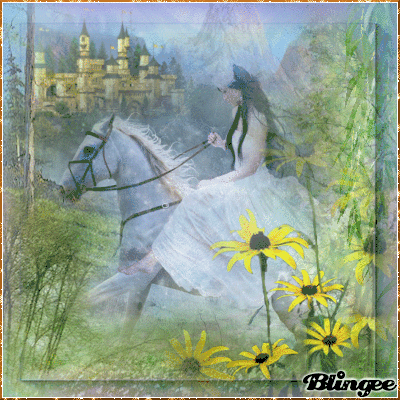
Erwacht an einem schönen Morgen ein reicher Müller ob dem Stillstehen des großen Mühlrades. Der brave Mann eilt hinab in den Mühlraum, um nach der Ursache der Störung zu sehen. Da findet er auf dem großen Rade eine schön gezimmerte Kiste und in der selben drei wunderhübsche Kindlein, zwei Knaben und ein Mädchen. Die selben trugen goldenes Haar und ein gülden Sternlein auf der heiteren Stirn. Der Müller rief seine Frau herbei, die bei dem seltenen Anblick die Hände vor Verwunderung über den Kopf zusammenschlug, und da die beiden Leutchen ohne Kinder waren, beschlossen sie, die fremden als ihre eigenen zu pflegen und zu erziehen. So verging manches Jahr des Friedens, und die Kleinen wuchsen fröhlich und kräftig heran zur großen Freude der guten Pflegeeltern.
Als aber die Knaben ins zwanzigste Jahr kamen, da glaubte der Müller ihnen die volle Wahrheit sagen zu müssen, und er erzählte ihnen, wie er sie gefunden und daß sie nicht ihre, der Müllersleute, eigene Kinder seien. Die Geschwister verlangten aber zu wissen, von wannen sie kämen und wer ihnen Vater und Mutter sei, und sie bedrängten mit ihren Fragen den gutmütigen Alten gar sehr, der ihnen endlich sagte, sie sollten die Burg aufsuchen, wo das Vöglein sei, das die Wahrheit erzähle; dort würden sie die gewünschte Auskunft erlangen.
Und als der frühe Morgen kam, ritt der jüngere der beiden Knaben, ungeachtet aller Bitten und Tränen der Pflegeeltern, auf des Müllers stattlichem Rappen von dannen. Als aber Wochen und Monate vergingen, ohne daß eine Nachricht kam, da weinten die Mühlenbewohner gar heiße Tränen, und es zog an einem frühen Herbstmorgen, von den besten Segenswünschen begleitet, auf einem stolzen Braunen reitend, der ältere Bruder aus, um den Verlorenen und das wunderbare Vöglein aufzusuchen.
Es verging der Herbst, es kam der Winter, und wieder wurde es Frühling, aber von den Fernen kam keine Nachricht in die stille Bergmühle. Nun hielt sich das zur Jungfrau emporgeblühte Schwesterlein, welches sich die schönen Augen um die verschollenen Brüder schier ausgeweint hatte, nicht länger, und sie bat um das schneeweiße Pferd des Müllers, um das Brüderpaar aufzusuchen. Vergebens flehte der alternde Müller, vergebens rang die gute Müllerin die Hände, um den Liebling zurückzuhalten; eines Morgens war die treue Schwester in die Ferne geritten.
Der Weg führte sie über Wiesen und Felder, und als sie durch einen langen, finsteren Wald trabte, kam ihr von ungefähr ein altes Weib entgegen und sagte zur Jungfrau, es wisse wohl, wen sie suche; auch ihre Brüder seien des gleichen Weges gegangen, um das Vöglein zu suchen, das die Wahrheit spreche und welches zu finden sei in einem funkelnden Schlosse auf dem steilen Hügel neben dem Bergsee. Allein die Brüder und mit ihnen Tausende und abermals Tausende von Rittern und Edelfräulein seien niemals zurückgekehrt, weil sie der Warnungen nicht geachtet hatten.
»Schöne Jungfrau,« schloß die Alte, »wollt Ihr glücklich das Werk vollbringen und die Retterin der Verzauberten im Bergschloß werden, so geht Euren Weg und schaut Euch nicht um, was auch hinter Euch gerufen werden mag, denn wendet Ihr nach rückwärts Euer Antlitz, so werdet Ihr in einen Stein verwandelt.« Die Jungfrau dankte und ritt weiter.
Es ging nicht gar lange, so kam sie an den Fuß eines steilen Berges, wo sie ihr Pferd zurücklassen mußte. Mutig stieg sie den stotzigen Pfad hinan, vor ihr auf stolzer Höhe das prächtige Zauberschloß. Da erhob sich hinter ihr ein Donner wie die Brandung des Meeres, und es wurde ihr Name gerufen von unzähligen schmeichelnden und drohenden Stimmen. Aber die Mutige schaute nicht zurück und stieg fürbaß weiter, bis sie an das Schloßtor gelangte, wo ein entsetzlicher Riese mit mächtiger Tanne in der Hand ihr den Weg versperren wollte. Aber die Jungfrau schlüpfte behend durch und entkam glücklich in das Innere des Schlosses.
Durch die leeren Prunkgemächer irrend, führte sie ihr gutes Geschick in einen großen Saal, wo unzählige, reich befiederte Vögel in goldenen und silbernen Käfigen im wunderlichsten und doch verständlichen Kauderwelsch ihr zu schrien, sie allein könnten die Wahrheit offenbaren. Nur in einer Ecke lag ein graues unscheinbares Vöglein in einfachem Zwinger und schwieg, die fremde Jungfrau mit seinen klugen Äuglein anschauend. An dieses wandte sich die fast Zagende, und sie erfuhr von ihm, daß es selbst allerdings der Vogel sei, der die Wahrheit offenbare und sie ihm nun zu folgen habe.
Dann gingen die beiden in den Garten; auf das Geheiß des Vogels hob die Jungfrau hart am Rand eines Springbrunnens eine Rute empor, mit der sie die Steinblöcke im Garten und auf dem Berge berührte. Und siehe, kaum war das Geheißene getan, daß der Zauber wich und lebenswarme Menschen in glänzendster Hoftracht, Ritter und Damen, fröhlich die Jungfrau umstanden, in unmittelbarer Nähe aber die beiden heißgeliebten Brüder, welche die treue Schwester schluchzend umhalsten. Und vom nächsten Baum herab sang in wunderbaren Tönen das graue Vögelein die Geschichte der Geschwister: sie seien Königskinder, aber während der Abwesenheit des Vaters habe ein böser Ohm, der nach der Herrschaft trachtete, sie ausgesetzt und dem vom Kriege zurück kehrenden König die Mähre vorgelogen, es habe die Königin selbst drei Katzen geboren, weshalb sie im Gefängniß schmachte.
Empört ob der grauenhaften Tat des schlimmen Oheims schworen die Brüder Rache und Sühnung für die arme Mutter, und sie brachen auf, von einem glänzenden Gefolge umringt, der Königsstadt entgegen, die Schwester voran, von den edelsten Jungfrauen geleitet. Und als sie vor das Königsschloß traten, da fanden sie, auf marmornem Stuhle sitzend, den noch stattlichen, aber kummervollen Vater und neben ihm, wie eine zischende Schlange, den aalglatten Ohm.
Das Erkennen war das freudigste, und am anderen Tage saß der König und sein befreites Gemahl auf dem Throne, neben ihnen die wiedergefundenen Kinder und das herbei geholte schlichte Müllerpaar, weinend vor Lust und Freude und jubelnd begrüßt vom ganzen Hofe. Die kühne Tochter aber ist eine große Königin geworden, und die beiden Brüder, gewaltige Helden, teilten sich nach dem Tode der Eltern das Reich und herrschten lange und glücklich. -
Den Ohm erreichte das verdiente Schicksal: er starb am Tage nach dem Wiederfinden durch Henkershand.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volksthümliches aus Graubünden, erzählt in Camplium bei Trons
VON DEN DREI BRÜDERN ...
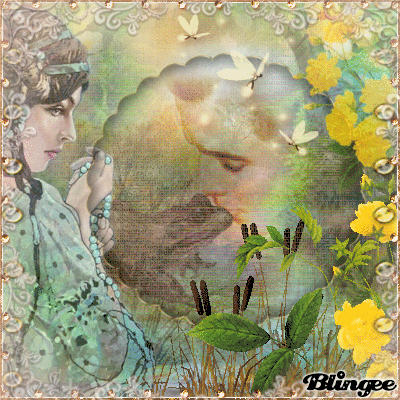
Vor vielen, vielen Jahren lebte ein König, dessen Reich sich bis an das Meer erstreckte. Als er alt und schwach und des Regierens müde wurde, da ließ er seine drei Söhne kommen und sagte ihnen, er werde demjenigen das Reich übergeben, welcher hinausgehe und binnen drei Tagen den schönsten und besten Wagen anfertige. Von den drei Söhnen aber galten die zwei ältesten für gar begabt, während man auf den jüngsten nicht gar viel hielt.
Nun begaben sich die Drei hinaus vor die Stadt, wo die zwei Älteren den Jüngsten allein seines Weges ziehen ließen. Dieser trat in den nahen Wald und kam immer tiefer und tiefer in das Dickicht, wo er an einem Baum ermattet nieder sank und dann Brot und Käse hervorholte, um sich zu erlaben. Da kam ein alter, grauer Mann, in einem weiten Mantel des Weges gegangen und bat den Königssohn um einen Imbiß. Der Jüngling gab dem Manne gerne, was er hatte und sah freudig zu, wie die rauhe Kost dem Alten schmeckte.
Als dieser sich satt gegessen hatte, sprach er zum Königssohn: »Ich kenne deine Not, und ich will dir helfen. Lege dich inzwischen hin und schlafe, bis ich dich wecke.« Der junge Mann schlief lange, und als er erwachte, war der Alte verschwunden; vor ihm aber stand der bequemste und prächtigste Wagen, den man sich nur denken kann. Diesen zog er nun in die Stadt und trat damit vor den König; vor dessen Thron aber standen die zwei anderen Brüder, die aber kaum ein Rad, geschweige denn den ganzen Wagen verfertigt hatten.
Der Vater aber lobte den Dummen gar sehr und wollte ihm das Reich zuerkennen; allein die beiden anderen Söhne baten und flehten so lange, bis der alte König eine zweite Probe erlaubte und jedem der Söhne einen Hanfstrang überreichte mit der Meldung, daß derjenige das Reich erhalten werde, welcher dem Hanf das feinste Gespinn abgewinne. Wieder gingen die drei Brüder hinaus, dieses Mal jeder seines Weges.
Der Jüngste ging wieder in den Wald, war aber gar betrübt und setzte sich an einen Teich nieder, um sich auszuweinen. Da kam ein Fröschlein aus dem Wasser gehüpft und frug ihn nach der Ursache seines Kummers. So das Fröschlein die Leidensgeschichte des Prinzen erfahren hatte, hieß es ihn guten Mutes sein und den Hanfstrang frisch in den Teich werfen. Das tat der Königssohn, worauf ihn der Schlaf übermannte.
Nach vielen, vielen Stunden wachte er auf, rieb sich die Augen und war nicht wenig erstaunt, als er das wundersamste goldene Gespinnst sah, das man sich nur denken kann. Dieses nahm der Königssohn und ging in das Haus seines Vaters. Seine Brüder hatten zwar auch hübschen Faden gebracht, aber mit dem goldenen des Jüngsten war er gar nicht zu vergleichen. Wieder wollte der Vater diesem den Preis zuerkennen, und wieder gab er den Bitten der älteren Brüder nach, doch eine dritte und letzte Probe zu erlauben.
Da schwur der alte König bei seinem Barte, daß derjenige seiner drei Söhne das Reich erben sollte, der ihm die schönste Schwiegertochter zuführte. Mit diesem Bescheid gingen die Prinzen gleichzeitig aus drei verschiedenen Toren zur Stadt hinaus auf das Feld. Der Jüngste besann sich nicht lange und schritt rüstig dem Walde und dem Teiche zu.
Dort angelangt, rief er nach dem Fröschlein, welches also bald kam und nach seinem Begehren frug. Der Prinz teilte sein Anliegen mit, worauf das Fröschlein sagte: »Küsse mich auf das Mäulchen und vertraue mir.« Der Knabe tat, wie ihm befohlen, und ehe er sich versah, hatte sich das Fröschlein in die schönste, minnigste Maid verwandelt. Mit dieser zog er zu Hofe, und weil seine Braut die der Brüder an Schönheit weit übertraf, erhielt er des Vaters Reich und lebte mit seiner Frau herrlich und in Freuden.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden, erzählt in Chiltgiadira bei Trons
DER BÄRENSOHN ...

Es gingen einmal ein Bauer und seine Frau auf das Feld, um das Heu zu sammeln. Am Rande des Waldes legte die Frau ein Körbchen nieder, in welchem ein gesundes Knäblein schlief, und ging ihrer Arbeit nach. Als es gegen Abend ging, kam die Mutter wieder und wollte ihr Kind holen; aber es war nirgends zu finden. In der Angst ihres Herzens lief die arme Frau zu ihrem Manne und erzählte ihm, was geschehen. Der Bauer aber sprach ganz ruhig: »Den Buben hat der Bär geholt, den finden wir nimmer.« Die Beiden suchten zwar den Wald die Kreuz und die Quere aus, aber ohne Erfolg und sie gingen betrübt nach Hause.
Das Knäbchen hatte aber wirklich der Bär geholt, oder vielmehr die Bärin, die den armen Wurm sorgfältig säugte und pflegte. Nach fünf Jahren führte die Bärenmutter den Knaben zu einer mächtigen Tanne und hieß ihn den Baum aus der Erde herausreißen. Das ging aber über die Kräfte des Buben, der wieder der Bärin folgen mußte, die ihn neuerdings säugte und pflegte. Als abermals fünf Jahre verflossen waren, sollte der Knabe wieder die Tanne entwurzeln; allein es ging wieder nicht. Als er aber zwanzig Jahre alt wurde, da riß der Bärensohn die stärkste Waldtanne, als wenn sie ein Strohhalm wäre, samt den Wurzeln aus dem Boden heraus. Da lachte die Bärin, daß es im Forste wiederhallte und sagte zu dem Knaben, er möchte jetzt nach Hause gehen und seine Eltern aufsuchen. Das tat der junge Mann.
Im Vaterhaus angekommen, frug er die Mutter, die am Herde saß und ihn nicht erkannte, ob sie nicht etwas habe, um seinen Hunger zu stillen. Auf die bejahende Antwort ging der Starke in die Brotkammer und verzehrte den ganzen reichen Brotvorrath. Um seinen Durst zu löschen, stieg er hinab in den Keller, faßte das größte Stückfaß mit den Händen, brachte das Spundloch an den Mund und leerte den gewaltigen Inhalt in Einem Zuge aus.
Darob erschrak die gute Frau und gab dem Manne zu verstehen, daß sie einen solchen Gast nicht im Hause brauchen könne. Da schwoll dem jungen Manne die Zornader an der Stirne; er stieg hinauf auf die höchsten Berggipfel und kam mit Gämsen schwer beladen in die Hütte seiner Eltern zurück. Das sei der Lohn für das Empfangene, sprach der Unheimliche und ging grollend von dannen, ohne sich zu erkennen zu geben.
In einem fernen Lande verdingte er sich als Knecht und verlangte von seinem Herrn keinen anderen Lohn als den, nach abgelaufenem Dienstjahre dem Brotherrn Streiche versetzen zu dürfen. Damit war der reiche Bauer wohl zufrieden, denn er kannte die Stärke seines neuen Knechtes nicht. Als er aber sah, wie sein Dienstmann mit einem einzigen Faustschlag den stärksten Ochsen niederwarf, da faßte ihn ein geheimer Schauer, und er beschloss bei sich selbst, den Knecht mit übermenschlichen Arbeiten zu erdrücken.
So sandte der Bauer den Bärensohn in die Hölle, um dort gemahlenes Mehl in Empfang zu nehmen, und gab ihm eine ganze Ladung Säcke mit. Der Knecht aber lachte höhnisch auf, schlug zwei Ochsen nieder, zog ihnen die Haut ab, nähte sie zusammen und stieg getrost hinab in den Höllenschlund. Dort stieß er auf eine Schaar von gehörnten Unholden und brachte diesen sein Anliegen vor. Da lachten die Teufel ob dem dummen Gesellen und sagten ihm, sie hätten kein Mehl bereit für seinen Herrn. Aber der Starke verstand keinen Spaß und ließ seine Faust so lange auf die Schädel der Teufel niederfallen, bis sie ihm das Gewünschte herbeiholten. Damit belastet, kam er zu seinem Herrn zurück und gab ihm den Rat, für die Zukunft sich eine bequemere Mühle aufzusuchen.
Dem Dienstherrn ward es dabei immer unheimlicher, und er schickte den Knecht zum zweiten male in die Hölle, um vom Belzebub die Zinsen seiner Kapitalien zu erheben, in der Hoffnung, auf diesem
Wege vom Bärensohn auf immer befreit zu werden. Er aber ging und kam mit dem Geld, und da das Dienstjahr just herum war, versetzte er dem Bauer einen Stoß, daß der sieben Meilen weit weg
flog.
Das ist die Geschichte vom Bärensohn.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden, erzählt in Campodials bei Somvix
VOM MÄGDLEIN OHNE ARME ...
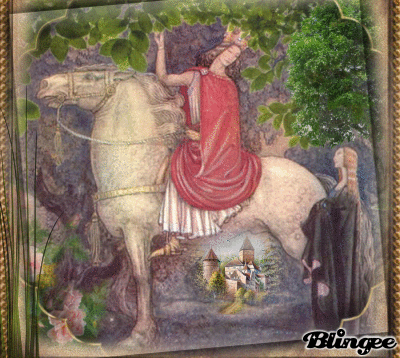
In einem kleinen Häuschen vor dem Dorfe lebte einst ein bitterarmes Ehepaar, welches sich und das einzige Töchterlein kaum zu ernähren vermochte. Als gerade die Not am größten war, kam eines Tages ein fremder Herr in einem grünen Rocke in die Hütte und sagte den guten Leuten, er wolle für das Töchterlein sorgen, wenn die Eltern ihm das selbe nach 12 Jahren zu eigen geben wollten. Diesen Vorschlag nahm der Vater gerne an und schmunzelte zufrieden, als der Fremde ihm einen Beutel voll Gold mit den Worten überreichte, es werde sich der selbe nach Wunsch immer wieder füllen. In dem Augenblicke aber, wo der fremde Mann die Stube verließ, gewahrte der Vater mit Entsetzen, daß Jener Pferdefüße hatte, und er wußte nun, daß er seine Tochter dem Teufel verschrieben hatte.
Inzwischen wuchs das Töchterlein fröhlich heran, des schlimmen Schicksals unbewußt. Und nach 12 Jahren kam der Grüne von damals und forderte die Tochter. Als das unschuldige Mägdlein aber zu ihm hin trat, merkte er wohl, daß es sich gewaschen und bekreuzt hatte, so daß er ihm nichts anhaben konnte, weswegen er zum Vater sagte, er solle, ehe das Kind sich waschen und bekreuzen könne, ihm beide Arme abschlagen und es an einen Baum im Walde binden. Am anderen Morgen aber stund die Tochter noch vor Sonnenaufgang auf und wusch und bekreuzte sich nach alter, frommer Sitte.
Der Vater, von Habsucht geplagt, tat inzwischen, was ihn der Grüne geheißen und führte das arme, verstümmelte Kind hinaus in den Wald. Der Teufel kam, aber er hatte wieder keine Gewalt über sein Opfer. Die Jungfrau wäre indessen elendiglich verschmachtet, wenn nicht ein Königssohn des Weges geritten wäre und sich der frommen Jungfrau ob ihrer wunderbaren Schönheit erbarmt hätte. Er löste ihre Bande, setzte sie auf sein Roß und ritt mit ihr in das Schloß seines Vaters. Da dieser just den einzigen Sohn gerne vermählt gesehen hätte, dieser aber die fremde Jungfrau ohne Arme zur Frau wollte, so willigte der gute alte König, von der Anmut der Fremden bezaubert, ein, und so ward die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert worden.
Das junge Paar lebte glückliche Tage, bis der Königssohn in den Krieg ziehen mußte. Nach einigen Wochen ritt indessen ein Edelknabe aus dem Tore des Königsschlosses dem Lager zu mit der frohen Mähre, daß die junge Fürstin eines Zwillingspaares genesen sei. Im Walde begegnete dem Boten eine Hexe, die mit ihren bösen Blicken das Schreiben verzauberte, so daß der Prinz mit Entsetzen die Mähre zu lesen bekam, daß ihm seine Frau zwei Katzen geboren habe. Ergrimmt gab er den Befehl, die Fürstin mit ihrer Mißgeburt in den Wald hinauszustoßen. Mit Kopfschütteln vernahm man im Königsschlosse den seltsamen Befehl, aber Niemand wagte eine Einrede, und so ward die arme Fürstin mit ihren Kindern in die Wildnis hinaus gestoßen.
Lange irrte sie weinend umher, bis sie zu einem Brunnen kam, wo sie ihren Durst löschen wollte. Da fiel das eine Kind plötzlich ins Wasser, die Mutter griff mit den Armstumpfen darnach und holte das Kind wieder heraus. Die Arme waren ihr wieder gewachsen, das hatte der Zauberquell getan. Glückselig ob der Heilung schaute die Fürstin empor zum Himmel, und die Augen wieder zur Erde wendend, erblickte sie in nächster Nähe ein prachtvolles Schloß mit hell glänzenden Fenstern.
Sie trat mit ihren Kindern in die Hallen und fand, was nur das Herz begehren kann, nur keine Menschen, d.h. sie ward von unsichtbaren Händen bedient, wie es einer Königstochter ziemt. Hier lebte sie sieben Jahre lang, täglich des Gemahles harrend. Dieser war inzwischen vom siegreich bestandenen Kriege zurückgekehrt, und als er die Wahrheit vernommen, mit seinen Rittern in die weite Welt gezogen, um die so ungerecht bestrafte und heißgeliebte Gemahlin aufzusuchen.
Nach langem Irren kam er endlich allein in den Zauberwald und fand sein Weib und seine Kinder wieder. Er stieß ins Horn, daß es, weithin schallend, sein glänzendes Rittergefolge herbei rief, welches der wiedergefundenen Herrin huldigte. Dann verließen alle in fröhlichster Stimmung die stille Stätte.
Als aber die Fürstin mit dankendem Blicke noch einmal zurückschaute, war das Zauberschloß verschwunden, und es stand an seiner Stelle eine Dornenhecke.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden, erzählt in Rinkenberg bei Trons
DAS KATZENSCHLOSS ...
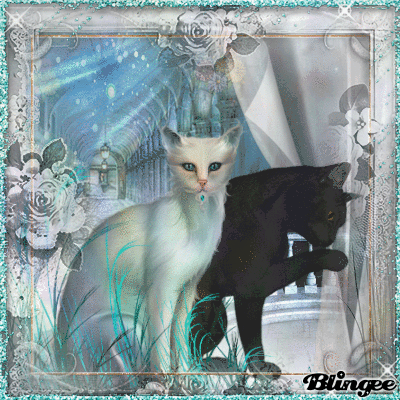
An einem Sommerabend ritt ein Rittersmann durch einen Wald. Im tiefsten Dickicht war er vom Pferde gestiegen, um an einer rauschenden Quelle zu rasten. Da stund plötzlich vor ihm ein Schwarm grauer Katzen. Das wunderliche Volk miaute und schrie, und wies nach einem halb verborgenen Pfade, daß der Ritter, sein Roß führend, folgen mußte.
Voran hüpften und tanzten und sprangen die grauen Tiere, den Weg zeigend und dem ernsten Manne ein leises Lächeln entlockend. Die sonderbaren Wegweiser gingen und hüpften durch Gestrüpp und Gesträuch, bis Ritter, Roß und Katzen vor ein schimmerndes Schloß auf grünem Hügel kamen. Mit lächerlichen Gebärden hieß der Katzentroß den fremden Mann in die weiten Hallen treten. Dieser band sein Pferd an eine Säule von Marmelstein und gelangte, stets von Katzen geleitet, in einen hohen Saal, wo auf prächtigem Throne zwei wunderschöne Katzen lagen, eine weiße und eine schwarze, welchen die übrigen Tiere mit den Zeichen unverkennbarer Huldigung nahten.
Der Ritter wollte die seltsamen Inhaber des Schlosses anreden; denn er merkte wohl, daß hier etwas Besonderes vorging; allein ehe er sich versah, befand er sich in einem anderen prunkvollen Gemach, wo ein auserlesenes Nachtessen seiner harrte. Er aß und trank sich an den herrlichen Speisen und an den dunkelroten und gold hellen Weinen satt und suchte Ruhe auf einem seidenen Bette im nahen Prunkzimmer, wo er bald den Schlaf des Gerechten schlief.
Es ging aber nicht lange, da zupfte etwas an der seidenen Decke, und als der Ritter wach wurde, sprach die schwarze Katze zu ihm folgendermaßen: »Vor einigen Jahren war ich ein mächtiger Fürst, die weiße Katze meine Tochter und die grauen Katzen mein Hof. Da kam ein böser Zauberer, dem ich nicht zu Willen gewesen, und der verwandelte uns alle in Katzen. So Ihr aber den Mut habt, diese Nacht auf jenen Hügel zu steigen, wo die drei goldenen Kreuze blinken, die Zauberwurzel am Fuße des mittleren Kreuzes herunter zu holen und mich und meine Tochter und mein Gesinde damit zu berühren, so werdet Ihr uns alle befreien, und Ihr sollt meine Tochter zur Frau haben und mit ihr herrschen über mein Volk. Vor Gefahren aber warne ich Euch.«
Der Ritter besann sich nicht lange, griff nach seinem Schwert und zog voll Gottvertrauen hinaus in die dunkle Nacht. Als er aber den Berg zu besteigen begann, da hub ein Geheul an, wie wenn die Hölle ihre Tore auf täte; es sauste und krachte durch die Lüfte, aus den Ritzen stiegen Schreckensgestalten empor, Blitze schlugen nieder; aber der Ritter verfolgte unbekümmert seinen Weg. Er erreichte die Höhe, wo die drei Kreuze stunden und brach mit mutiger Hand die Zauberwurzel, während der Berg in seinen tiefsten Tiefen erbebte.
Als er wieder zum Tal stieg, war alle Spuck verschwunden, und vor dem Tore des Schlosses harrte seiner der Katzenfürst und seine Vasallen. Diese berührte er mit der Zauberwurzel, und im nämlichen Augenblicke strömte ein Lichtmeer durch den Palast, einen prachtvollen Hofstaat beleuchtend, auf dem Throne einen königlichen Greis, neben ihm die anmutigste Prinzessin und im weiten Kreise Ritter und Edeldamen in reichster Hoftracht.
Da winkte der König dem Ritter heran, legte die Hand der erglühenden Tochter in die seinige, und der Festlichkeiten war kein Ende.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden, erzählt in Darvella bei Trons
BOHNE, BOHNE, ICH SCHNEIDE DICH! ...
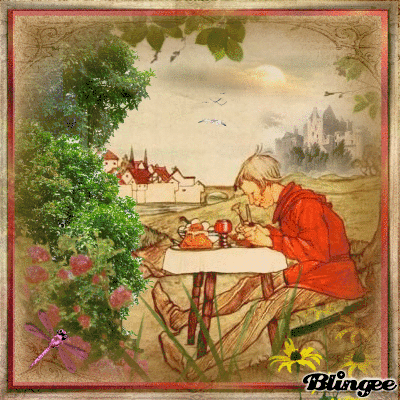
Drei Brüder, armer Leute Kinder, gingen in die Fremde, um sich ihr Brot zu verdienen. Als sie in einen Wald kamen, wo sich drei Wege schieden, da gingen die zwei älteren Brüder gen Norden, der jüngste aber gen Osten. Vorher hatten sie drei Kreuze in eine Eiche geschnitten und sich gelobt, nach Jahresfrist wieder am nämlichen Orte zusammen zu kommen.
Der jüngste der Brüder kam immer tiefer in den Wald und kam zu einer Hütte, wo eine alte Frau war. Diese frug er, ob sie nicht Arbeit für ihn habe, und als diese es bejahte, blieb er. Seine Arbeit bestand aber darin, daß er zwei graue Katzen und zwei weiße Enten zu füttern hatte. Als das Jahr herum war, erinnerte sich der Jüngling seines Versprechens und verlangte von der alten Frau seinen Lohn. Diese gab ihm eine Bohne und entließ ihn.
Dem Jüngling dünkte die Gabe wohl gering, aber er murrte nicht und ging vergnügt von dannen. Auf dem Wege überkam ihn einmal die Lust, die Bohne zu zerschneiden, und schon wollte er sein Vorhaben mit den Worten ausführen: »Bohne, Bohne, ich schneide dich,« als die Bohne gar rührend zu bitten anfing: »Lieber Knabe, schneide mich nicht, ich will tun, was du verlangst.«
Das ließ sich der Knabe nicht zweimal sagen und wünschte sich ein Tischtuch, das die besten Speisen hervorbringe. Und kaum gesagt, so war es auch getan. Ein Tisch stund vor ihm, darüber gebreitet ein Tischtuch und darauf die besten Speisen: Schinken, gedörrtes Fleisch, Rahm, Reis, Kastanien, vor allem aber in geschliffenen Flaschen der rote Veltliner.
Zufrieden, wie ein König, kam der Jüngling an den verabredeten Ort, wo die anderen Brüder schon seiner harrten. Diese hatten sich in der Fremde ein schönes Stück Geld verdient und frugen nun den Jüngsten, was er nach Hause bringe. Dieser zeigte seine Bohne, worüber die Brüder ein unmäßiges Gelächter anhuben.
Da sprach aber der Jüngling: »Tischlein, decke dich,« und das Tischlein deckte sich, daß es sich unter der Last der Speisen und Getränke bog. Das Experiment gefiel den Brüdern gar wohl, und sie aßen und tranken weidlich, meinten aber, daß man mit Essen und Trinken allein nicht leben könne.
Da sagte der Bursche zu seiner Bohne: »Bohne, Bohne, ich schneide dich.« Die Bohne aber bat wieder gar rührend und versprach zu tun, was er verlange. Und der Knabe wünschte sich einen Esel, der Gold von sich gebe. Und was er gewünscht, das war im Nu geschehen. Das erregte der Brüder Neid; sie wollten auch ihr Glück bei der Bohne versuchen und sagten das Sprüchlein her; aber es half ihnen nichts, die Bohne blieb stumm.
Da schlossen sie mit dem jüngsten Bruder Frieden und gingen mit Tischtuch und Esel zusammen nach Hause zu den armen, alten Eltern und wurden reiche Leute.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden, erzählt in Dardin bei Brigels
VON DEN DREI GOLDENEN SCHLÜSSELN ...
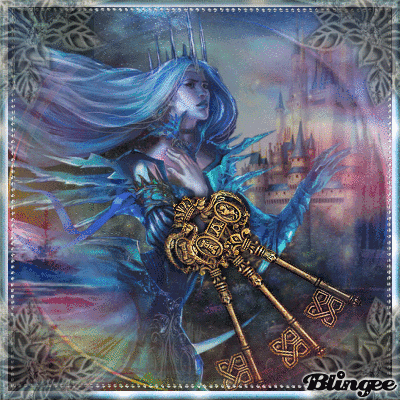
Drei arme Brüder gingen hinaus in die weite Welt, um Schätze zu suchen und trennten sich vor den Toren der Stadt. Der Älteste gelangte in ein ödes Gebirge, wo er eine Fee fand, die ihn in ihren Dienst nahm. Diese bewohnte ein Marmor Schloß auf Granit Grund.
Als ein Jahr verflossen war, sagte die Fee zum ältesten der drei Brüder: »Ich muß fort und komme eine lange Zeit nicht. Inzwischen aber bist du der Hüter meines Schlosses und dir übergebe ich die drei goldenen Schlüssel zu den drei verschlossenen Zimmern.«
Das Zimmer rechts und das Zimmer links darfst du öffnen, nicht aber, so dir dein Leben lieb ist, das Zimmer in der Mitte, in welchem alle Herrlichkeiten der Welt liegen. Sprach und verschwand.
Und der junge Mann öffnete die Türe links und erschaute des roten Goldes die Fülle. Dann öffnete er die Türe zum Zimmer rechts und wich zurück, geblendet von smaragdenem Glanz. Vor der Türe in der Mitte aber blieb er bebend stehen, den Kampf kämpfend zwischen Pflicht und Neugierde. Die letztere siegte; er öffnete das Tor und ihn umblitzte in unbeschreiblicher Pracht alle Herrlichkeit der Welt.
Kaum aber hatte sein Auge gesehen, was zu sehen dem Menschen nicht vergönnt war, da fühlte er seine Glieder erlahmen und erkalten und er verwandelte sich in einen schwarzen Marmorstein.
Nach Jahr und Tag kam der zweite Bruder des Weges gegangen, trat ebenfalls in den Dienst der Fee, erhielt die drei goldenen Schlüssel, ließ sich aber auch von der Neugierde verleiten, öffnete das mittlere Tor und ward zu einem grünen Marmorstein.
Zuletzt erschien der jüngste Bruder im Schlosse und nahm, wie seine Vorgänger, Dienst bei der Fee, erfüllte aber alle Bedingungen, öffnete die Türe links, öffnete die Türe rechts und ließ das Tor in der Mitte verschlossen. Da stund die gütige, Anmut strahlende Fee vor ihm, legte die Hand auf sein Haupt und vor ihm erschloß sich in blendendem Schimmer die Herrlichkeit der Welt.
Die Fee berührte dann den schwarzen und grünen Marmorstein mit einer Rute, gab den verzauberten Brüdern ihre frühere Gestalt wieder und hieß die drei sich mit Schätzen beladen und gehen. Das taten die Brüder und giegen dankend von dannen.
Als sie aber das Antlitz zurück wendeten, war vom Schloss nichts mehr zu sehen und wo sich die stolzen Hallen aufgetan hatten, stand eine schwarze Felsenwand.
In Surrhein bei Somvix erzählt
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
VON DER FEUERSPEIENDEN SCHLANGE ...
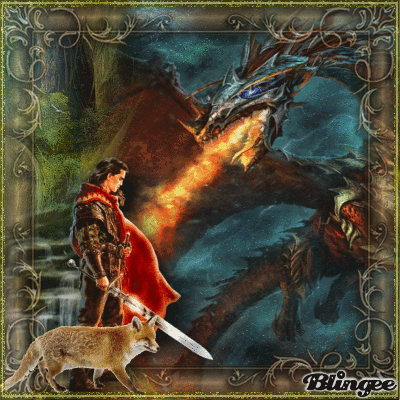
Ein Ritter ritt einst auf die Jagd. Da kam ihm von ungefähr ein alter Mann entgegen und bat den edlen Herrn um eine Gabe. Dieser gab willig ein Goldstück und wurde vom armen Greis mit Segenswünschen überhäuft.
Dann sprach der alte Mann: »Euch stehen Abenteuer bevor und zu Eurem Schutze geb ich Euch einen Fuchs mit. Den entsendet im Augenblicke der höchsten Gefahr und er wird Euch retten.« Dann pfiff der Alte und in mächtigen Sprüngen kam ein grauer Fuchs herbei und schmiegte sich schmeichelnd an den Ritter. Dieser nahm das gute Tier auf den Arm, schwang sich auf auf sein Roß und ritt von dannen, dem Alten, der mit entblößtem Haupte da stand, Grüße zuwinkend.
Gegend Abend kam der Jüngling vor eine dunkle Höhle, stieg vom Pferd, band das selbe an eine Tanne, rief dem Fuchs, der ihm wie ein Hund folgte. Kaum hatte er aber einige Schritte getan, daß er fast erschrocken zurück wich, denn vor ihm stand in kurzer Entfernung eine furchtbare Feuerschlange, größer und scheußlicher, als der größte und scheußlichste Drache.
Der Ritter warf zwar mit aller Macht den Speer in den offenen Schlund des feuerspeienden Ungetümes, aber der eiserne Speer zerschellte, wie ein schwacher Stab. Ströme von Flammen ausgießend, ringelte sich die Schlange in die Höhe und wollte sich auf den Ritter werfen, um ihn zu zermalmen, als dieser den Fuchs enteilen hieß.
Darob machte die Schlange eine Bewegung nach rückwärts. Diesen Augenblick benutzte der Ritter, tat einen raschen Sprung, deckte sich mit dem Schilde, und stieß, den Namen Gottes anrufend, sein zweischneidiges, breites Schlachtschwert in das Herz der Schlange, daß die selbe lautlos zusammenbrach.
Da kam das Füchslein wieder, lobte den Ritter ob seiner mannhaften Tat und lud ihn ein, noch das Letzte zu tun und die Königstochter mit ihren neunundneunzig Jungfrauen zu retten, die die Schlange bewachte und die von ihr getötet werden sollten.
Der junge Held besann sich nicht lange und folgte dem Fuchs, sich an seinem Schwanz haltend, durch dunkle Gänge, bis er in einen goldenen, blitzenden Saal kam, wo die schönste Königstochter, von neunundneunzig Edeljungfrauen umringt, bebenden Herzens ihres entsetzlichen Schicksals harrte.
Aber statt der vernichtenden Schlange kam ein stattlicher Jüngling in vornehmem Kleide, der den edlen Jungfrauen die Freiheit brachte. Da bot ihm die Königstochter ihre Hand, er ward ihr Gemahl und sie genossen der schönsten Tage und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch.
In Bardagliun bei Trons erzählt
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
VOM VÖGELEIN, DAS GOLDENE EIER LEGTE ...
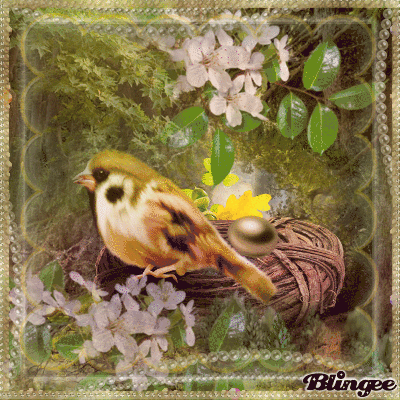
Nicht weit von einer großen Stadt lebte ein Besenmacher, welcher mit Mühe und Not seine Frau und zwei Knaben zu ernähren vermochte. Diese gingen eines Tages in den Wald, um Nester zu suchen und fanden zu ihrem großen Erstaunen eines, in welchem ein Vöglein saß, das goldene Eier legte.
Darüber freuten sich die Knaben gar sehr, nahmen Eier, Vogel und Nest und eilten nach Hause zu ihrem Vater, dem sie den gefundenen Schatz zeigten. Der gute Mann ging zum Goldarbeiter im Dorfe, welcher die Eier besah, und ihm erklärte, daß er ihn und seine ganze Familie erhalten wolle, wenn der Besenmacher ihm das Vöglein abtrete.
Dessen war Jener wohl zufrieden und sie zogen alle in das Haus des Goldschmieds, wo sie eine Zeit lang die besten Tage hatten.
Das Vöglein aber legte täglich ein goldenes Ei. Einmal hörte der Goldschmied, wie das gute Tierchen sang: »Wer mein Hirn ißt, der wird König und wer mein Herz verspeist, der erhält täglich 100 Dukaten.«
Kaum hatte der gierige Schmied diese Worte gehört, daß er das Vöglein tötete und es zum Braten in die Pfanne legte. Während er aber auf einen Augenblick hinaus gegangen war, kamen die zwei Knaben des Besenmachers in die Küche, rochen den Braten und verzehrten den selben zusammen, so daß der Jüngere das Hirn, der Ältere das Herz zu verzehren bekam.
Als der Goldschmied wieder in die Küche trat und das Vöglein verschwunden sah, geriet er in große Wut und jagte die ganze Familie fort, wodurch diese wieder in das größte Elend geriet.
So mußten sich die Brüder entschließen, in die Fremde zu reisen, um die Eltern zu unterstützen. So kamen sie zu einem Scheideweg, mitten im Walde, bei welchem der Jüngere ostwärts, der Ältere südwärts zog.
Der Jüngere kam nach langem Marsch in die Hauptstadt des Reiches, wo so eben der König gestorben und von den Großen des Reiches die Vereinbarung getroffen worden war, daß derjenige König werden sollte, der hoch zu Roß zuerst in der Frühe des folgenden Morgens den heiligen Hügel vor der Stadt erreichte.
Der junge Mann, welcher kräftig und schön aussah, erhielt ebenfalls ein Pferd und durfte sich am Wettrennen beteiligen. Das Glück war ihm hold, er sprengte wie ein alter Reiter den Hügel hinan, blieb Sieger und wurde noch des selbigen Tages zum Könige gekrönt und ausgerufen.
Er ließ seine Eltern sogleich zu sich kommen, ward ein großer Fürst und Held und regierte lange und glückliche Jahre.
Der ältere Bruder aber hielt sich in der ersten Nacht in einem großen Gasthof an der Heerstraße auf, und als er am anderen Morgen erwachte, fand er einen großen Geldbeutel vor sich liegen mit vollgültigen hundert Dukaten. Da sich nun das Wunder täglich wiederholte, heiratete er die wunderschöne und reiche Wirtstochter, und zog mit ihr an den Hof seines Bruders, wo er zum Ritter des Reiches geschlagen wurde.
(In Disla bei Disentis erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
VOM BRODE UND VON DEN DREI GUTEN RATSCHLÄGEN ...
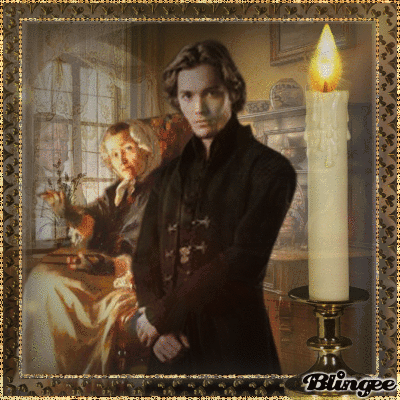
In einem großen Dorfe lebte ein Ehepaar, welches so arm war, daß der Mann in die Fremde ziehen mußte, um sein Brot zu verdienen.
Weit von seinem Heimatdorf fand er einen Dienst bei einem alten, guten Manne, bei welchem er sieben Jahre lang blieb. Als diese verflossen waren, und den Mann die Sehnsucht nach seinem fernen Weibe ergriff, bat er um seinen Abschied und um den Lohn.
Sein Herr entließ ihn mit freundlichen Worten, gab ihm ein Brot in die Hand und erteilte ihm die drei folgenden Ratschläge: er solle nie murren, nie von der rechten Straße abweichen und sich vor Handlungen im Zorn hüten.
Unser Freund ging dankend seines Weges und kam gegen Abend in ein Wirtshaus im Walde, wo man die Gäste in Totenschädeln bediente. Das dünkte dem Manne sonderbar, und er war eben im Begriffe, den Wirt über seine eigentümliche Bedienung zur Rede zu stellen, als ihm der erste Rat seines Herrn einfiel und er ruhig in sein Bett ging.
Am anderen Morgen weckte ihn der Wirt und sagte ihm, er habe durch sein bescheidenes Schweigen, ungeachtet ihm diese Schädelwirtschaft aufgefallen sein müsse, alle diejenigen Gäste erlöst, welche darüber gemurrt hatten. Nach diesen Worten führte der Wirt unsern Mann in den Keller, öffnete die Türen und ließ unzählige Verzauberte heraus, welche ihren Retter fast mit ihrem Dank erdrückten.
Darauf verließ die ganze Gesellschaft das unheimliche Wirtshaus und ging fröhlich weiter. Da kamen sie zu einem Scheideweg, wo die Befreiten den alten Weg aufgeben und den neuen einschlagen wollten. Eingedenk des zweiten Ratschlages seines alten Herrn widerriet das aber unser Mann und ging, als die anderen ihm nicht folgen wollten, den alten Weg fürbaß.
Und wahrlich zu seinem Glück; denn im nächsten Städtchen erfuhr er, daß seine Begleiter von einer Räuberbande entweder versprengt oder erschlagen worden seien. Zufrieden mit seinem Schicksal, setzte unser Mann seine Reise fort und kam bei Nacht in sein Heimatdorf vor seine Hütte, aus deren Fenstern aber voller Lichtschein drang.
Darob verwundert, blickte er in das Wohnzimmer und sah, wie seine Frau einen jungen, schönen Mann herzte und küßte. Dieser Anblick erweckte in ihm die Geister der Eifersucht, und er griff schon nach dem Messer, um seine vermeintlich geschändete Ehre zu rächen, als ihm der dritte und letzte Rat des einstigen Dienstherrn einfiel, ja nicht im Zorn zu handeln und er sich ruhig ins Wirtshaus begab, um über sein Weib Erkundigungen einzuziehen.
Dort erfuhr er auch den wahren Sachverhalt, daß nämlich jener junge Mann sein eigener Sohn sei, der am anderen Morgen die erste heilige Messe lesen werde. Beruhigt ging der Mann zur Ruhe, stand frühzeitig auf und nahm unerkannt am Ehrentage seines Sohnes Teil, bis er am Abend im Hause erschien und von seinem Weibe, seinem Kinde und allen Gästen aufs Liebreichste empfangen wurde.
Nach genossenem Nachtmahl schnitt der Vater das Brot seines ehemaligen Dienstherrn auf und heraus fiel ein Regen von Gold und Edelsteinen, daß die Familie die reichste wurde weit und breit im ganzen Lande.
(In Tiraun bei Trons erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
VOM MENSCHENFRESSER ...

Sieben Knaben hatten sich im Walde verirrt und erblickten am Abend ein Lichtlein, auf welches sie zu schritten. Das Lichtlein schimmerte aus den Fenstern eines großen Hauses, in welches sie traten.
In der Stube saß eine Frau und spann. Diese nahm die Kinder liebreich auf, gab ihnen zu Essen und zu trinken und versteckte sie hinter dem mächtigen Ofen von Lavetschstein. -
Nach einer Stunde wurde die Türe aufgerissen und herein kam schnaubend ein Riese mit einem fürchterlichen Rachen, tappte in der Stube umher und rief, daß die Fenster zitterten: »Ich rieche Menschenfleisch.«
Die Frau wollte nichts davon wissen und alles wäre gut gegangen, wenn nicht einer der Knaben unvorsichtiger Weise seinen Kopf hervor gestreckt hätte, daß ihn der böse Menschenfresser erblickte, und ihn in einem Augenblicke aufzehrte. Damit war aber der Hunger des Riesen nicht befriedigt. Er fraß noch einen Knaben und dann seine eigene Frau zur Strafe für ihre Lüge.
Die anderen Kinder sperrte er in einen Hühnerstall unter dem Ofen ein, damit sie fett würden, und legte sich schlafen. Am anderen Tag erwachte der Menschenfresser nicht gar frühe, öffnete gähnend den Hühnerstall, nahm den ältesten der Knaben und frug ihn, ob er auch Läuse suchen könne.
Dieser bejahte die Frage und der Riese setzte sich hin, beugte den Kopf auf die Knie und ließ den Knaben in seinen Haaren hantieren. Der Knabe war aber klugen Sinnes und kitzelte und kratzte so lange, bis der häßliche Menschenfresser in einen tiefen Schlaf verfiel. Dann langte das Kind ein breites Schwert von der Wand, hieb dem Riesen den Kopf ab, nahm alle Schätze, welche im Hause aufgehäuft waren und befreite seine Brüder.
(In Comadè bei Trons erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
VON DEN ZWEI FREUNDEN ...
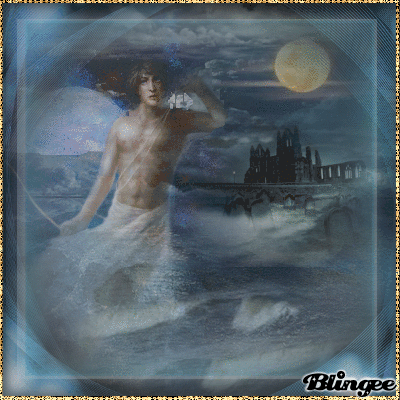
Es war einst ein König, der hatte zwei wunderbar schöne Töchter. Da er aber wollte, daß sie unvermählt blieben, ließ er ein prachtvolles Schloß mitten in einem dunklen See bauen und die Ufer mit gewaltigen Mauern umgeben, so daß Niemand zu den Königstöchtern gelangen konnte.
In einer finstern Nacht aber rauschte eine herrliche Männergestalt empor aus den Wellen und verblieb eine Nacht im Schloss. Nach neun Monaten aber klapperten die Störche ob den Zinnen der Seeburg und brachten den zwei Prinzessinnen zwei wunderschöne Knaben, die sich seltsamerweise so glichen, wie ein Ei dem anderen.
Das war eine große Verlegenheit für die königlichen Jungfrauen und sie baten die Bauersfrau, welche ihnen täglich das Essen brachte, ihnen doch noch mehr Speisen zu verschaffen, da sie gar gewaltigen Hunger hätten.
Als die Knaben acht Jahre alt wurden, ließen die beiden Königstöchter den Vater ersuchen, ihnen doch grünes Tuch und zwei Bogen mit Pfeilen zu senden, um sich als Jägerinnen zu kleiden und auf kleine Vögel zu schießen.
Der Vater entsprach dem Wunsche der Töchter, sandte prachtvolle grüne Tücher und zwei Bogen von Gold mit weit hintreffenden Pfeilen. Die beiden Mütter lehrten nun ihre Knaben die lieblich singenden Vögel schießen, in stiller Mond bescheinter Mitternacht in den Wassern des Sees schwimmen und kleideten sie mit dem grünen, Gold durchwirkten Tuch.
Nach Jahr und Tag sagten die Mütter zu den beiden Knaben, sie sollten nun in die Welt hinausgehen, um ihr Glück zu versuchen, den Namen Derer aber, die sie geboren, nicht nennen. Und zum Andenken gaben sie den Jünglingen je ein Schwert mit goldenem Griff.
In mondheller Sommernacht schwammen die Knaben durch den See, erklommen die Ringmauer und gingen Hand in Hand durch die schweigende Nacht, bis sie zu einem Scheideweg im tiefsten Walde ankamen, wo sie sich zu trennen beschlossen.
Neben einer uralten Eiche pflanzte der Eine sein Schwert in die Erde, und schwuren sich beide, nach Jahresfrist wieder bei der Eiche zusammen zu treffen, und sollte der eine oder der andere nicht kommen, so habe der Erschienene nicht eher zu rasten, bis er den Freund und Blutsverwandten gefunden.
So schieden sie mit Händedruck und der eine ging links, der andere rechts. Der so den Weg rechts eingeschlagen hatte, erreichte nach einigen Tagen eine große glänzende Stadt, in welcher tiefe Trauer herrschte. Er frug nach der Ursache und erfuhr, daß ein scheußlicher Drache die Tochter des Königs geholt und daß derjenige die Hand der Jungfrau und das Reich erhalten würde, der sie von jenem Ungetüm befreie.
Dem jungen Ritter schwoll das Herz ob jener Mähre und er beschloß den Strauß zu wagen. Von den Segenswünschen des Hofes begleitet, ging er hinaus, wo der Drache hauste, empfahl seine Seele Gott und sandte dem Ungeheuer aus seinem goldenen Bogen einen Pfeil in den Rachen, daß jenes stöhnend erlag.
Darob war gar große Freude im Lande und der junge Ritter erhielt die Hand der jungen Königstochter und das Regiment über Land und Leute. Eines Tages überkam ihn aber eine wilde Jagdlust und mochte die besorgte Gattin einwenden, was sie wollte, er ging früh Morgens in den nahen Wald, die lieblich singenden Vögel zu schießen.
Im Dickicht begegnete ihm ein altes Weib, welches ihn bat, einen Ring zu suchen, den sie verloren habe. Während der Fürst, um ihr den Dienst zu leisten, sein Haupt zur Erde gebeugt hatte, strich das Weib, welches eine arge Zauberin war, dem jungen Mann über die goldenen Locken und verwandelte ihn in einen schwarzen Marmorstein.
Als das Jahr herum war, kam des Verzauberten Vetter zur Eiche, bei der das Schwert stand. Dieses aber war rostig, und das bedeutete Unglück für den, der nicht erschienen war. Ohne Säumen machte sich der Ritter auf, um den Freund zu suchen, und so kam er in die Stadt, wo seiner Muhme Sohn König gewesen.
Dort empfing man ihn mit Jubel, denn man hielt ihn für den verlorenen Fürsten und führte ihn im Triumph hinauf in die Königsburg, wo die weinende Königin den vermeintlichen Gemahl an ihr Herz preßte.
Der Ritter aber legte des Nachts sein Schwert zwischen sich und Jene. Mit dem Frührot erhob er sich vom Lager und ging hinaus zur Jagd, ungeachtet der Tränen seiner schönen Base. Im Wald angekommen, begegnete auch ihm jenes tückische Zauberweib und bat ihn, einen verlorenen Ring zu suchen.
Der Ritter aber war klug und erkannte in der Hexe die Zauberin, welche seinen Freund in den schwarzen Marmorstein verwandelte. Er drohte ihr mit dem Schwerte und schwur, ihr das Haupt vom Rumpfe zu trennen, wenn sie nicht den Freund von seinem Zauber befreie.
Das böse Weib aber hatte über den Jüngling keine Macht und mußte ihm willfahren. Sie gab ihm eine Rute, welche die Kraft hatte, zu entzaubern. Damit schlug der Jüngling auf den nächsten Marmorstein und dann auf viele andere, die umher lagen und bald lagen sich die Freunde in den Armen und um sie scharten sich Ritter ohne Zahl, die jene Rute vom Zauber befreite. Und freudig zogen sie alle in die Königsstadt, wo ihre Tage in ungestörter Ruhe verflossen.
Der tapfere Vetter aber ward des Reiches Feldhauptmann geworden und warf alle Feinde nieder.
(In Schlans erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
DER HABERSACK ...
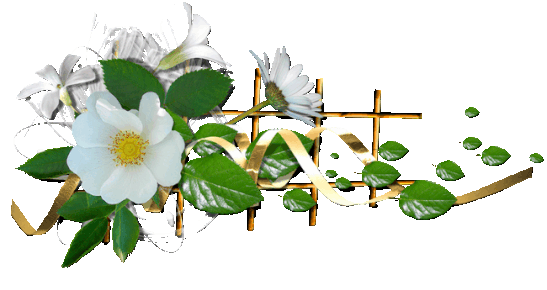
An einem heißen Sommertag ging ein armer, alter Soldat auf der Landstraße, trug einen Habersack auf dem Rücken und als ganzes Vermögen sechs Kreuzer in der Tasche, drei für den Branntwein und drei für das Brot.
Da begegnete ihm ein gar armseliger Mensch, der um eine Gabe flehte. Unser Soldat, der ein gutes Herz hatte, gab dem Armen ohne Bedenken die Hälfte seines Geldes und ging weiter. Im Wald begegnete ihm aber eine andere noch traurigere Gestalt, die ebenfalls um eine Gabe flehte.
Der Krieger gab seinen letzten Kreuzer und wollte weiter ziehen, als der vermeintliche Bettler sprach: »Der Erste, dem du eine Gabe gegeben hast, war der heilige Petrus, ich aber, ich bin der Herr, und du kannst dir die Gnade erbitten, die dir behagt.«
Da lachte der alte Krieger in den grauen Bart und antwortete: »Topp, Herr, Hand darauf! So ich wünsche, daß Jemand in meinem Habersack sei, soll es geschehen.« »Es sei,« sprach der Herr und verschwand.
Am Abend kam unser Soldat in ein großes, menschenleeres Schloß, in welchem er aber ein prächtiges Essen gerüstet fand, das er sich mit Behagen schmecken ließ; dann sank er auf ein Ruhebett und schnarchte wie ein Bär.
Um Mitternacht aber zupfte ihn Jemand an seinem Bart, daß er ärgerlich ausrief: »Ei, wärst du in meinem Habersack,« worauf er weiter schlief. Als unser Held nach alter Gewohnheit mit dem ersten Morgenstrahl sich von seinem Lager erhob und nach seinem Habersack griff, war er bedeutend angeschwollen.
Allein der Soldat machte sich nichts daraus und begab sich in die Schmiede, welche er vom Schlosse aus gesehen hatte, und erzählte dem Schmied, wo er die Nacht zugebracht hatte. Darob ward der selbe nicht wenig erstaunt und erzählte dem Krieger, daß er in einem Zauberschloß gewesen sei und Gott danken könne, daß ihn kein Unfall betroffen habe.
Da erinnerte sich der Soldat seines angeschwollenen Habersackes, legte diesen auf den Ambos und bat den Schmied, der ein gewaltiger Geselle war, lustig darauf loszuschlagen, bis alles wieder platt geworden. Das tat der Schmied gerne und schwang den großen Hammer, daß der alte Soldat vor Vergnügen auflachte.
Als die Beiden aber den Sack öffneten, fanden sie in dem selben einen armen, platt gedrückten Teufel, der stöhnend und hinkend von dannen lief.
Nach Jahr und Tag und nach manchem Schabernack starb der Soldat und kam vor das Himmelstor, wo ihn aber der gestrenge heilige Petrus wegen seiner vielen auf Erden begangenen Sünden abwies, worauf dann unser Krieger unbekümmert den Weg zur Hölle einschlug.
Als er aber vor das Gitter der Hölle kam und Einlaß begehrte, da schrie ein platt gedrückter Teufel dem Wachthabenden zu: »Den laß nicht herein, sonst drückt er uns alle platt,« und die Türe wurde unserm Freund vor die Nase zugeschlagen. Das gefiel aber unserm Kriegshelden weniger; er lief spornstreichs wieder gen Himmel und verlangte zum zweiten Mal Einlass.
Der heilige Petrus war aber wieder nicht zu bewegen, so sehr auch der Alte fluchte und tobte. Schon wollte der Himmelswächter das Tor auf immerdar schließen, als sich der Soldat noch im rechten Augenblick seines Habersackes erinnerte, den selben rasch in den Himmelsraum warf und sich selbst hineinwünschte, und wie er gewünscht, ist es geschehen, und unser Soldat marschiert wacker durch die große himmlische Kaserne und ist selber ein großer Heiliger geworden.
In Laus bei Somvix erzählt
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
DIE SCHLANGENJUNGFRAU ...
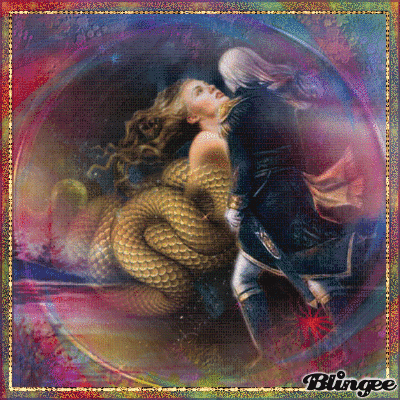
Einst kam ein junger Krieger vor ein uraltes Schloß und trat in die fast zerfallenen Gemächer. Im Rittersaal erschien ihm eine anmutige Jungfrau und bat ihn, sie zu retten, in dem sie dazu verdammt sei, alle Nächte als Schlange durch die Räume des Schlosses zu irren. So aber jemand den Mut habe, sie dreimal während dreier Nächte zu küssen, der erlöse sie vom Zauber und erhalte als Belohnung ihre Hand und ihre Schätze.
Der junge Krieger sagte fröhlichen Herzens zu und ließ sich ein Gemach anweisen, wo er die Nacht zubringen sollte. In diesem fand er alle möglichen Bequemlichkeiten und auf dem Tische die köstlichsten Speisen und die allerbesten Weine.
Nach genossenem Mahle legte er sich hin und schlief. Schlag zwölf Uhr aber wurde der Ruhende von einer gräßlichen Schlange geweckt, die sich an seinem Bette zischend emporrichtete. Der Ritter überwand den Eckel ob dem grauenhaften Tier und küßte es auf den Rachen. Sofort trat ein wunderschönes Mädchenhaupt an die Stelle des häßlichen Schlangenkopfes; dann verschwand die ganze Erscheinung und der Ritter schlief ruhig weiter.
In der darauf folgenden Nacht wiederholte sich der Spuck. Der Ritter umschlang mutig den Schlangenleib, drückte einen Kuß darauf und aus dem Ungetüm ward eine reizende Maid, deren Körper aber in einen schuppigen Schwanz auslief. In der dritten Nacht erschien die Schlangenjungfrau wieder, um nach dem letzten Kuß des Ritters ihre völlige Menschengestalt anzunehmen.
Am frühen Morgen trat die gerettete Jungfrau zu dem Ritter, der im Garten lustwandelte und bat ihn, sie nach drei Tagen vor der Kirche im nahen Dorfe abzuholen, worauf sie dann ihre Hand für immer in die seinige legen werde. Der Ritter tat, was ihm die Jungfrau gesagt und stieg vom Schlosse hinab in ein einsames Gasthaus mitten im Walde.
Als er am anderen Morgen sich anschickte, seinen Zopf zu drehen, da kam die Wirtin ins Zimmer und bat, ihm bei dieser Arbeit behilflich sein zu dürfen. Der junge Mann ließ sich die Dienstleistung gefallen und die Wirtin drehte mit zierlichen Händen den Zopf, steckte aber die Nadel der Vergeßlichkeit in das Haargeflecht, so daß Jener seine Braut vergaß und gedankenlos herrlich und in Freuden dahin lebte.
Die befreite Jungfrau aber harrte am dritten Tage seiner und als er nicht kam, schickte sie ihre treue alte Magd zu ihm und er versprach am anderen Morgen zu kommen. Allein die arge Wirtin, die eine schlimme Zauberin war, bot sich ihm wieder zu Diensten an und wiederholte ihre Zauberkunst, so daß der Edelmann der Zeit vergaß.
Nach dem sechsten Tage kam die Magd wieder und berichtete mit Tränen in den Augen, daß der böse Zauberer wieder Macht erlangt habe über ihre Herrin und sie nun auf dem Glasberg weile. Befreiung aber sei nur durch den Ritter möglich, der als ein Sonntagskind über die schlimmen Geister Gewalt habe.
Die Schreckensmähre weckte den Jüngling aus seinem halb wachen Traum und er schwur, hinzueilen, um die Braut zu befreien. Die Alte gab ihm ein Paar goldene Schuhe, mit welchen der Jüngling bei jedem Schritt drei Meilen machte und so kam er noch am hellen Mittag zum Glasberg, wo ihn unzählige Jungfrauen mit den schönsten Augen um Rettung flehten, aber er ließ sich nicht betören, und ruhte nicht, bis er die Braut gefunden, die ihn jubelnd umarmte.
Da er aber nur ein Paar Dreimeilenschuhe hatte, so trat er einen davon der befreiten Freundin ab, umschlang sie und fuhr mit Blitzesschnelle mit der teuren Last nach dem fernen, nun entzauberten Schloss, wo die beiden ein glückliches Paar und die Stammeltern eines großen und mächtigen Geschlechtes wurden.
(In Flutginas bei Schlans erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
VON DEN DREI GOLDENEN ÄPFELN ...
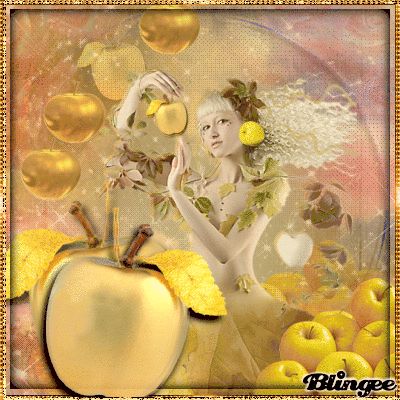
War vor vielen, vielen Jahren ein König in der Ebene, der lag seit vielen Monden krank und niemand konnte ihm helfen. Da kam eines Tages ein Bäuerlein in die Königsburg und wurde vor den Fürsten gelassen. Zu diesem sagte der Mann, er wolle ihn heilen, sofern der König drei goldene Äpfel aus dem verwünschten Garten erhalten könne.
Der König ließ seine Söhne kommen und hieß den ältesten die Äpfel bringen. Der Prinz sattelte sein Pferd und ritt aus der Königsburg. Im Walde stieß er auf einen Bettler, der ihn um ein Almosen bat. Aber der Prinz war harten Herzens und schlug den armen Mann.
Am Rande des Waldes stand ein Wirtshaus, hier trat der junge Mann ein und wollte nach genossenem Imbiß wieder von dannen ziehen, aber die Wirtin hielt ihn mit süßen und schmeichelnden Reden zurück (denn sie hatte wohl gemerkt, daß des Jünglings Beutel mit Golddukaten wohl gespickt war), bis er all sein Geld verjubelt, worauf er ins Gefängnis geworfen wurde.
Als der Älteste so lange nicht kam, machte sich der Zweite auf den Weg, ritt durch den Wald, wies, wie Jener, den Bettler ab, kam ins Wirtshaus und blieb bei Wein und Speisen so lange, bis die güldenen Dukaten ausgingen und auch er den Weg zum Gefängnis antreten mußte.
Nach Jahresfrist bestieg der Jüngste sein Pferd, um die beiden Brüder und die drei goldenen Äpfel zu suchen. Im Walde traf er, wie die anderen, auf den alten, grauen Mann, aber er ging nicht stolz und höhnend am Bettler vorbei, sondern reichte ihm eine Gabe.
Da sprach der alte Mann mit mildem Lächeln: »Ihr seid gut, und ihr sollt die goldenen Äpfel erhalten. Geht aber am Wirtshaus am Waldesrand vorbei und laßt Euch nicht von süßen Worten umstricken. Lenkt dann Euer Pferd gegen Sonnenaufgang und ehe drei Tage vergehen, werdet Ihr vor dem verwünschten Garten mit den ehernen Toren stehen.
Vorher aber müßt Ihr durch das Reich der Löwen, dann durch das der Bären und endlich durch das der Affen gehen. Seid dann aber hübsch manierlich mit den Tieren, dann tun sie Euch nichts zu Leide, denn sie sind verzauberte Menschen, welche der Befreiung harren.«
Der Königssohn dankte und ritt fröhlich weiter, das Antlitz gegen Osten gewendet, der süßen Töne nicht achtend, die aus dem Waldwirtshaus drangen. Und ehe der dritte Abend sich auf die Erde herab senkte, hatte der Prinz das Reich der Löwen erreicht und ward vor den König geführt.
Diesem offenbarte er sein Begehr und erhielt den Rat, mit der zwölften Mittagsstunde den Garten zu betreten und vier Viertelstunden später den selben zu verlassen, und zwar um keine Minute zu spät, da mit dem Schlage Eins sich die ehernen Pforten dröhnend schließen und dann keine Rückkehr mehr möglich sei. Des Löwenkönigs solle er aber gedenken und auch ihm drei goldene Äpfel bringen.
Die gleiche Aufnahme, die gleichen Ratschläge und die gleichen Wünsche fand der Königssohn bei den Bären und Affen und als die Glocke Zwölf schlug, stand der Prinz vor den ehernen Toren des verwünschten Gartens, die sich krachend öffneten. In einem Baumgang fand er eine Jungfrau, die so schön war, wie die Sonne am Himmel, und er setzte sich zu ihr und erzählte ihr sein Vorhaben.
Da schlang sie die lilienweißen Arme um seinen Nacken und bat ihn, die goldenen Äpfel zu holen, aber des Gesanges nicht zu achten, der ihn mit süßen Klängen verlocken werde, da er sonst die Stunde der Erlösung vergessen würde und sie und er auf immer verloren wären. Sie aber warte seiner an ihrem Platze, den sie nicht verlassen könne.
Und der Prinz ging hin, verstopfte sich die Ohren und brachte zwölf goldene Äpfel herbei, drei für seinen siechen Vater und je drei für die Fürsten im Reiche der Löwen, der Bären und der Affen. Dann nahm er die Jungfrau und führte sie durch die ehernen Tore hinaus, die sich, da es eben Eins schlug, donnernd hinter dem Paare schlossen.
Treu seinem Worte, gab er die Äpfel den drei Tierfürsten und ging mit seiner holdseligen Braut von dannen. Sie waren noch nicht weit gekommen, als hinter ihnen sich eine Wolke erhob und bald darauf ein glänzendes Gefolge heran gesprengt kam, um dem königlichen Paare zu huldigen.
Das Gefolge aber bestand aus Rittern, die der Prinz in den drei Reichen durch die goldenen Äpfel befreit hatte. So ritt die stolze, schimmernde Schaar durchs Land und als sie zum Waldwirtshaus kamen, wurden die beiden älteren Brüder des Ritters eben zur Richtstätte geführt und waren nicht wenig froh, als sie durch ihren Bruder befreit wurden.
Statt ihrer aber mußte die arge Wirtin verbluten und dann zogen alle in die Königsstadt und der König war von Stund an gesund.
(In Tavanasa bei Brigels erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
DIE TAUBE ...
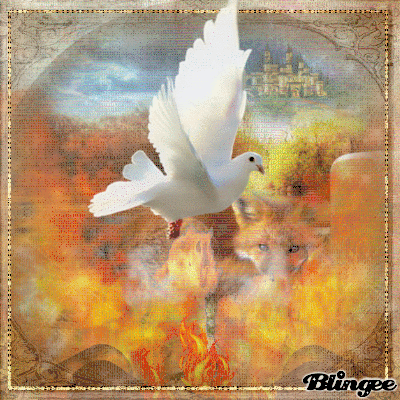
Ein Ritter kam in ein verlassenes Schloß und fand in einem Gemache die besten Speisen und den feinsten Wein, die er sich wohl schmecken ließ. Als er aber gegessen und getrunken, kam ein Fuchs in das Gemach und sagte ihm, er habe verzauberte Speisen gegessen und verzauberten Wein getrunken, er müsse ihm nun sieben Jahre dienen und während dieser Zeit Holz spalten. Wenn der Ritter aber seine Pflicht tue und vor allem nicht in das kleine Gemach mitten in der Burg blicke, so würden beide befreit werden und er, der Ritter, in den Besitz großer Reichtümer gelangen.
Dieser fügte sich ins Unvermeidliche, spaltete fleißig Holz und hütete sich vor dem verhängnißvollen Gemache. Aber ehe die sieben Jahre vergingen, hatte der Mann seine guten Vorsätze vergessen und schaute in das Gemach, aus welchem der Fuchs hervor sprang und ihm, halb zürnend, halb trauernd, sagte, sie beide müßten noch sieben Jahre im Schlosse liegen, und er möchte sich doch vor dem Gemache hüten.
Der Ritter spaltete wieder geduldig Holz und ging sechs Jahre lang scheu am Gemache vorüber, konnte sich aber zuletzt nicht überwinden und tat, was er hätte unterlassen sollen. Da erschien der Fuchs wieder, weinte bittere Tränen und ermahnte den wankelmütigen Ritter, während der letzten sieben Probejahre doch standhaft zu bleiben, da sie sonst beide auf tausend Jahre hin verloren wären.
Das nahm sich der Mann zu Herzen; er spaltete Holz und floh das mittlere Gemach des Schlosses, wie die Hölle, und überwand glücklich seine Neugierde. Da kam wieder der Fuchs und war überaus fröhlich und lobte und herzte in seiner Art den Ritter. Dann hieß er ihn das während der dreimal sieben Jahre gespaltene Holz zu einem Scheiterhaufen zusammentragen, ihn, den Fuchs darauf legen, den Holzstoß anzünden und der Dinge warten, die da kommen sollten.
Und der Ritter tat, wie ihm befohlen. Im Schloßhofe erhob sich bald darauf ein mächtiger Holzstoß, worauf der Fuchs angebunden lag, und am dritten Tage schlug die Flamme gen Himmel empor, die Mauern und Zinnen der Burg mit überirdischem Glanze verklärend.
Und wie der Ritter da stand und in das Flammenmeer schaute, da entflog dem Scheiterhaufen eine blendend weiße Taube und schwang sich empor auf goldenen Flügeln in das Abendrot gegen den lichten Äther und eine Stimme aus den Wolken rief hernieder: »Die Seele ist gerettet und Burg und Wald und Land gehören dem Ritter.«
(In Val bei Somvix erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volksthümliches aus Graubünden
DIE ADLERBRAUT ...
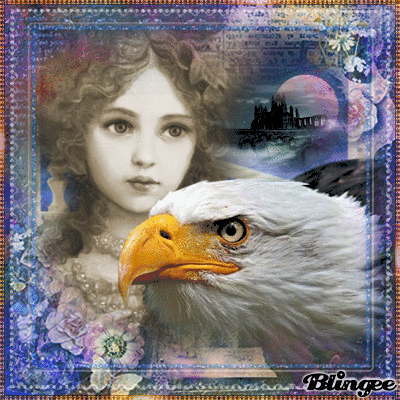
In einer großen Stadt lebte ein armes Ehepaar, welches lang kinderlos blieb. Als ihnen der Herrgott ein Knäblein bescherte, sagte die Wehmutter, die gar gescheit war, man solle zum Paten für das Kindlein den ersten besten Reiter nehmen, der des Weges komme.
Der Vater ging auf die Straße, wartete den ersten Reiter ab und bat dann diesen zu Gevatter. Der Mann sagte zu, hob das Knäblein aus der Taufe und gab sich als König eines großen Inselreiches zu erkennen. Das Knäblein aber gefiel dem Herrn so gut, daß er einen großen Haufen Goldes zurückließ mit dem Befehle, für das Kind gehörig zu sorgen, und wenn es achtzehn Jahre alt sei, es ihm zu Hofe zu schicken, wo es dann sein eigen Töchterlein zur Frau erhalten solle.
Die Eltern taten, wie ihnen geheißen, und als der Knabe achtzehn Jahre alt wurde, sandte ihn sein Vater zum königlichen Paten im großen Inselreiche. An einer Quelle traf er mit einem häßlichen Zwerg zusammen, der den Jüngling mit dem Tode bedrohte, wenn er nicht tue, was er wolle.
Das Patenkind des Königs mußte sich fügen und das Versprechen ablegen, den Zwerg als den künftigen Gemahl der Inselprinzessin gelten zu lassen und sich selbst als Diener zu betrachten. So gelangten die zwei in das Inselreich, und der König war nicht wenig erstaunt, als er sein vermeintliches Patenkind sah mit dem wackeligen unförmlichen Kopf und den dünnen, schiefen Beinen.
Auch der Königstochter gefiel der krummbeinige Bräutigam gar nicht gut, und sie hielt sich lieber an seinen schlanken und schönen Diener. Darob wurde der Zwerg eifersüchtig und verwünschte die Königstochter nach der Insel im Meere, wo ewiges Dunkel herrscht.
Und dabei war er so boshaft, den Diener als den Zauberer zu bezeichnen, so daß dieser auf Befehl des Königs ins Gefängniß geworfen und zum Rade verurteilt werden sollte.
Da erschien in der Nacht vor der Hinrichtung des unglücklichen Jünglings ein ehrwürdiger Greis und gab ihm den Rat, als letzte Gnade drei mit Fleisch beladene Schiffe zu verlangen, womit er in die See stechen und die Königstochter suchen müsse.
Das tat der Jüngling und schwur bei dem Höchsten nicht zu rasten und nicht zu ruhen, bis er die Königstochter gefunden. Der fürstliche Vater gewährte ihm die Bitte. Und der Jüngling fuhr hinaus in die wogende See und kam zuerst zur Insel der Bären, welchen er auf Verlangen eine Schiffsladung voll Fleisch gab.
Den Bärenkönig aber fragte er nach der Insel ohne Licht; der konnte ihm aber keinen Bescheid geben, versicherte ihn indessen seiner Hilfe auf den ersten Pfiff hin. Auf der Insel der Leoparden hatte der Jüngling das gleiche Abenteuer, gab die zweite Schiffsladung, erhielt zwar keine Auskunft über die gesuchte Insel, wohl aber freudige Zusicherung der schnellsten Hilfe für den Notfall.
Auf der Insel der Adler erging es ihm besser. Der Adlerkönig, dem er die dritte Schiffsladung mit Fleisch überreichte, war darüber hoch erfreut und verlieh dem Jüngling die Gabe, sich nach Belieben in einen Adler verwandeln zu dürfen, und was die Insel ohne Licht anbelangt, so erfuhr das Patenkind des Königs durch einen alten Adler, der dort einmal gewesen war, das Nähere; ja der wackere Vogel bot sich ihm zum Begleiter an, was unser Freund gerne annahm.
So fuhren sie zusammen in die See hinaus und kamen zur lichtlosen Insel, wo sie landeten. Das erste, worauf sie stießen, war eine alte Frau, die sieben weiße Mäuse um sich hatte. Diese frug der alte Adler nach dem Schlosse, wo die fremde verzauberte Fürstin weile, und das Weib gab bereitwillig Auskunft und sagte, sie wolle ihnen ihre Mäuse als Führerinnen mitgeben.
Der alte Adler aber, der an Sonne gewöhnt, in dieser lichtlosen Luft nicht leben konnte, breitete die Fittiche aus und flog südwärts seiner glühenden Heimat entgegen. Die Mäuslein aber führten den Jüngling zu einer auf steilen Felsen liegenden Burg mit einem einzigen Fenster hoch oben unter dem Dache, aus welchem ein blasses, edles Antlitz hinaus sah in die ewig dunkle Nacht.
Der Jüngling verwandelte sich in einen Adler, flog hinauf in die Dachkammer und nahm zum Entzücken seiner schönen Freundin wieder seine Gestalt an. Und die Königstochter sagte ihm, er müsse noch, ehe er sie befreien könne, den Drachen töten, der sie bewache, der horste aber im dunkelsten Teil der Burg, zu dem viele, viele Stufen hinabführten.
Der junge Mann zögerte nicht lange und stieg hinab, das gezückte Schwert in der Hand, bis zur Drachenhöhle, aus der das Scheusal kampfbereit hervorblickte. Der Jüngling führte sofort einen mächtigen Hieb mit seinem Schwert nach dem Drachen; aber am Schuppenpanzer des Lindwurms brach die Klinge, wie ein leichter Stab, und unser Freund wäre verloren gewesen, hätte er sich nicht im entscheidenden Augenblick der versprochenen Hilfe erinnert und den fernen Freunden gepfiffen.
Und kaum war der Schall verhallt, daß es von allen Seiten von Bären, Leoparden und Adlern lebendig wurde und der Drache nach verzweifelter Gegenwehr den vereinten Kräften der starken Tiere erlag. Im Jubel wurde nun die Königstochter auf die Schiffe gebracht, der Drache aber verbrannt und die Asche ins Meer geworfen.
Und siehe, im nämlichen Augenblick sah sich das Patenkind des Königs von einem zahlreichen und glänzenden Gefolge umringt - es waren die Bären, Leoparden und Adler, die durch das Verbrennen des Drachen wieder ihre Menschengestalt erhalten hatten.
Auf der Insel wurde es hell, und die Burg sank in Trümmer. Des Königs Patenkind und die Königstochter und alle die befreiten Ritter und Edlen schifften südwärts nach dem großen Inselreiche, wo sie jubelnd empfangen wurden.
Den betrügerischen Zwerg aber erreichte die schwere Hand des Königs, und er starb auf dem Rad.
(In St. Benedetg bei Somvix erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volksthümliches aus Graubünden
DIE SCHWANENJUNGFRAU ...
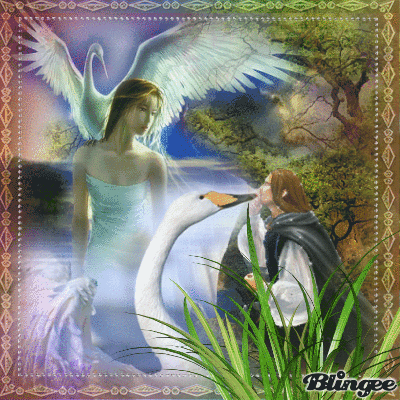
Es war einmal in einem fernen, fernen Lande hart am Meere ein reicher Kaufmann; der hatte einen einzigen Sohn. Als dieser großjährig wurde, übergab ihm der Vater eines seiner größten Schiffe und hieß ihn hinausfahren in das Meer, um mit fernen Völkern zu handeln und kostbare Güter in die Heimat zu bringen.
Der Sohn segelte fröhlich hinaus in die See und begegnete da, wo er nichts als Himmel und Wasser sah, einem schwarzen Schiffe, welches das seinige anhielt. Der Kapitän jenes Schiffes entrollte seine blutig rote Flagge und stieg auf das Verdeck des Kaufmanns Schiffes, und zwar allein; denn der graue, finstere Mann leitete sein Schiff mit eigener Hand und hatte keine Bemannung.
Dem Kaufmannssohn bot der Schiffsmann ein Spiel an, und die beiden spielten und spielten, bis der junge Kaufmann alles und dann sich selbst an den Unbekannten verlor. Dieser nahm indessen dem Jüngling nur das Versprechen ab, innerhalb der Jahresfrist das Land Amerika an einem gewissen Punkte zu betreten und schied rau und ohne Gruß.
Der junge Kaufmann aber kehrte in die Vaterstadt zurück, wo er aber immer bleicher und stiller wurde, so daß sein Vater ob der Veränderung unruhig zu werden begann. Lange wich ihm der Sohn aus; aber endlich gestand er sein Spiel und sein Versprechen.
Darob härmte sich der alte Vater, welcher den einzigen Sohn hatte und suchte Hilfe bei einem weisen Manne im Walde. Und der weise Mann wußte Rat: Der Sohn solle, so sagte der Greis, in die See hinausfahren bis zur Insel, wo drei Schwanenjungfrauen wohnen.
Von einem Versteck aus werde er die wunderbaren Vögel betrachten können, und gelinge es ihm, während jene baden, eines der drei Schwanenkleider zu erhalten, so werde ihm die Schwänin, der das Kleid gehöre, jeden Wunsch erfüllen.
Der Kaufmannssohn befolgte den Rat und kam zur Schwaneninsel, als die drei Schwäninnen sich zum Bade anschickten. Und sie legten das Schwanenkleid ab, und ins Meer stiegen drei Jungfrauen von überirdischer Schönheit.
Der junge Mann, der von einem Gebüsche aus die Schwäninnen beobachtet, sprang rasch herbei und hob das eine der drei wunderzarten Kleider auf, worauf die jüngste und schönste der Schwanenjungfrauen zu ihm heraufgeschwommen kam und nach seinem Begehren fragte.
Der Jüngling forderte von ihr Hilfe zu jeder Zeit und Treue für immer. Das sagte ihm die Jungfrau zu, und er küßte sie auf die Stirne. Und die Jungfrau gab ihrem Bräutigam eine Gerte, und er schlug damit auf das Meer und kam trockenen Fußes nach dem fernen Amerika.
Am Ufer harrte schon seiner der grimme Spieler und führte ihn in sein Haus, wo in fünfzehn goldenen Käfigen fünfzehn abgeschlagene Köpfe hingen. »Der sechszehnte«, sprach der harte Mann, »ist für deinen Kopf, sofern du nicht die drei Arbeiten vollbringst, die ich dir auferlegen werde.«
Die erste Aufgabe besteht darin, einen Urwald mit einer gläsernen Axt zu fällen. Beim ersten Hieb aber zersprang die Axt, und der Kaufmannssohn rang die Hände vor Jammer und Schmerz.
Da legte sich eine weiche Hand auf seine Schulter, und als er sich umsah, lächelte ihm mild seine Schwanenbraut entgegen und schmollte mit ihm im liebevollsten Ton, daß er ihrer vergessen habe im Augenblicke der Not. Er solle sich nur hinlegen und schlafen, es werde ihm geholfen werden. Und er schlief, und als er erwachte, war der Wald gefällt und das Holz gespalten, die Schwanenjungfrau aber verschwunden.
Die zweite Arbeit bestand im Abtragen eines Berges und Anpflanzung eines Weingartens. Der Jüngling vergaß aber diesmal seine mächtige Freundin nicht, rief sie herbei, und sie kam, ehe er noch den Ruf vollendet, und er legte sich hin und schlief, und als er erwachte, war die Arbeit vollendet.
Die dritte Arbeit aber war die schwerste. Der Grimme warf seinen goldenen Ring ins Meer und hieß den Kaufmann den selben auf papiernem Schiffe suchen und binnen drei Tagen zurückbringen, sofern ihm sein Kopf lieb sei.
Und der Jüngling ging traurig auf sein sonderbares Schiff und wollte verzweifeln, als die Schwanenjungfrau plötzlich wieder an seiner Seite stand und mit ihrer lieben Stimme sagte, er solle ihr das Haupt vom Rumpfe trennen, und es werde ihm geholfen werden.
Ob der entsetzlichen Zumutung schauderte der junge Mann und weigerte sich, die Tat zu vollbringen. Aber die Jungfrau bestand darauf, und als das Haupt hernieder rollte, fielen drei Blutstropfen in das Meer, und der goldene Ring kam sofort an die Oberfläche des Wassers, woraus auch die Schwanenjungfrau, herrlicher als je, emportauchte und in die Arme ihres Bräutigams eilte.
Hand in Hand gingen die zwei Glücklichen in das Haus des grimmen Schiffers, dessen ehernes Antlitz sich aber glättete beim Anblick der wunderholden Jungfrau; denn sie war seine eigene Tochter.
Und er gab sie dem Kaufmannssohn zur Frau und als Mitgift des Goldes die Fülle, und das junge Ehepaar zog in die Heimat des Gemahls, wo sie der alte Kaufherr segnend umfing.
(In Brigels erzählt)
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volksthümliches aus Graubünden
DIE ZWEI BRÜDER UND DIE VIER RIESEN ...

Vor vielen hundert Jahren, als es noch Riesen gab, waren einmal in Scarl zwei Brüder; Die mußten für ihre Eltern gar hart arbeiten und bekamen fast nichts zu Essen, aber viele Schläge. Das verdroß sie, und als sie einst im Walde waren, Holz zu sammeln, beschlossen sie, fortzugehen, in die weite Welt. Bei einem alten Tannenbaum sagten sie sich Lebewohl und versprachen sich, nach Jahresfrist dort wieder sich zu stellen.
Der Jüngere ging mutig in den dichten, dunklen Wald hinein. Gegen Abend kam er zu einem Baum, auf welchem vier Riesen ihre Behausung hatten. Das sind in den alten Zeiten gar grausame Leute gewesen und haben auch Menschen gefressen. Doch davon wußte der Junge nichts.
Er stieg hinauf und legte sich unter das große Bett; hineinsteigen konnte er nicht, es war ihm zu hoch. Nicht lange, so kamen die Riesen und legten sich neben einander in ihr Lager. Der drunter rührte sich nicht, und lauschte auf ihre Reden.
Der Erste sagte: »Ich weiß eine Mühle, nicht weit von hier; dort liegt ein Mädchen im Bette und das will ich fressen.« Der Zweite sagte: »Und ich weiß einen Baum, bei dem steht ein Holzhacker, und unter der Wurzel liegt ein großer Schatz, den will ich holen.«
»Und ich weiß ein Haus,« sagte der Dritte, »da müssen die Leute das Wasser weit her tragen; aber beim Haus ist ein Stein auf dem sitzt ein Frosch; da drunter ist eine Quelle, die will ich aufdecken und viel Geld damit gewinnen.«
»Aber ich«, rief der Vierte, »kenne ein Schloß, da ist ein König und dem seine Tochter ist krank, daß kein Doktor ihr helfen kann. Aber mit einem Apfel von dem Baum, wo wir sind, kann ich sie gesund machen, und sie soll meine Frau werden.«
Darauf schliefen die Riesen ein. Der Junge aber kroch leise hervor, brach einen Apfel vom Baum und kletterte geschwind hinunter. Spornstreichs eilte er zu der Mühle, weckte den Müller und sagte zu ihm: »Paßt heute Nacht auf; der Riese kommt, und will Euer Kind fressen.« -
Dann ging er zum Holzhacker, der fällte den Baum, welchen der Riese gemeint hatte. Er hieß den Mann nachgraben, und der fand einen großen Schatz und wollte mit dem Jungen teilen. Dieser nahm aber nur so viel, als er notwendig zur Reise brauchte. -
Darauf begab er sich zu dem Haus, wo die Leute kein Wasser hatten. Denen zeigte er den Stein mit dem Frosch, und deckte die Quelle auf, aber zum Lohn nahm er nichts an. -
Endlich kam er auf das königliche Schloß, dort war alles in tiefer Trauer wegen der kranken Prinzessin. Aber der König, ihr Vater, hatte eben eine Botschaft ausgehen lassen in alle Länder: Wer ihre Krankheit heben könne, dem wolle er sie zur Frau geben.
Da ließ der Junge sich zu ihr führen, und machte sie gesund mit dem Apfel. Da war große Freude im Schlosse und im ganzen Lande. Und der König und die Königin stellten ein großes Fest an und luden alle ihre Freunde und Bekannte dazu ein, und da wurde die Hochzeit herrlich und in Freuden gefeiert. -
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
HANS UND URSCHEL ...

Im Lande Rätien war ein Mann, der war arm, aber einen kräftigeren und schöneren fand man im ganzen Gebirge nicht. Und dieser Mann konnte auswählen unter den Töchtern der Berge. Aber er sah nicht auf Tugend, sondern auf Besitztum und Schönheit.
Der Mann war mildherzig und »gebig«, wie der Samariter, - sein Weib, das war aber geizig und »häbig«, wie ein heuchelnder Pharisäer. Er konnte dem Weibe nie zu viel arbeiten und zu wenig essen. Die Weiber der Nachbarschaft nährten reichlicher und pflegten besser ihre Hündlein.
Dies machte den Mann wehmütig und niedergeschlagen; er wünschte sich selber den Tod. Schönheit und Kraft entschwanden ihm, wie den Bäumen die welken Blätter, wenn der Winter mahnt. -
Einmal ging der Mann in den Wald, um Holz zu fällen für den Winter. Er hatte gearbeitet während vieler, vieler Stunden und nicht herum geschaut, um besser Mißgeschick und Hunger zu vergessen. Endlich brachte das reiche Weib ihm zum »Marend« ein Stücklein verschimmeltes Brod und eine sorgfältig ausgehöhlte Käsrinde. -
Das Weib legte diese in einen zerrissenen Lappen eingewickelte Mittagsmahlzeit auf die Erde, schaute um sich und schnurrte, auf ihren Mann sehend, »wie wenig Arbeit für das, was Du mir allein für das Essen kostest!« -
Er schwieg, der abgehungerte Mann, und eine Träne, so groß wie eine Haselnuß, rollte auf seine Hand herab. Sie aber kehrte ihm den Rücken zu und begab sich mit ihrem ausgemästeten Leibe nach Hause. -
Jetzt hob der Arme die Mittags Gabe seines Weibes von der Erde, setzte sich bei der nahen Quelle und erweichte das verschimmelte Brot und die steinharte Käsrinde, um sie besser kauen zu können. Und während er dies tat, flog ein Rabe mit seinem heiseren »Rock, Rock, Koa« über ihm durch die Lüfte dahin. -
»O Weib!« rief er aus, »möchtest Du nur für ein einzig Jahr in einen solchen Raben verwandelt werden, um durch Winterkälte und Hungerplage menschlich fühlen zu lernen!«
Kaum waren diese Worte seinen Lippen entgangen, als ein altes Weiblein vor ihm stand, gebeugt auf einen Stab. »Dein Wunsch ist erfüllt,« sprach die Alte freundlich ihn an. »Siehe, dort schwebt ein Rabe durch die Luft, dieser schwarze Geselle war Dein Weib, das Dich quälte durch Hunger und Gezänke.«
Und er blickte auf und hörte die Stimme seiner Urschel flehend: »Hans, ach Hans, vergib!«
Die Alte aber blickte den Hans an und sagte weiter: »Sie muß, wie Du es gewünscht hast, nun ein volles Jahr Rabe bleiben und Winterkälte und Hungerplage erdulden. Fliegt sie aber vor dieser Zeit vor das Fenster Deiner Wohnung und bittet um Einlaß und Nahrung, und Du wärst schwach genug, es zu gewähren, so ist sie erlöst und Du selbst mußt dann ein Jahr Rabe bleiben.« -
Grimmig kalt trat nun der Winter auf, Fluß und Sumpf waren mit Eis bedeckt. Die Vögel irrten herum und froren, und fanden keine Speise. Da setzte sich aufs Fenstergesimse ein hungriger Rabe und flehte um Einlaß und Futter.
Hans, mitleidig und »gebig«, öffnete dem armen Gast, ohne an das Weiblein im Walde zu denken, das Fenster. - Aber, gleich flog er selber als Rabe in die kalte Schneeluft hinaus. - Umsonst war sein Nahen und Bitten, - Urschel war geizig und »häbig« und öffnete nicht. -
Doch nach Jahreslauf kam Hans in seiner vorigen Gestalt. Urschel bereute, was sie früher getan. - Sie lebten fortan glücklich, wie Mann und Frau immer es sollten.
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
DAS BERGMÄNNLEIN ...
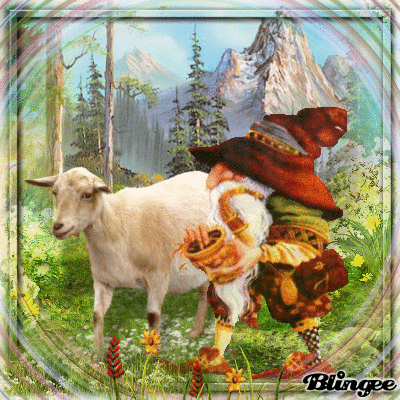
In Untervaz lebte einmal ein gar armer Mann, der hatte ein Weib und fünf kleine Kinder zu ernähren und zu kleiden, aber das wenige Land, das sein war, vermochte nicht, die Dürftigkeit zu decken. Eine baufällige Hütte war seine Wohnung, und eine einzige Geiß seine fahrende Habe.
Eines Abends kam aber die Geiß nicht von der Bergweide ins Dorf zurück. Wo sie geblieben, wußte der Hirte dem armen Mann nicht zu melden, versprach aber, am folgenden Tage eifrig nach ihr zu suchen, und am Abend dann heim zu treiben, wenn nicht ein Lämmergeier mit gewaltigem Flügelschlag sie in die Schlucht gestürzt habe, um sie dann stückweise seinen Jungen ins Felsennest zu tragen.
Mit Sehnsucht harrte der arme Mann dem kommenden Abend entgegen, denn es brach ihm das Herz, daß seine Kinder keine Milch mehr haben sollten. Der Abend kam, die Geiß aber nicht. Wie der Hirte auch nach ihr gesucht, hatte er sie nicht finden können. - Die Kinder weinten; Vater und Mutter waren untröstlich über den Verlust.
Mit Tagesgrauen machte der arme Mann sich auf, nahm etwas Lebensmittel in die Tasche, und stieg bergan, um selber die gute »Muttle« (Ziege ohne Hörner) zu suchen. Er durchging alle Gräte, suchte von Tobel zu Tobel, und so verging der Tag, ohne daß er das gute Tier gefunden hatte. - In einer Alphütte erhielt er freundliche Aufnahme.
Auch am folgenden Tage war sein Suchen ohne Erfolg. Hungrig, durstig und todmüde legte er sich unter einen Felsvorsprung, um dort auszuruhen, bevor er den Heimweg antrete.
Wie er so da lag, kam es ganz schwer über seine Augenlider, und er schlief ein; und der Gott der Träume hielt einen Spiegel vor das Auge seiner Seele, worin er sah, wie ein Männlein, in ein weites, grünes Mäntelein gehüllt, auf dem Kopfe ein spitzes, rotes Käpplein, seine verlorene »Muttle« an der Hand führend, vor ihn her trat, wie aber die »Muttle« über und über mit Schneckenhäuslein und Muschelschalen behängt war, - wie dann das Männlein ein Tüchlein aus Bergflachs vor ihm ausbreitete, ganz kleine Gemskäslein auf das selbe legte, und eine Kristallschale dazu stellte.
Durch ein melodisches Tönen und Klingen, das vorüber schwebte, wurde der Schlafende geweckt, und er richtete sich auf, rieb sich die Augen, blickte um sich, und schaute alles, was als Traumbild vor seiner Seele gestanden: - Da stand die Geiß leibhaftig und blickte mit glänzenden Augen freundlich ihn an, meckerte vor Freude, und schüttelte sich, daß die Schneckenhäuser und Muschelschalen, mit denen sie behängt war, sich bewegten, und einen sonderbaren Ton von sich gaben. -
Auch das schneeweiße aus Bergflachs künstlich gewebte Tüchlein war da, auch die Käslein und die Kristallschale, angefüllt mit Gemsmilch. Der arme Mann war außer sich vor Freude, die gute »Muttle« wieder zu haben, freute sich auch über die Muscheln, die er dem Tier abnehmen, und den Kindern heimbringen wollte. Dann ergriff er die Schale, trank die Gemsmilch, aß nach Herzenslust von dem schönen Käslein auf dem Tüchlein und schickte sich an, mit der Geiß das heimatliche Dach zu gewinnen.
Da trat plötzlich das Männlein, das er im Traum gesehen, wirklich her, im grünen Mäntelein und roten, spitzen Hütchen; das sprach zu ihm: Trage Sorge zu all dem, was die Geiß an sich trägt, und was noch in den Haaren steckt, löse daheim alles ab, lasse es die Nacht über auf dem weißen Tüchlein auf dem Tische liegen. -
Am Morgen wäge alles, lasse es wohl schätzen, dem Wert nach, verkaufe davon, was Du willst, und halte dann die Spende gut und weise zu Rate. Das Tüchlein und die Schale bewahre aber auf, und gib sie niemandem. -
Hast Du dann ein schönes Heim und ein eigenes Maysäß, und ziehst Du hinauf in das selbe, - dann breite alle Abende das Tüchlein auf ein Tischchen vor der Hütte, und stelle die Schale mit frischem Rahm darauf. - Hüte Dich aber, nachzusehen, wer den Rahm trinkt. -
»Tust Du das so, wie ich Dir sage, so wirst Du stets fort Segen und Glück haben.« - Mit diesen Worten verschwand das Männlein, geheimnißvoll, wie es gekommen war. -
Als der Vater mit der Geiß heim kam, sprangen die Kinder ihm entgegen, und hüpften vor Freude, daß die liebe »Muttle« wieder da sei. Mit den Schneckenhäusern und Muschelschalen tat der Mann, wie er ihn geheißen, und fand am Morgen statt der selben - Gold und Silber; die in den Haaren der Geiß gesteckt hatten, waren zu glänzenden Perlen und Edelsteinen geworden.
Da er aber mit solchen Sachen bis anhin in keinerlei Berührung gestanden hatte, ließ er den greisen Joos Flury kommen, der schon in der Fremde gewesen war, und der ihm den unermeßlichen Wert seines Schatzes bedeutete. -
Von Gold und Silber hatte der Arme schon sagen gehört, aber von Perlen und Edelsteinen noch nie ein Wort vernommen. Er ging nun mit Flury zu einem ehrlichen Goldhändler, und zeigte ihm einige Stücke des Gottes Geschenkes.
Der Händler fand das Mitgebrachte als reines Gold und Silber, kaufte den ganzen Schatz, und aus dem Erlös konnte der Glückliche ein schönes Heimwesen kaufen, und Kühe und Geißen; aber die gute »Muttle«, die ihm zum Glücke verholfen hatte, blieb ihm von allem doch das Liebste. -
Oben in den Bergen kaufte er das schöne Maysäß Artaschiew, und dort erfüllte er getreulich das Gebot des Männleins. Als die Leute sahen, wie der, vorhin so arme Mann nun steinreich geworden, und in allem was er anfing, Glück hatte, und seine Habschaft von unsichtbarer Hand vor aller Gefahr beschützt, so trefflich gedieh, sagte einer zum anderen: »Der steht in Gunst und Bund mit dem Bergmännlein.«
Rätoromanien: Dietrich Jecklin: Volkstümliches aus Graubünden
DAS KORNKIND ...
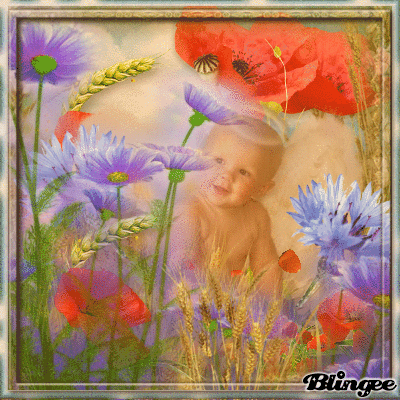
Ein Bauer ging durch den Wiesengrund hinter dem Dorf, dem Hügel zu, auf welchem das Kornfeld lag. Es war Frühling, das erste grüne Gras sproßte gerade hervor, und von den Bäumen fielen die Blüten darauf wie eitel Schneeflocken; am Abhang sah er die Reben weinen, und als er auf der Höhe angekommen war, standen die Halme auf dem Acker da, daß es eine helle Freude anzusehen war.
Dem Bauer ging es durchs Herz, daß er fast laut aufgejauchzt hätte. Da sah er auf einmal mitten in den Fruchthalmen ein kleines wildfremdes Kind liegen, das war gar wunderlieblich, und es sah ihn mit großen Augen so beweglich an und streckte die Ärmchen nach ihm aus, als wollte es sagen: Bitte, nimm mich mit nach Haus, ich hab ja sonst niemand auf der Welt.
»Ja«, sagte der Bauer, nachdem er sich von seinem Erstaunen erholt hatte, »ich will dich mit heim nehmen; hat der grundgütige Gott den Frühling so schön gemacht, so wird er wohl auch die Ernte nicht fehlen lassen; und für so einen kleinen Schnabel mehr läßt er es diesmal schon wachsen.«
Damit wollte er das Kind aufheben; aber da war es, wie wenn es an die Erde genagelt wäre; er brachte es nicht von der Stelle. Nun rief er alle Bauern herbei, die auf dem Feld zu sehen waren, und einer nach dem anderen versuchte, das Kind vom Boden aufzunehmen; aber alle nach einander mußten davon abstehen.
Da ging mit dem Kind allmählich eine sonderbare Verwandlung vor: Zuerst bekam es goldgelbes Haar, dann wurde sein ganzer Kopf wie lauter Gold, und endlich strahlte sein ganzer Leib in goldigem Schimmer. Das fremde Kind war ein Engelein geworden und fing mit einem feinen Stimmlein an zu sprechen und sagte zu dem Bauer:
»Weil du dich meiner erbarmt und dem lieben Gott vertraut hast, so soll die Ernte und der Herbst noch viel schöner werden als es jetzt aussieht.« Und als es das gesagt hatte, flog es vor seinen Augen auf und verschwand im blauen Himmel.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER GLASBRUNNEN ...
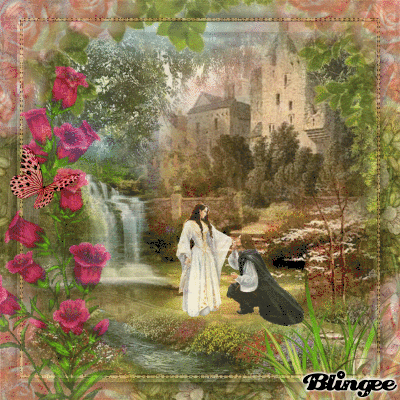
Auf einem Schlosse wohnte eine Jungfrau, die war so schön, man konnte auf der Welt nichts Schöneres sehen. Sie hatte dunkelbraune Haare, und ihre Augen waren so glänzend schwarz, daß man fast so wenig darein blicken konnte, wie ins liebe Sonnenlicht.
Die Jungfrau hatte aber ein hochmütiges Herz, und alle Freier, die auf das Schloß kamen, wies sie schnöde von hinnen; und wenn es die reichsten Grafensöhne waren, so wurden sie doch nur eine Zeit lang zum Besten gehalten und dann unter Hohn und Spott verabschiedet wie die anderen, auf nimmer Wiedersehen. Das ging nun so, so lang es ging.
Eines Tages kam ein Jüngling, der gefiel der Jungfrau heimlich über die Maßen wohl. Ihr stolzes Herz ließ ihr aber nicht zu, daß sie es gestanden hätte; und so ließ sie ihn Geschenke auf Geschenke, eines prächtiger und reicher als das andere, auf das Schloß bringen und wies ihn jedesmal mit künstlichen Worten ab, so oft er sie bat, daß sie jetzt seine Braut werden möchte.
An einem Abend saßen die beiden zusammen im Walde nahe bei einer Quelle, die tief aus einem moosigen Felsen heraus sprudelte. Da sagte die Jungfrau zu dem Jüngling: »Ich weiß, Ihr könnt mir keinen Fürstenthron zum Brautschatz schenken; gleichwohl will ich Eure Braut sein, wenn Ihr mir an der Stelle des Dorngebüsches, das hier diese Quelle verdeckt, ein Wasserbecken von Edelsteinen herrichtet, die so rein sind wie Glas und so lauter wie das Wasser, das da rein fließt.«
Nun fügte es sich, daß die Mutter des Jünglings eine Fee war; und als er ihr noch am gleichen Tag erzählte, was die Jungfrau auf dem Schlosse von ihm verlangte, da erstellte sie über Nacht ein Brunnenbecken in dem Wald, das überstrahlte in Blau und Gelb und Karmesin alle Blumen.
Am anderen Morgen sagte die Jungfrau zu dem Jüngling: »Etwas habt Ihr getan; es ist aber noch nicht alles, was ich billig verlangen kann. Zu dem Brunnenbecken gehört ein Garten; den müßt Ihr mir noch an die Stelle des Waldes setzen, sonst kann ich Eure Braut nicht sein.«
Das sagte der Jüngling wiederum seiner Mutter; und als am Abend die Jungfrau an dem Brunnen saß, da sproßte es rings um sie her veilchenblau und rosenrot auf, und in einem Augenblicke war der ganze Wald ein Garten; der Boden war mit Millionen Blumen übersät und in den Büschen sangen und hüpften wilde und zahme Vögel, daß es eine Freude war.
Der Jungfrau lachte bei diesem Anblick das Herz, und als nun der Jüngling her zu kam, so wäre sie ihm beinahe um den Hals gefallen und seine Braut geworden; allein auf einmal fielen ihre Augen auf ihr Schloß, das sich nun gar alt und seltsam ausnahm neben dem prächtigen Garten mit dem funkelnden Glasbrunnen.
Da sagte sie: »Der Garten gefällt mir; es ist aber noch nicht alles, was ich billig verlangen kann; an die Stelle des alten Schlosses müßt Ihr mir eins von Rubin und Perlen erbauen, sonst kann ich Eure Braut nicht sein.«
Als der Jüngling diese Rede seiner Mutter wieder hinterbrachte, da wurde die Fee von Zorn erfüllt; im Augenblick war der schöne Garten verschwunden und das alte Waldgestrüpp wucherte wieder fort; nur der schimmernde Glasbrunnen blieb, und daran saß jetzt die Jungfrau alle Abend und wartete mit Sehnsucht auf den Jüngling; aber dieser blieb fort; denn seine Mutter hatte ihm das stolze Herz der Jungfrau geoffenbart; und wenn sie nicht gestorben ist, so sitzt sie noch dort.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER SCHNEIDER UND DER SCHATZ ...

Ein Schneider, der gern in Samt und Seide prangte, den Jungfrauen schön tat und am liebsten war, wo es recht toll und lustig herging, war einmal zu einem Taufschmaus über Feld gegangen. Als er nun um Mitternacht sich auf den Heimweg machte, da merkte er, daß er diesmal zu tief ins Glas geguckt hatte, und geriet als bald weit von der Straße ab.
Nicht lange, so sah er rechts und links nur Baum an Baum, hinter sich nichts als Dornen und Moorland, und vor sich eine senkrechte Felswand mit einer Spalte, gerade weit genug, um einen Menschen durchzulassen. »Halt!« dachte der Schneider, »hier kommst du ohne ein Abenteuer nicht weg. Also frisch drauf los!« Und weil ihm der Taufwein einen überschüssigen Mut gegeben hatte, so trat er beherzt in die Höhle, tappte darin herum und suchte eine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen und die Nacht verbringen konnte.
Aber kaum war er ordentlich drinnen, so huschte ein Hund unter seinen Füßen auf, und der Schneider fiel, so lang er war, gegen eine eiserne Türe, die plötzlich aufsprang. Hui, war das aber eine Pracht! Was der Schneider jetzt vor sich sah, hatte ihn auf einmal nüchtern gemacht; er stand und guckte mit offenem Maul in ein hell erleuchtetes Gemach; keine Kerze, keine Lampe, nein, das lautere Gold und Silber der Wände und unzählige eingelegte Edelsteine wandelten die Finsternis in sonnenhellen Tag um.
An den Wänden standen kostbare Schreine mit Prunkgeschirr und mitten im Saal stand eine offene Kiste voll funkelnder Goldmünzen. »Warum nicht gar?« sagte der Schneider anfangs, als er den Kram erblickte; aber es ging nicht lange, so trat aus einer Seitentüre eine wunderliebliche Jungfrau in den Saal; die hieß ihn mit freundlicher Stimme willkommen.
Da gewann der Schneider erst alle seine Besinnung wieder und ging ohne Umstände auf die Jungfrau zu, um ihren Gruß mit einem Kuß zu erwidern.
Aber die Jungfrau blickte ihn so streng an, daß er wie angenagelt stehen blieb, und sagte: »Ich habe dich freilich schon lange erwartet; denn für dich habe ich alle Schätze, die du hier siehst,
aufgespeichert. Aber du bekommst sie nur unter der Bedingung, daß du mich dreimal küssest ohne zu wanken.«
»Ei wer wollte das nicht!« rief der Schneider und spitzte den Mund; im gleichen Augenblick war aber die Jungfrau in ein abscheuliches Krokodil umgewandelt, und wäre der Schneider nicht schon im Anlauf gewesen, so hätte er den Kuß wohl bleiben lassen. So aber verrichtete er denselben fast wider Willen und schüttelte sich hernach am ganzen Leib.
Im Nu stand wieder die Jungfrau da und sah ihn mit so freundlichen Blicken an, daß er zum zweiten Mal zum Küssen ausholte. Da verwandelte sich die Jungfrau vor seinen Lippen in eine garstige dicke Kröte; es schüttelte den Schneider wieder, aber er drückte gleichwohl beherzt den Kuß auf das Krötenmaul. Und jetzt stand wieder die Jungfrau da und lächelte ihm noch viel lieblicher zu als das erste Mal, so daß er noch mutiger zum dritten Kuß sich anschickte.
Aber o weh! Diesmal zitterte und bebte der Schneider bis ins Mark hinein, denn vor ihm stand lang behaart und meckernd ein kohlschwarzer Ziegenbock und glotzte ihm entgegen; Angst und Graus kam über ihn und er entfloh mit großen Sprüngen aus dem Saal und aus der Höhle; eine Windsbraut fuhr hinter ihm drein und es toste und krachte dabei, daß ihm Hören und Sehen verging und er todmüde vor dem Felsen nieder fiel.
Als er sich wieder aufraffte, konnte er die Öffnung in der Felswand nirgends mehr finden; er schlich also traurig davon und konnte hernach sein Lebtag nimmer von Ziegenböcken reden hören, ohne in Zorn zu geraten.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER EINFÄLTIGE GESELLE ...

Drei wandernde Gesellen kamen überein, sie wollten alle Dinge gemeinsam haben; Speis und Trank, Nutzen und Schaden wollten sie miteinander teilen. Zwei davon hatten es aber hinter den Ohren und hielten heimlich zusammen, daß sie den dritten, der ein einfältiger Geselle war, über den Löffel barbierten.
Als sie ein paar Tage miteinander gegangen waren, kamen sie in eine einsame Gegend und verloren den Weg. Da litten sie große Not; alle Nahrung war ihnen ausgegangen, und es war nur noch etwas Mehl da, davon beschlossen sie einen Kuchen zu backen.
Während aber der Einfältige das Feuer dazu anzündete, ratschlagten die zwei Schälke, wie sie es vorkehren möchten, daß sie den Kuchen unter sich allein teilen und den Einfältigen um sein Teil betrügen könnten. Da sagte der eine: »Weißt du was, Bruderherz? Wir machen ihm den Vorschlag, daß wir alle drei schlafen wollen, bis der Kuchen gebacken ist; wenn wir aufwachen, soll ein jeder erzählen, was ihm geträumt hat; und wer dann den wunderlichsten Traum erzählen kann, dem soll der Kuchen gehören.« Gesagt, getan.
Die zweie schliefen allso gleich ein; den Einfältigen hielt dagegen der Hunger wach; und kaum sah er, daß der Kuchen gebacken war, so machte er sich herzu und aß ihn auf; es ist kein Brosamlein übrig blieben. Hernach legte er sich aufs Ohr.
Als bald wachte der eine der Schälke auf und rief seinem Kameraden zu: »Freue dich, Bruderherz! Mir hat Wunderliches geträumt; denke dir: es war mir, als ob ein Engel mit goldnen Flügeln mich vor Gottes Thron mitten ins Himmelreich geführt hätte.«
Da sprach der andere: »Ei! Und mir hat geträumt, der Teufel habe mich in die Hölle hinabgeführt und mir da der armen Seelen Pein gezeigt. Was kann einem Wunderlicheres träumen! Der Kuchen ist unser.« Hierauf weckte er den Einfältigen mit dem Ellenbogen auf und sagte: »Wie lange willst du noch schlafen? Sag her, was hat dir geträumt?«
»He da«, rief der Einfältige und streckte sich, »wer ruft mich?« »Ei, wer sonst als deine Gesellen?« »Aber«, fragte er wieder, »wie seid ihr denn wieder hergekommen?« »Wo sollten wir gewesen sein?« sagte der andere? »Ich glaube, guter Freund, es ist nicht ganz richtig in deinem Oberstübchen.«
»Freilich ist es«, antwortete der Einfältige; »aber da hat es mir so kurios geträumt; ich habe die hellen Tränen um euch geweint, weil ich meinte, ich hätte euch schon verloren; es träumte mir, einer von euch sei ins Himmelreich gefahren und der andere ins Teufels Revier; dieweil man aber noch selten von einem gehört hat, daß er von diesen Gegenden wieder heimgekommen sei, so hab ich mich dessen getröstet so gut ich konnte und in Gottes Namen den Kuchen aus dem Feuer genommen und gegessen. Nehmt nichts für ungut.«
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER JUNGE HERZOG ...
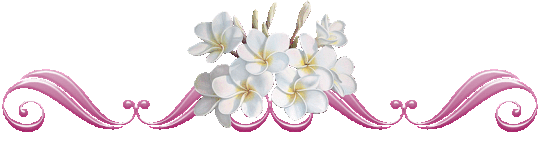
Es war einmal ein junger Herzog, der war so fromm und gottesfürchtig, daß er am liebsten gleich gestorben und nach dem Himmel gewandert wäre. Seine Mutter aber hätte ihn gern an eine Prinzessin verheiratet, und weil er denn auch ein guter Sohn war, so willigte er endlich in den Wunsch seiner Mutter ein und setzte den Tag seiner Hochzeit fest.
Am Hochzeitsmorgen erschien aber ein Jüngling im Schloß, von schönem Wuchs und Ansehen, und bot ihm seine Dienste an als Koch, aber nur über das Hochzeitsfest. Der Herzog fand Gefallen an ihm und alle Leute am Hof verwunderten sich über sein feines Benehmen; und als er erst eine Probe von seiner Kochkunst abgelegt hatte, da wollte der Herzog ihn gar nicht mehr fort ziehen lassen.
Allein schon des Nachmittags sagte der Jüngling, seine Stunde sei gekommen, er müsse nun wieder nach Hause gehen! Also wollte ihm der Herzog noch eine Strecke weit das Geleit geben. Wie sie nun unvermerkt unter allerlei Reden weiter und weiter gegangen waren, standen sie mit einem Mal mitten auf einer grünen Heide, welche ganz mit Rosen und Rosmarin bewachsen war, und die Luft war allenthalben voll Balsamduft.
Unter einem Palmbaum hielt ein weißes Maultier und graste; das löste der Jüngling also bald ab und bat den Herzog, er möchte sich auf das selbe setzen. Der Herzog setzte sich darauf und der Jüngling nahm selbst hinter ihm Platz.
Da war es dem Herzog, als ob sie durch die Lüfte schwebten; bald sah er in der Ferne eine prächtige Stadt schimmern; und als sie an das Tor kamen, war das selbe von oben bis unten mit Edelsteinen besetzt; und es öffnete sich von selbst; und als sie in die Stadt kamen, war es so hell und glänzend drinnen, wie wenn tausend Sonnen scheinen würden; von allen Seiten erklang Gesang und Musik und durch die Straßen, die mit purem Gold gepflastert waren, zogen weiße Jungfrauen mit Blumenkränzen um die Stirne und begrüßten den Herzog.
Das gefiel ihm so wohl, daß er gar nicht mehr fort wollte. Allein am dritten Tag sagte der Jüngling zu ihm, nun sei auch seine Stunde gekommen, er müsse nun wieder nach Hause gehen, werde aber wohl bald wieder hierher kommen dürfen. Also trug das weiße Maultier den Herzog wieder den gleichen Weg zurück, und der Jüngling begleitete ihn bis zu dem Palmbaum in der grünen Heide; als er aber von hier betrübt den Weg nach seinem Schlosse einschlug, sah er in der Ferne an der Stelle, wo das Schloß gestanden hatte, ein altes Kloster; verwundert trat er hinzu und fand die Pforte verschlossen; er klingelte, und ein Klosterbruder in langem, schwarzem Gewand trat hervor.
Der Herzog fragte ihn: »Was tut Ihr hier, lieber Bruder? Bin ich denn nicht auf dem rechten Weg nach dem Schloß? Vor drei Tagen bin ich ausgegangen und finde mein Schloß nicht mehr, auf dem ich doch Herr und Meister bin.« Der Klosterbruder machte große Augen und sagte: »Ein Schloß ist hier weit und breit nicht; in unserm Kloster aber regiert der Abt; kommt nun her, er wird es Euch selber sagen.«
Der Herzog folgte dem Bruder; und als der Abt die Geschichte von dem Herzog und seinem Ausgang aus dem Schloß erfuhr, da holte er eine alte Chronik aus der Bücherei des Klosters und schlug darin ein paar vergilbte Blätter herum, und dann zeigte er dem Herzog Wort für Wort, daß seine Geschichte da drin verzeichnet stand und daß es nun gerade dreihundert Jahre her seien, daß er mit dem Jüngling aus seinem Schlosse gegangen; sein Schloß aber sei längst dem Erdboden gleich gemacht und seine Gemahlin und Mutter samt allen übrigen Bewohnern des Schlosses lange verstorben.
Das ganze Kloster wollte nun die endliche Wiederkunft des Herzogs festlich feiern und ein großes Freudenmahl wurde angerichtet, bei welchem der Herzog oben an sitzen mußte. Kaum hatte er aber ein Stücklein Brot in den Mund genommen, so schrumpfte er zusammen und wurde ein uraltes, eisgraues Männlein und war im selben Augenblick tot.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DAS KNÖCHLEIN ...
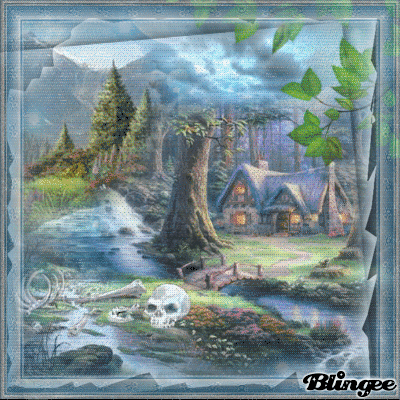
Vor vielen Jahren wohnte ein böser Mann in einer Sennhütte und brachte da selbst wie die anderen Hirten mit seinem Vieh den Sommer zu. Er war jähzornig und übermütig, und einen armen Jungen, der bei ihm diente, quälte er auf jede erdenkliche Weise mit schwerer Arbeit, rauen Worten und grausamen Schlägen.
Eines Tages trug er ihm ein Geschäft auf, zu welchem der Knabe nicht genug Kräfte besaß; da geriet er in solchen Zorn, daß er ihn ergriff und mit dem Kopf in den Kessel tauchte, worin er eben die Milch sott, um sie zu scheiden. So starb der Knabe, und der Senn warf den Leichnam in den Wildbach; daheim aber sagte er: »Der dumme Bube muß von einem Fels herab gestürzt sein; denn er ist fort gegangen, um die Geißen zu melken, und nicht wieder zurück gekommen.«
Nun vergingen viele Jahre; das Gebein des Knaben hing ungerächt an einem Felsen des Wildbaches; und von Zeit zu Zeit, wenn eine stärkere Welle vorbeirauschte, nahm sie eins von den Knöchlein mit fort, spielte eine Weile damit und ließ es dann etwa an einem einsamen Ufer liegen.
Einmal traf es sich aber, daß im Tal Kirchweih war, wobei es lustig zuging und der böse Sennhirt von Wein, Musik und Tanz betäubt war, so daß er alle Demut und Vernunft von sich tat und in seiner Sündentorheit wild dahin taumelte. Es war ihm drinnen zu heiß; drum ging er an den Bach hinaus, der eben von einem starken, warmen Regen angeschwellt stärker als sonst vorüberrauschte, kniete daran nieder und zog den Hut ab, um sich Wasser zu schöpfen.
Er trank aus, was hinein gelaufen war; auf dem Grunde aber fand er ein weißes Knöchlein, das steckte er auf seinen Hut und ging so in den Saal zurück. Da fing das Knöchlein auf einmal an zu bluten; und man wußte nun, wohin der Knabe gekommen war; das Fest nahm schnell ein Ende und der Bösewicht wurde bald hernach auf den Richtplatz geführt.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER BRÄUTIGAM AUF DEM WASSER ...
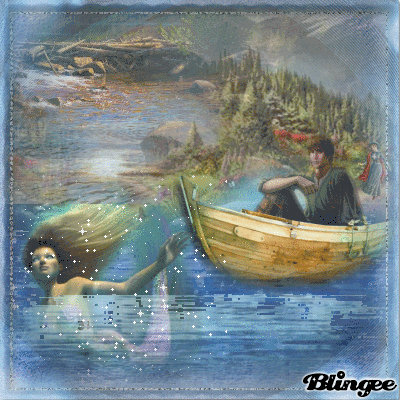
Ein Jüngling saß in einem Nachen auf einem breiten, reißenden Strom und ruderte nach dem jenseitigen Ufer, denn dort stand seine Braut und wartete auf ihn. Als er in die Mitte des Stromes kam, vernahm er einen jämmerlichen Hilferuf; und als er hin blickte, da war es ein altes Weib, das war verunglückt und kämpfte mit den Wellen, die es ins nasse Grab hinunter schlingen wollten.
Er kehrte sich aber nicht daran, sondern warf nur einen flüchtigen Blick hin und eilte, hinüber zu kommen. Die Stimme klang immer flehentlicher, aber schwächer und schwächer. Die Alte schwamm
vorüber, hinab, und ihr Rufen verstummte.
Doch plötzlich, wenige Klafter von dem Fahrzeug entfernt, tauchte sie leicht wie ein Nebelgebilde wieder aus den Wellen empor, und war kein altes Weib mehr, sondern die schönste aller Jungfrauen,
noch weit schöner als seine Geliebte, die auf ihn wartete und ihm winkte.
Da ergriff ihn eine unwiderstehliche Sehnsucht und entzückte ihm seine Sinne dergestalt, daß er der harrenden Geliebten vergaß und hinab fuhr, der Unbekannten nach, die immerfort in der gleichen Entfernung vor seinen Augen spielend wie ein Schwan dahin schwamm und nicht auf seinen Zuruf hörte, sondern nur von Zeit zu Zeit ihr bezauberndes Antlitz nach ihm umwandte.
Der Jüngling fuhr Tage, Wochen und Jahre stromabwärts, aber die Jungfrau vermochte er nie zu erreichen, und so fährt er noch immer zu, bis in die Ewigkeit hinein.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE ERLÖSUNG ...
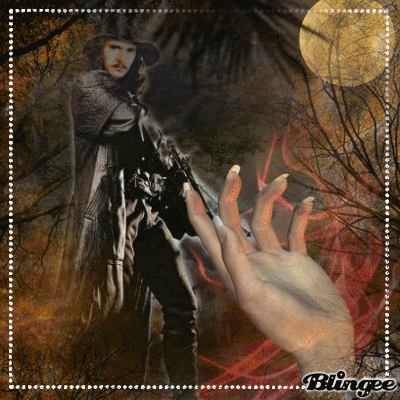
Ein Jäger schritt durch einen dunklen Wald und geriet unversehens so tief in das Dickicht hinein, daß er nicht mehr wußte, ob es Tag- oder Nachtzeit war. Da sah er eine bleiche Nebelgestalt daher kommen, die winkte ihm und streckte ihm ihre weiße Hand entgegen.
Erst war der Jäger erschrocken und meinte nichts anderes, als daß es ihm an das Leben gehen müßte. Aber bald faßte er wieder Mut, und es war ihm, als dürfe er die dar gebotene Hand nicht zurückweisen. Wie er also keck die zarte Hand ergriff, war es, wie wenn er lauter Eiszapfen anrührte, und im gleichen Augenblick standen die Bäume ringsumher in Feuer; Schlangen zischten auf, und das Geheul der Wölfe und anderer reißender Tiere erschallte ganz in der Nähe.
Aber der Jäger hielt nur um so kräftiger die kalte Hand fest und wankte um keinen Schritt von der Stelle. Bald war es auch wieder stille und dunkel wie vorher. Da kam ein graues Männlein und winkte dem Jäger auf die Seite; es trug an seinem Arm ein Körbchen, das von hellem Diamant und bis zu oberst mit glitzerndem Gold angefüllt war; das gab zusammen einen so hellen Schein wie die Sonne.
Aber der Jäger hielt noch immer die Hand fest und blieb unbeweglich stehen. Da sprang plötzlich ein Wolf vorbei, der hatte ein Kind im Rachen, das der Jäger mit Schrecken als seines erkannte.
Aber er lief ihm nicht nach, denn es war ihm, als täte er eine rechte Sünde, wenn er die Hand fahren ließe. Als nun der Wolf verschwunden war, da wurde die kalte Hand mit einem Mal warm und lebendig und in der bleichen Gestalt erblickte der Jäger eine liebliche Jungfrau.
Die lächelte ihn an und sprach: »Du hast mich aus einem schweren Bann erlöst, und weil du so treulich hast ausgehalten, so sollst du belohnt werden.« Sie reichte ihm ein Körbchen, und das war das nämliche, womit ihn das graue Männchen hatte verführen wollen.
Das leuchtete dem Jäger aus dem finstern Wald heraus, und von da an war er ein reicher Mann und lebte glücklich und vergnügt bis an sein Ende.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE DREI SCHWESTERN ...
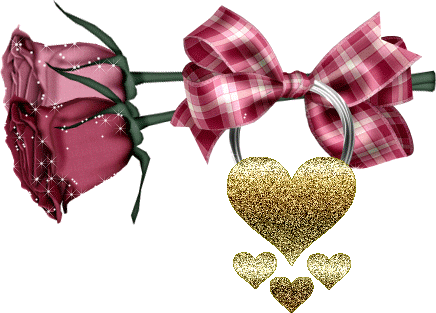
Auf den Fideriser Heubergen stand ein kleines Häuschen, in welchem drei Schwestern wohnten. Eine von ihnen war schneeweiß, schön und gut; die andere eine böse schwarze Hexe; die dritte halb weiß und halb schwarz, halb gut und halb bös.
Wenn die Hexe den Leuten im Tal Unheil anrichten wollte, und die Gute es durch Rat und Warnung zu verhindern suchte, dann trat allemal die Mittlere zwischen sie und bewirkte, daß die Hälfte des Unheils zugelassen und die andere Hälfte abgewendet wurde.
Einst machten die Fideriser Burschen und Mädchen eine Bergpartie und wurden in der Nähe des Häuschens der drei Schwestern vom Regen überfallen. Die Gute erbarmte sich der jungen Gesellschaft und lud die Durchnäßten in die Stube. Sie wollte ihnen Küchlein backen; aber die Hexe stieß sie aus der Küche und buk der Gesellschaft selber Küchlein, die von außen schön goldgelb wurden, inwendig aber giftig waren.
Das verdroß die Gute und sie weinte. Die Mittlere kam dazu, buk aus grobem Hausmehl grobe braune Küchlein und sagte zur Guten: »Wir stellen beide, die goldgelben und die braunen, den Gästen vor; die Eigennützigen werden die schönen giftigen essen und sterben; die Bescheidenen hingegen die braunen, und ihnen wird nichts geschehen; so geht es halb und halb wie immer.«
Die Hälfte der Gesellschaft, die von den goldgelben aß, starb; die bessere Hälfte kehrte von der Guten reich beschenkt nach Hause.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER STARKE HANS ...
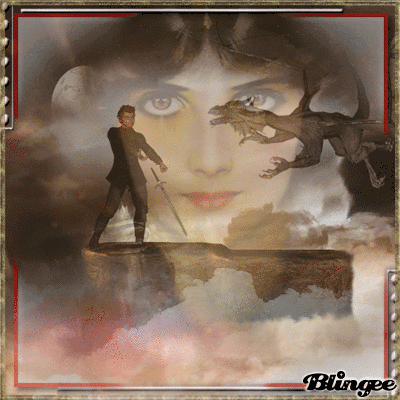
Es war einmal eine große Frau, die große Beth, die hatte einen Buben, der, ob schon er erst sieben Jahre alt war, schon der starke Hans hieß. »Wir sind arme Leute«, sagte die Mutter einst zu ihm, »drum mußt du bei Zeiten arbeiten und fremdes Brot essen lernen. Die Bauern nehmen ohnedies nur starke Leute in den Dienst. Geh also in den Wald und bringe mir eine tüchtige Tracht Holz heim, dann will ich dir sagen, ob du in die Fremde taugst.«
Hansli tat es, traurigen Herzens über den ihm so nahe stehenden Abschied; und wie er seine Bürde Holz heimbrachte, war sie gar klein. Darüber wurde er und die Mutter froh, denn er war noch zu schwach und durfte noch weitere sieben Jahre daheim bleiben. Als diese um waren, wurde er zum zweiten Male ins Holz geschickt. Jetzt aber war es anders mit ihm. Die Tannen riß er aus, als ob es Stauden wären, und heimgetragen brachte er sie wie einen Federwisch.
Jetzt hatte die Mutter auf ein ganzes Jahr Brennholz genug, und Hans konnte nun sein Ränzel schnüren und dem nächsten Bauernhof zuwandern. Hier waren schon zwei Knechte im Dienst und man brauchte keinen dritten. Der Hans aber wurde dennoch angenommen, denn er verlangte vom geizigen Bauer keinen Lohn, sondern statt dessen nur das Recht, alljährlich eine Ohrfeige austeilen zu dürfen.
Die erste Arbeit, bei der er mit half, war im Walde; es wurde Holz gefällt und heimgefahren. Aber der Wagen war bereits überladen und die Rosse brachten ihn nicht vom Fleck. Da warf Hans die Rosse zu den Baumstämmen auf den Wagen hinauf und brachte ihn wie im Sturmwind vors Haus gerollt.
Der Bauer sah es, kratzte sich in den Haaren und dachte mit Schauder an die Jahresohrfeige. Aber er ließ sich nichts merken, sondern setzte sich mit Hans zu Tische. Hier tat Hans abermals das Seine, der Bauer kratzte sich abermals in den Haaren, denn dieser Knecht würde ihn binnen Jahresfrist von Haus und Hof essen.
Nun fiel ihm ein, wie er sich seiner entledigen könnte. »Meine Frau«, sagte er zu ihm, »hat vor etlichen Tagen ihren Ehering draußen in den Ziehbrunnen fallen lassen, steig hinunter und hol ihn wieder herauf.« Hans tat es. Kaum war er drunten, so schüttete der Bauer mit seinen Knechten eine ganze Ladung Steine hinab.
»Weg mit den Hühnern da droben«, rief eine Stimme herauf, »sie scharren Sand in den Brunnen!« Der Bauer mußte zu einem gewichtigeren Mittel greifen; er ließ die Glocke aus der Kapelle herab nehmen und in den Brunnen werfen, die mußte den ganzen Hans zudecken.
»Ei, was für ein artiges Käppchen für mich!« lautete es zum zweiten Mal aus der Tiefe herauf. Jetzt gab es keinen anderen Rat, als den Mühlstein hinab zu lassen. - »Halt!« schrie der drunten, »da habe ich ja den Ehering; geht mir aus dem Licht droben, ich komme!« Die Glocke auf dem Kopfe und den Mühlstein am Ringfinger kam Hans herauf gestiegen.
Der Bauer dachte abermals an die einbedungene Ohrfeige und schenkte dem Hans nun so viel Geld und Gut, als dieser brauchte, um weiter in die Welt zu ziehen.
Seines Weges gehend fand er zwei Kameraden, einen Jäger und einen Fischer, die ohne Dienst waren wie er. Er wanderte einen Tag mit ihnen, doch statt Dörfer und Herbergen trafen sie nichts als ein kleines wunderliches Haus. Es war unbewohnt und sie übernachteten hier.
In aller Frühe weckte sie der Hunger. Nichts als ein Kochkessel und ein geringes Stück Fleisch war hier vorrätig, dies genügte nicht für alle drei. Der Fischer sollte es ans Feuer tun und kochen, indessen gingen der Jäger und Hans in den Wald, um besseren Vorrat herbei zu schaffen. Unser Koch hing den Kessel übers Feuer - da schlich ein kleines, häßliches Weib herzu. Sie hatte ein rotes Jüpplein an und auf dem Kopf eine Beginenhaube und bat flehentlich um ein winziges Stücklein Fleisch.
Der gute Fischer bückte sich schon, ihr ein Stück im Kessel abzuschneiden, da, husch, saß sie ihm auf dem Rücken, drückte und ritt ihn, und zerkratzte ihm jämmerlich das Gesicht. Er kroch zuletzt unter den Herd hinunter. Die Alte verschwand, das Feuer ging aus.
Gegen Abend kamen die beiden Kameraden heim. Glücklicherweise hatten sie einen Bären erlegt, und hatten nun, nachdem er ausgeweidet, zerlegt und gekocht war, doch etwas zu essen.
Der Morgen kam, und nun ging der Fischer mit dem Hans auf die Jagd, der Jäger hütete das Haus und besorgte das Essen. Darüber geschah ihm, was man schon weiß. Die Alte in der roten Jüppe kam herbei geschlichen, und während er ihr ein Stück Fleisch abschnitt, sprang sie ihm auf den Rücken, zerkratzte ihn und warf ihn zum Schlusse unter den Herd.
Da lag er noch drunten, als die zwei anderen abends heimkamen und nach dem Essen fragten. - So kam der dritte Tag. Keiner der Geprügelten hatte indessen den anderen ein Wörtchen verraten, jeder verbiß seine Schmerzen und freute sich im stillen darauf, daß auch an den nächsten die Reihe kommen werde.
Heute blieb nun Hans daheim, Jäger und Fischer gingen in den Wald. Sobald er am Kochen war, klopfte die Jammergestalt des hungrigen Weibes an der Tür und bettelte um ein Stücklein Fleisch. Sie erhielt es. Allein, so bald sie ihm auf den Rücken springen wollte, hatte sich Hans schon vorgesehn.
Er packte sie mit einer Hand und schwang sie so lange in der Luft herum, bis ihr der Atem ausging. Dann band er sie und warf sie hinab, wo die anderen gelegen. Da lag denn nun das schief geschnürte Bündel unter dem Herd. Sehr frühzeitig kamen heut die beiden Kameraden heim; sie lachten schon im voraus über die Prügel, die Hans aufgelesen haben mußte. Da sahen sie denn das Gegenteil.
Aber Hans wollte von seinem Abenteuer auch einen Nutzen haben. Er ließ die Hexe unterm Herd nicht eher los, als bis sie ihm ein Geheimnis entdeckt hatte. Hier im Berge, auf dem das Häuschen stand, war ein tiefes Felsenloch, das hinunter führte zu einem wunderbaren Schlosse.
Eine Prinzessin wohnte drinnen, von Drachen bewacht, und wer diese besiegte, gewann samt den Schätzen die Hand der Königstochter. Die drei gingen zur Höhle und bestimmten durch das Los, wer von ihnen zuerst am Seile hinunter gelassen werden sollte. Hans machte den Anfang.
Drunten fand er das Schloß, ganz aus Gold und Edelstein gebaut, als dann die Prinzessin selbst. Diese stellte ihm Wein und Brot vor, dadurch wurde er noch dreimal stärker als zuvor. Dann gab sie ihm das stärkste Schwert, mit dem er den Drachen schlagen sollte.
Dieser fuhr auch bald mit furchtbarem Getöse herab und spie einen Feuerstrom aus dem Rachen. Mit einem Hiebe schlug ihm Hans den Kopf ab, aber von dem Feuerstrom ergriffen, sank auch er zu Boden. Die Prinzessin eilte herbei und labte ihn wiederum mit Wein und Brot; er erwachte aus seiner Betäubung und fühlte sich nun noch dreimal stärker als vorher.
Dies war aber auch dringend notwendig; denn als bald erhob sich neues Getöse, und der zweite Drache kam herab gefahren, noch feuriger und größer als der erste. Der Kampf begann, das Schloß bebte und dröhnte, Qualm verfinsterte die ganze Luft, doch Hans mit seinem Machtschwert hieb in das Untier, daß das Blut in Strömen floß. Sausend fuhr sein Schwert durch die Luft, und der Schädel des Ungeheuers war vom Rumpfe getrennt.
Doch auch dem Tapferen schwanden die Sinne, ohnmächtig lag er neben dem Erlegten. Und wiederum war die Prinzessin da, abermals stärkte sie ihn mit Wein und Brot und brachte ihn dadurch ins Leben zurück; dann ließ sie ihn durch ihre Dienerinnen in ein gutes, schönes Bett bringen, und da ruhte und schlief er sich aus bis zum hellen Morgen.
Jetzt übergab ihm die Prinzessin das dritte Machtschwert, das alle anderen an Güte und Größe übertraf, nach dem er durch Speise und Trank abermals an Stärke dreifach gewachsen war, und kündete ihm an, daß nun der dritte und größte Drache zu bestehen sei. Noch einmal rief sie ihm Mut zu, zeigte ihm, wie sie beide nur die Wahl hätten zwischen namenlosem Glück und Unglück, und ging dann schluchzend hinweg.
Nun kam der dritte Drache herunter gefahren, brausend und sausend, Glut und Dampf aus dem Rachen speiend. Volle drei Stunden dauerte der Kampf, das Untier verblutete, Hans lag unbeweglich hin gesunken. Als es stille geworden, kam die Prinzessin herbeigeeilt; unter ihren Worten und Küssen schlug er wieder die Augen auf, wurde verpflegt und erholte sich.
Dann erhoben die Dienerinnen einen wunderbaren Gesang, eine liebliche Musik rauschte durch das Schloß, daß Hans bei seiner Prinzessin in Glück und Freude sich kaum fassen konnte. So machten sie sich alle bereit, mit dem nächsten Morgen die Hochzeit zu halten.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER FAULE HANS ...
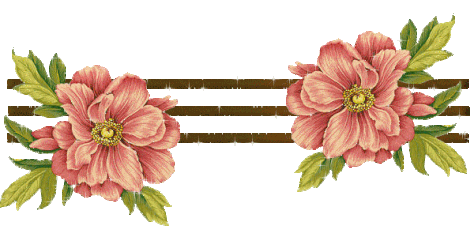
Ein Reisender langte in dunkler Nacht bei einer Herberge an und verlangte, daß ihn der Hans ohne Verzug heute abend noch durch den Wald fahre, der gleich hinter der Herberge anfing; denn der Hans war der Hausknecht und Kutscher in einem. Er griff es also an und fuhr mit dem Reisenden davon.
Als sie an einer einsamen Stelle im Walde anlangten, wo es auch mitten am Tag nie hell wurde, verspürten die Pferde eine besondere Unruhe und rannten, als wenn die Räder von den Achsen springen sollten. Da fielen ihnen drei Räuber in die Zügel und forderten den Reisenden auf, ihnen gutwillig Geld und Gepäck zu übergeben. Dieser dachte an Gegenwehr und rief den Knecht zum Beistand auf; aber Hans blieb ruhig auf dem Bocke sitzen und rauchte sein Pfeifchen so stumm und dumm fort, als sollte er daheim eine Schüssel weißer Rüben mitessen helfen.
Der Reisende mußte aussteigen und konnte nichts tun, als den Straßenräubern Hab und Gut überlassen. Da sie nun alles ausgeleert zu haben glaubten und sich fort machen wollten, sprach der Fremde: »Erfüllt mir jetzt eine Bitte, Ihr sollt sie mir nicht umsonst tun; hier in der Kutsche ist Euch ein Kistchen mit etlichen Dutzend Talern entgangen, nehmt sie auch noch; aber nehmt mir dafür jetzt auch den Knecht da droben auf dem Bock herunter und prügelt ihn nach aller Möglichkeit durch.«
Die Räuber waren bei Laune; sie rissen den Hans herab und schlugen erbärmlich auf ihn los. Das ließ er sich eine Weile gefallen; am Ende aber brummte er: »Potz Tausend!« und erhob die beiden Schultern, und eben da sie ihn zu werfen meinten, machte er seine erste Wendung, da küßte der Vorderste bereits den Boden.
Nun ergriff er den zweiten beim Schopf, den dritten beim Kragen und schlug ihnen in angemessenen Zwischenpausen mehrmals so tapfer die Köpfe zusammen, daß ihnen die Eingeweide im Bauch klangen und sie fielen wie Fliegen im Spätherbst.
Jetzt kniete er erst noch von einem auf den anderen hinüber und gab ihnen der Reihe nach alles Empfangene mit Zinsen zurück. Der Fremde, der bis jetzt verwundert zugesehen hatte, bekam wieder Mut, packte Stück für Stück seiner verzettelten Habe behend in die Kutsche, und hatte zuletzt nur noch die Mühe, den Hans von den drei Schlachtopfern loszumachen, in die er wie ein Stier mit den Hörnern festgebohrt war. So machten sich beide fort und ließen die Zerschlagenen liegen.
»Aber sag nur einmal«, sprach der Fremde hernach zum Knechte, als sie wieder in der Kutsche saßen, »was für ein sonderbarer Heiliger bist du; warum hast du mich und dich so lange von den Schurken mißhandeln lassen, die du dann wie auf einen Schlag bezwungen hast?«
»Ihr fragt eben auch«, antwortete Hans, »wie einer, der nichts versteht. In diesem Wald ist schon mancher umgekommen, eben weil er sich gewehrt hatte, und Ihr wißt wohl, daß ein solcher dann als Gespenst umgehen muß; nun wünsche ich mir erstens nach meinem Tode eine bessere Anstellung als eine solche; und zweitens müßt Ihr wissen: Warm muß ich doch erst werden, eh ich dreinschlage.«
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
JUNKER PRALHANS ...
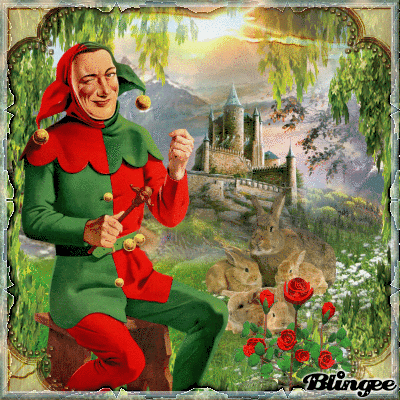
Ein König hatte einen jungen Edelknecht, den man Junker Prahlhans nannte, weil er immer viel versprach und wenig hielt. Es lebte aber auch am Hofe des Königs ein Spaßmacher, und dieser wollte den Prahlhans bessern. Das ging aber auf folgende Weise:
Eines Tages hätte der König gerne gebratene Vögel gegessen und sprach zum Junker: »Hans geh hinaus in den Wald und schieße mir zehn Vögel für meinen Tisch.« Der Junger aber sprach: »Nicht nur zehn, sondern hundert Vögel will ich dir schießen.«
»Gut«, sprach der König; »wenn du ein so guter Schütze bist, so bringst du mir hundert; sollst für jeden einen Taler haben.« Der alte Spaßmacher hörte das und ging dem Junker voraus in den Wald, wo die meisten Vögel waren, und rief sie und sprach:
Ihr Vöglein, flieget alle fort!
Hans Großmaul kommt an diesen Ort,
Möcht' hundert Vögel schießen.
Als Junker Hans in den Wald kam, da konnte er keinen Vogel erschauen; denn sie hatten sich alle in ihren Nestern versteckt. Und als er mit leeren Taschen zurück zum König kam, wurde er hundert Tage lang ins Gefängnis gesperrt, weil er sein Wort nicht gehalten hatte.
Wie er wieder frei war, sagte eines Tages der König: »Ich möchte heute wohl fünf Fische auf meinem Tisch haben.« Da gedachte Junker Hans an seine hundert Tage Gefängnis und tat seinem Munde ein wenig Zaum an: »Ich will dir fünfzig Fische fangen statt fünfen«, sagte er zum König.
Sprach der König: »Wenn du ein so guter Fischer bist, so fange mir fünfzig; sollst für jeden einen Dukaten haben.« Da ging der Spaßmacher hinaus an den See, rief die Fische und sprach:
Ihr Fischlein, schwimmet alle fort!
Hans Großmaul kommt an diesen Ort,
Möcht' fünfzig Fische fangen.
Und als der Junker an den See kam, da konnte er kein Fischlein fangen. Sie waren alle ans andere Ufer hinüber geschwommen. Und da er mit leeren Taschen heimkam, ließ ihn der König fünfzig Tage lang einsperren, weil er sein Wort nicht gehalten hatte.
Und da die fünfzig Tage um waren, sprach der König: »Ich möchte wohl einen Hasen für meinen Tisch haben.« Junker Hans gedachte seines Gefängnisses und sagte: »Herr, ich will dir wenigstens zehn Hasen bringen.«
Sprach der König: »Wenn du ein so guter Jäger bist, so jage mir zehn; sollst für jeden eine Dublone haben.« Da ging der Spaßmacher hinaus in den Wald, rief die Hasen und sprach:
Ihr Häslein, springet alle fort!
Hans Großmaul kommt an diesen Ort,
Möcht' zehn Hasen jagen.
Und als der Junker kam, konnte er den ganzen Tag keinen Hasen jagen. Der König aber ließ ihn wieder zehn Tage lang einsperren, weil er sein Wort nicht gehalten hatte.
Und wie er wieder frei war, sprach der König: »Ich möchte wohl einen Hirsch für meinen Tisch haben.« Der Junker gedachte seines Leidens, das seine Prahlerei ihm schon verursacht hatte und sagte bescheidentlich: »Ich will hingehen und schauen, ob ich einen Hirsch erlegen kann.«
Und als er hin ging, konnte er wirklich einen solchen schießen und brachte ihn mit Freuden dem König. Der lachte und sprach: »Schau, wenn man nichts Unmögliches verspricht, so ist das Wort halten leicht.«
Und der Spaßmacher lachte ins Fäustchen, denn der Junker war von jetzt an bescheiden.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER TEUFEL ALS SCHWAGER ...
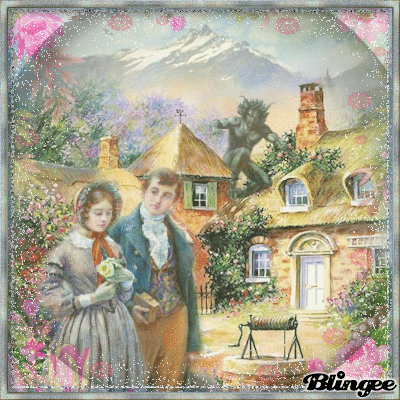
Ein Handwerksbursche kam auf seiner Wanderschaft an einem Abend in eine Herberge, und weil er sich schon ein paar Tage hintereinander müde gelaufen hatte, wollte er nun auch wieder ein paar Tage rasten. Er bedachte aber nicht, daß der Beutel die Kosten nicht vertrug, und als der Wirt, der davon Wind bekam, eines Abends sagte: »Guter Freund, Ihr seid wohl jetzt nicht mehr müde, also seid so gut und macht Euch morgen früh auf die Strümpfe, hier ist Eure kleine Rechnung«, - da überlief es den Burschen kalt und heiß, und er bat den Wirt, mit der Rechnung nur wenigstens bis morgen noch zu warten; »Morgen«, sagte er, »ist auch noch ein Tag.«
»Gut«, sagte der Wirt, »aber nehmt Euch in acht vor der Herberge zum schwarzen Turm, dahin bringt man bei uns die Leute ins Quartier, die mehr essen und trinken, als der Beutel Stich hält«
Als aber der Wirt fort war, warf sich der Handwerksbursche aufs Bett und konnte doch vor Angst und Sorgen die ganze Nacht kein Auge zu tun. Da trat auf einmal eine schwarze Gestalt zu ihm ans Bett und gab sich so gleich schlecht und recht als den Teufel zu erkennen. Der sagte: »Fürchte dich nicht, mein lieber Geselle, brätst du mir die Wurst, so lösche ich dir den Durst; willst du mir zu einem Schick verhelfen, so will ich dich aus deiner Klemme ziehen.«
»Und das wäre?« fragte der Handwerksbursche. »Nur sieben Jahre«, sagte der Teufel, »sollst du hier in diesem Wirtshaus bleiben, ich will dich frei halten und dir Hülle und Fülle geben, und nachher sollst du es noch besser bekommen und immer Geld haben wie Laub. Dafür sollst du dich aber nie waschen noch kämmen und dir auch Haar und Nägel nie schneiden.«
»Der Dienst ist schon des anderen wert«, dachte der Handwerksbursche und ging den Vertrag unverzüglich ein.
Als der Wirt am anderen Morgen erschien, erhielt er von dem Handwerksburschen seine Zeche auf Heller und Pfennig ausbezahlt und noch einen Überschuß dazu auf weitere Zeche; und der Handwerksbursche blieb Jahr und Tag in der Herberge sitzen und ließ Geld drauf gehen wie Sand am Meer.
Aber er wurde auch wüst wie die Nacht und kein Mensch mochte ihn ansehen. Kam an einem schönen Morgen ein Kaufmann zu dem Wirt; das war sein Nachbar; der hatte drei Blitz schöne Töchter; weil er sich aber in seinen Geschäften schlimm verrechnet hatte, und nicht mehr wußte wo aus und ein, so kam er, um dem Wirt seine Not zu klagen.
»Hört«, sagte der Wirt, »Euch kann geholfen werden. Da droben in meiner Fremdenstube wohnt schon mehr als sechs Jahre ein sonderbarer Kerl; der läßt wachsen was wächst und sieht aus wie die Sünde; aber er hat Geld wie Heu und läßt sich nichts abgehen; probiert es mit dem; ich hab ohnehin schon lang gemerkt, daß er oft nach Eurem Haus hinüber schielt; wer weiß, ob er es nicht auf eine von Euren Töchtern abgesehen hat.«
Dieser Rat leuchtete dem Kaufmann ein; er ging hinauf zu dem Handwerksburschen und es kam bald zu einem Vertrag zwischen ihnen: daß der Handwerksbursche dem Kaufmann aus den Nöten helfen und der Kaufmann dem Handwerksburschen eine seiner Töchter zur Frau geben müsse.
Als sie aber zu den drei Töchtern kamen und der Vater ihnen den Handel auseinandersetzte, lief die älteste davon und rief: »Pfui, Vater; was für einen Greuel bringst du uns ins Haus! Lieber will ich ins Wasser springen, ehe ich den heirate.«
Die zweite machte es nicht besser und rief: »Pfui, Vater; was für ein Scheusal bringst du uns ins Haus! Lieber hänge ich mich auf, ehe ich den heirate.« Die dritte und jüngste sprach dagegen: »Es muß doch ein braver Mann sein, Vater, daß er dich retten will, ich nehme ihn.«
Sie hielt ihre Augen immer zu Boden geschlagen und sah ihn gar nicht an; aber er hatte ein großes Wohlgefallen an ihr, und die Hochzeitsfeier wurde festgestellt.
Da waren auch die sieben Jahre um, die der Teufel ausbedingt hatte; und als der Hochzeitsmorgen erschien, fuhr eine prächtige Kutsche, von Gold und Edelsteinen funkelnd, bei dem Hause des
Kaufmanns vor, und heraus sprang der Handwerksbursche, der jetzt ein junger und feiner reicher Herr geworden war.
Da fiel der Braut ein Stein vom Herzen, und des Jubels war kein Ende. In langem Zuge gingen die Hochzeitsleute zur Kirche; denn der Kaufmann und der Wirt hatten alle ihre Verwandtschaft dazu eingeladen; nur die beiden älteren Schwestern der glücklichen Braut gingen nicht mit, sondern sie entleibten sich aus Ärger, die eine am Nagel, die andere im Wasser.
Und als der Bräutigam aus der Kirche kam, da sah er zum ersten Mal nach sieben Jahren den Teufel wieder, der saß auf einem Dach und lachte zufrieden herunter:
»Weißt, Schwoger, eso cha's cho:
Du hest Eini und i ha Zwo!«
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER BÄRENPRINZ ...
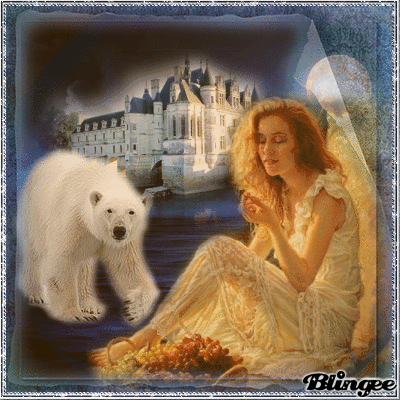
Ein Kaufmann wollte einmal auf den Markt gehen; da fragte er seine drei Töchter, was er ihnen nach Hause bringen sollte. Die älteste sagte: »Ich möchte Perlen und Edelsteine.« »Mir«, sagte die mittlere, »kannst du ein himmelblaues Kleid kaufen.« Die jüngste aber sprach: »Auf der Welt wäre mir nichts lieber als eine Traube.«
Als nun der Kaufmann auf den Markt kam, da sah er bald Perlen und Edelsteine, so viel er nur wollte; und auch ein himmelblaues Kleid hatte er bald gekauft; aber eine Traube, die konnte er auf dem ganzen Markt nirgends finden. Da war er sehr betrübt; denn gerade die jüngste Tochter hatte er am liebsten.
Als er nun so in Gedanken nach Hause ging, trat ihm ein kleines Männchen in den Weg, das fragte ihn: »Was bist du so traurig?« »Ach«, antwortete der Kaufmann, »ich sollte meiner jüngsten Tochter eine Traube heimbringen, und nun hab ich auf dem ganzen Markt keine gefunden.« Sagte das Männchen: »Geh nur ein paar Schritte dort die Wiesen hinunter, dann kommst du zu einem großen Weinberg; da ist freilich ein weißer Bär drin, der wird garstig brummen, wenn du kommst; aber laß dich nur nicht erschrecken, die Traube kriegst du doch.«
Nun ging der Kaufmann die Wiese hinunter, und da geschah es, wie das Männchen gesagt hatte. Ein weißer Bär hielt die Wache vor dem Weinberg und brummte dem Kaufmann schon von weitem entgegen:
»Was willst du hier?«
»Sei so gut«, sagte der Kaufmann, »und laß mich eine Traube nehmen für meine jüngste Tochter, nur eine einzige.«
»Die bekommst du nicht«, sagte der Bär, »oder du versprichst mir, daß du mir zu eigen gibst, was dir zuerst begegnet, wenn du nach Haus kommst.« Der Kaufmann besann sich nicht lange und sagte es dem Bären zu; da durfte er die Traube nehmen und machte sich vergnügt auf den Heimweg.
Als er nun nach Haus kam, sprang ihm die jüngste Tochter entgegen, denn sie hatte am meisten lange Zeit nach ihm gehabt und konnte es kaum erwarten, bis sie ihn sah; und als sie die Traube in seiner Hand erblickte, da fiel sie ihm um den Hals und konnte sich vor Freude nicht fassen.
Aber jetzt wurde der Vater erst recht traurig und durfte doch nicht sagen warum; alle Tage erwartete er, daß der weiße Bär kommen und sein liebstes Kind von ihm fordern würde. Und als gerade ein Jahr vergangen war, seit er die Traube aus dem Weinberg geholt hatte, da trabte der Bär wirklich daher, stellte sich vor den erschrockenen Kaufmann hin und sagte: »Nun gibst du mir, was dir zuerst begegnete, als du nach Hause kamst; oder ich fresse dich.«
Der Kaufmann hatte aber doch nicht alle Besinnung verloren, sondern sagte: »Da, nimm meinen Hund, der ist gleich aus der Tür gesprungen, als er mich kommen sah.« Der Bär aber fing an laut zu brummen und sagte: »Der ist nicht das Rechte; wenn du mir dein Versprechen nicht erfüllst, so freß ich dich.« Da sagte der Kaufmann: »Nun denn, so nimm da den Apfelbaum vor dem Haus, der ist mir zuerst begegnet.«
Aber der Bär brummte noch stärker und sagte: »Das ist nicht das Rechte; wenn du mir nicht gleich dein Versprechen erfüllst, so freß ich dich.« Nun half nichts mehr; der Kaufmann mußte seine jüngste Tochter her geben; und als sie herbei kam, fuhr eben eine Kutsche vor; da hinein führte sie der Bär und setzte sich neben sie, und fort ging es.
Nach einer Weile hielt die Kutsche in einem Schloßhof und der Bär führte die Tochter in das Schloß hinauf und bewillkommte sie. Hier, sagte er, sei er zu Haus, und sie sei von jetzt an seine Gemahlin; und alles Liebe und Gute, was er ihr nur an den Augen absah, tat er ihr, so daß sie mit der Zeit gar nicht mehr daran dachte, daß ihr Gemahl ein Bär sei.
Nur zweierlei nahm sie immerfort wunder: Warum der Bär des Nachts kein Licht leiden wollte und immer so kalt anzufühlen war. Als sie nun eine Zeitlang bei ihm gewohnt hatte, fragte er sie; »Weißt du, wie lang du schon hier bist?« »Nein«, sagte sie, »ich habe noch gar nicht an die Zeit gedacht.« »Desto besser«, sagte der Bär, »nun ist es aber gerade ein Jahr; darum rüste dich zur Reise, denn wir müssen deinen Vater wieder einmal besuchen.«
Das tat sie mit großen Freuden; und als sie zu dem Vater kam, so erzählte sie ihm ihr ganzes Leben im Schloß. Wie sie aber hernach wieder von ihm Abschied nahm, steckte er ihr heimlich Zündhölzchen zu, daß es der Bär nicht sehen sollte. Der hatte es jedoch im Augenblick gesehen und brummte zornig: »Wenn du das nicht bleiben läßt, so freß ich dich.« Dann nahm er seine Gemahlin wieder mit sich auf das Schloß und da lebten sie wieder zusammen wie vorher.
Nach einiger Zeit sagte der Bär: »Weißt du, wie lang du schon hier bist?« »Nein«, sagte sie, »ich spüre gar nichts von der Zeit.« »Desto besser«, sagte der Bär; »du bist nun gerade zwei Jahre hier; darum rüste dich zur Reise, es ist Zeit, daß wir deinen Vater wieder einmal besuchen.« Das tat sie wieder, und es ging alles wie das erste Mal.
Als sie aber noch zum dritten Mal bei ihrem Vater auf Besuch war, übersah es der Bär, daß ihr Vater ihr heimlich Zündhölzchen zugesteckt hatte; und wie sie nun zusammen wieder in das Schloß zurück gekehrt waren, so konnte sie es kaum erwarten, bis es Nacht war und der Bär neben ihr im Bette schlief. Leise zündete sie ein Licht an, und da erschrak sie vor lauter Verwunderung und Freude; denn neben ihr lag ein schöner Jüngling mit einer goldenen Krone auf dem Haupte; der lächelte sie an und sagte:
»Schönsten Dank, daß du mich erlöst hast; du warst die Gemahlin eines verwünschten Prinzen; jetzt wollen wir erst recht unsere Hochzeit feiern; denn jetzt bin ich der König dieses Landes.« Als bald wurde das ganze Schloß lebendig; von allen Seiten kamen die Diener und Kammerherren herbei und wünschten dem Herrn König und der Frau Königin Glück.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE KÄSPROBE ...

Ein junger Hirt bekam Lust zu heiraten. Nun kannte er drei Schwestern, die waren alle gleich schön und waren ihm auch alle gleich gewogen, so daß er nicht mit sich einig werden konnte, welche unter ihnen er zu seiner Braut erwählen sollte.
Das bemerkte endlich seine Mutter. »Soll ich dir gut zu Rat sein«, sagte sie zu ihm, »so lade alle drei Schwestern miteinander zu dir und stelle ihnen Käs auf und gib acht, wie sie damit umgehen.«
Der Sohn folgte diesem Rat; er lud die Jungfrauen zu sich und setzte ihnen den Käs vor. Da verschlang die erste gierig ihr Stück samt der Rinde, daß keine Spur übrig blieb. Die zweite im Gegenteil schnitt die Rinde so dick ab, daß sie noch viel Gutes mit wegwarf. Die dritte aber schälte die Rinde sauber, grad wie es sich gehört.
Und als nun der Hirt seiner Mutter erzählte, wie es bei dem Käse her gegangen, da sagte die Mutter: »Die dritte nimm, sie wird dir Glück bringen.« Das tat er, und es hat ihn sein Lebtag nie gereut, daß er der Mutter gefolgt hat.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER SCHNEIDER UND DER RIESE ...
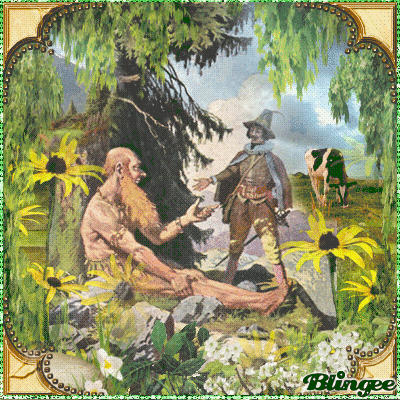
Vor Zeiten war einmal ein Riese, der machte sich auf den Weg, ob er einen fände, der ihm an Mut und Stärke gleich wäre. Er kam auf einen Berg, und wie er da zur Kurzweil einen schweren Stein von der Felswand brach und ihn in die Tiefe schleuderte, begann von unten herauf einer zu brummen; und als bald erhob sich ein gewaltiger Kerl, den hatte der Riese am Kopf getroffen und aus dem Schlaf geweckt; da aber der Stein ihn sonst an Haut und Haar nicht verletzt hatte, wurden die beiden auf der Stelle gut Freund und waren beide froh, daß sie ihres gleichen gefunden hatten.
Wanderten also wohlgemut zusammen weiter und kamen bald zu einer Nagelfluhwand, an welcher sie ihre Kraft erproben wollten. Der erste nahm einen Anlauf und putschte mit dem Kopf ein Loch in die Wand, daß er den halben Kopf darein verbergen konnte. Der andere aber putschte sich so tief hinein, daß er seinen Kopf nicht mehr herausbrachte und verzappeln mußte.
Da war der erste zornig, daß er seinen Kameraden schon so bald wieder verloren hatte, und schwur, den Tod des selben an dem ersten besten, der ihm begegnen würde, rächen zu wollen.
Nicht lange, so lief ihm ein armer Schneider in die Hände. »Du kommst mir gerade recht!« rief der Riese und streckte die Hand nach ihm aus. Aber der Schneider war nicht faul, tat einen kühnen Seitensprung und prahlte: »Potz tausend, mit wem meinst du, daß du es zu tun hast? Wollen wir wetten, ich bin stärker als du?«
Das nahm den Riesen doch wunder. »Nun«, sagte er, »auf eine Probe kann man es ja ankommen lassen; mach es nach!« und damit hob er einen zentnerschweren Stein vom Boden. »O ich kann noch viel mehr, ich kann den härtesten Kiesel mit meinen Fingern zerreiben«, sagte der Schneider, tat der gleichen, als ob er einen Kieselstein ergriffe, langte aber dabei unvermerkt in seinen Schnappsack, worin eine Balle Zieger lag, und zerrieb diese, daß das Wasser heraus troff.
Davon bekam der Riese gewaltigen Respekt vor dem Schneider; er nahm ihn zu seinem Kameraden an, und sie liefen miteinander fürbaß und kamen in eine große Stadt, wo der König seinen Palast hatte.
Allein statt Lust und Freude fanden sie all da nur Trauer und Herzeleid; denn gerade an diesem Tage sollte des Königs einzige Tochter einem Drachen zur Beute werden, der schon seit langem in der Nachbarschaft hauste. Tag für Tag hatte man ihm einen Menschen zur Speise hinaus schicken müssen, und wenn man es einmal unterließ, so kam der Drache herein und wütete so arg, daß die Leute froh waren, statt vieler nur ein Opfer zu verlieren.
Wen das Los traf, den mußten sie ausliefern; so hatten sie es bei Ehr und Eid ausgemacht. Nun hatte es gerade die Königstochter getroffen, und der König ließ noch eilig bekannt machen: »Wer den Drachen töte, der solle die Königstochter zur Frau bekommen und über das Reich regieren.«
Das vernahmen der Riese und der Schneider und hatten nicht übel Lust, ihr Glück zu versuchen. »Du hast die List und er den Leib«, dachte der Schneider, »zusammen mag wohl etwas auszurichten sein.« Also meldeten sie sich bei dem König an und verlangten, um den Drachen zu töten, einen Hammer und eine Zange.
Damit machten sie sich zusammen auf den Weg nach dem Drachen Nest. Als sie da angekommen waren, hielten sie Kriegsrat und kamen überein, daß der Schneider vorne bei dem Eingang bereit stehen sollte, um den Drachen mit der Zange zu packen; der Riese aber sollte von oben mit dem Hammer das Ungetüm aus dem Nest jagen.
Gesagt, getan. Aber als der Drache unter den Schlägen des Hammers aus dem Nest fuhr, schnappte er den Schneider samt seiner Zange im Fluge weg und verschluckte ihn. Indessen war der Riese gleich hinter ihm drein und schlug dem Untier den Hornschädel ein, daß es nieder lag und verendete. Hierauf schnitt er ihm den Leib auf und ließ den Schneider heraus schlüpfen.
Aber die Königstochter samt dem Reich wollte er nun für sich allein haben und schimpfte noch überdies weidlich auf den Schneider, daß er ihm bei einem Haar die Sache verdorben hätte. »Was?« rief der Schneider, »Du Prahlhans! Hättest du mich nur machen lassen; mit Fleiß bin ich dem garstigen Kerl in den offenen Rachen geschlüpft; denn von innen heraus wollte ich ihn umwenden, wie man einen Handschuh umwendet.«
Also konnte der Riese es nicht verhindern, daß der Schneider auch seinen Anteil an der Erlegung des Drachen haben wollte, und sie kamen beide miteinander zum König. Der König war jedoch in Verlegenheit, welchem von ihnen er nun seine Tochter samt dem Reich geben sollte.
Da sagte der Schneider zum Riesen: »Was meinst du? Wer von uns zweien mehr Reispappen essen kann, der soll der Glückliche sein.« Da war der Riese höchlich zufrieden, denn er aß nichts lieber als Reispappen; und auf Befehl des Königs stand bald vor ihnen der Reispappen, wie ein Berg so hoch.
Nun begann das Wettessen. Der Riese aß und aß, und der Schneider hielt tapfer Schritt; denn er hatte unter seinem Wams einen Sack angehängt, in den ließ er allen Reispappen heimlich hinunter fallen und tat nur zum Schein, als ob er mitesse. Da er nun nie aufhören wollte zu essen, der Riese aber endlich zum Zerspringen voll war, gab der Riese sich für besiegt und mußte dem Schneider die Königstochter und das Reich abtreten.
Das konnte er indessen leichter verschmerzen, als daß er im Essen besiegt worden war. Deshalb bat er den Schneider zuletzt noch, er möchte ihm sagen, wie er es angestellt habe, um so viel Reispappen zu bewältigen. »Guck«, sagte der Schneider, »die Sache ist sehr einfach; da hab ich mir halt den gefüllten Bauch heimlich aufgeschlitzt und dem Übermaß seinen Paß gegeben.«
Das schrieb sich der Riese hinter die Ohren, und aus lauter Neugierde machte er sogleich die Probe, und das war das letzte Mal in seinem Leben, daß er Reispappen aß.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER WANDERBURSCHE AUF DER TANNE ...
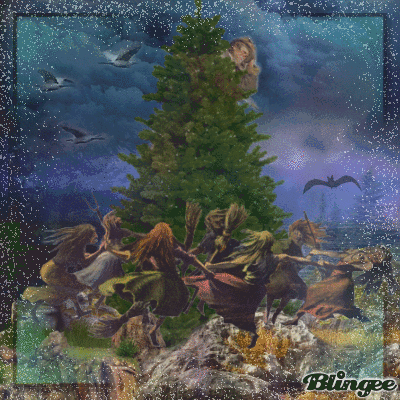
Zwei Wanderburschen waren schon einen ganzen Tag miteinander gelaufen und hatten noch kein Dorf erreicht; da blieb ihnen keine andere Wahl, als im Walde zu übernachten. Der eine erkletterte eine Tanne und band sich mit seinem Strumpfbändel zum Schlafe fest; der andere legte sich dahinter ins Gestäude.
Um Mitternacht kam aber eine Schar Hexen zum Baum gefahren und hielten ihren Tanz. Und als sie hernach noch einen Schmaus abhielten, erzählten und schwatzten sie, wie sie die Königstochter krank gezaubert hätten, und eine sagte: »So lange man nicht den Schimmel schlachtet, an dem kein graues Haar ist, und nicht die Königstocher in die frische Roßhaut einschlägt, kann die kein Mensch mehr gesund machen.«
Hierauf, als sie sich satt gegessen und geplaudert hatten, fuhren alle wieder davon. Der Bursche, der nebenan in den Stauden lag, schlief so fest, daß er von alle dem nicht erweckt wurde; dagegen der auf der Tanne droben war wach und hatte sich die Worte der Hexen genau gemerkt.
Als es anfing zu tagen, stieg er vom Baum herunter, weckte seinen Kameraden und forderte ihn auf, mit ihm so gleich dem Königsschlosse zu zugehen, um diese Neuigkeit dort zu melden. Dieser aber glaubte von allem nichts, lachte ihn aus und zog, als der Wald zu Ende war, allein seiner Wege.
Der andere dagegen ging ins Schloß und verriet da dem König das Heilmittel für seine kranke Tochter. Man sendete hinaus auf die Weide, ließ den Schimmel einfangen und schlachten und wickelte die Prinzessin in seine frische Haut hinein; und auf die Stunde war die Prinzessin wieder genesen.
Nun war alles voll Jubel; das ganze Land erzählte von der fröhlichen Begebenheit; der Handwerksbursche durfte für immer in dem Schlosse bleiben und wurde gehalten wie das Kind im Haus.
Als sein Reisegefährte auf allen Straßen von dieser Geschichte reden hörte, ärgerte es ihn, daß er nicht mit auf das Königsschloß gegangen war. Aber nichts schien ihm leichter, als so gleich eine ebenso gute Nachricht zu erfahren und sie dem König zu überbringen.
Er kehrte also um und suchte im Wald die Tanne, auf der sein Kamerad einst gesessen hatte; da kletterte er hinauf und erwartete die Nacht und den Hexenzug. Abermals begann der Tanz und der Schmaus unter dem Baum, und die Hexen schwatzten und erzählten sich, daß die Königstochter geheilt sei, seit dem einst ein Horcher ihre Gespräche unter diesem Baum belauscht habe; und eine rief plötzlich:
»Dort sitzt ja der andere auf der Tanne!« Da kletterten die Hexen hinauf und zerrissen ihn in tausend Fetzen. Und am anderen Morgen kam noch eine andere ins Schloß und verlangte mit dem jungen Menschen zu sprechen, der sich hier aufhalte; sie habe ihm eine Nachricht aus der Heimat mitzuteilen.
Der König aber ließ die Hexe ergreifen und foltern, bis sie alles eingestanden hatte; und dann wurde sie eingemauert, daß sie elendiglich umkommen mußte. Dem Burschen aber gab er seine Tochter zur Gemahlin.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER HAARIGE ...

Es war einmal ein König auf der Jagd. Da kam er zu einem hohlen Baum, an dem wollten die Hunde nicht vorbei; sie bellten und sprangen herum und waren nicht wegzubringen; und als der König hinsah, da saß in dem hohlen Stamm eine wunderschöne Jungfrau, die war ganz nackt und blickte ihn erschrocken an.
Da nahm er seinen Mantel, warf ihn über die Jungfrau und tat einen Pfiff, und auf den Pfiff kamen alle Diener des Königs herbei; denen zeigte er die Jungfrau und fragte sie: »Hab ich nicht ein schönes Tier gefangen?« Dann pfiff er zum anderen Mal, und da kam eine Kutsche gefahren, in diese setzte er die Jungfrau und fuhr mit ihr heim ins Schloß und heiratete sie.
In dem Schloß lebte aber noch die alte Königin, des Königs Mutter; die war der jungen Königin gram und tat ihr alles Herzeleid. Nach einer Zeit mußte der König in den Krieg ziehen.
Unterdessen bekam seine Gemahlin einen Sohn; da braute die alte Königin einen Kaffee und gab ihn dem Neugeborenen zu trinken; davon wurde der selbe am ganzen Leib haarig, und die böse Alte schrieb dem König: »Deine Frau hat ein haariges Tier bekommen, man weiß nicht, ist es ein Hund oder eine Katze.«
Diese Nachricht versetzte den König in großen Zorn, und er befahl, daß man seiner Gemahlin das Neugeborene auf den Rücken binden und sie beide zusammen fort jagen solle. Also wurde die junge Königin mit ihrem haarigen Sohne aus dem Schlosse verwiesen und kehrte wieder zu dem hohlen Baum zurück, wo sie der König zu erst gesehen hatte. Da lebte sie nun wieder wie zuvor.
Aber dem Haarigen schlug das Leben im Walde so gut an, daß er alle Tage um einen Schuh größer wurde und endlich in dem hohlen Baum mit seiner Mutter gar nicht mehr Platz fand. Da ging er eines Tages hinaus und raufte ein Bündel Tannen aus, die brach er übers Knie und baute für sich und seine Mutter eine bequeme Hütte.
Nicht lange darauf sagte er zu seiner Mutter: »Nun sage mir auch einmal, wer mein Vater ist.« »Ach«, antwortete die Mutter, »dein Vater ist der König, den wirst du dein Lebtag nimmer zu sehen bekommen.« »Jetzt will ich ihn gerade sehen«, sagte der Haarige, und riß eine Tanne samt Wurzeln aus dem Boden; und damit machte er sich auf den Weg und ruhte nicht, bis er das königliche Schloß gesehen hatte.
Der König saß gerade bei Tisch und hatte eine große Menge köstlicher Speisen vor sich stehen. Der Haarige tat, wie wenn er hier zu Hause wäre, stellte sich vor den König hin und sagte zu ihm: »Da bin ich auch, ich bin dein Sohn und will mit dir speisen von deinem Tisch.«
Da erschrak der König und hätte es ihm gerne gewehrt; aber der Haarige langte ohne weiteres zu und griff mit seinen haarigen Händen gerade in des Königs Teller und Schüssel; und niemand getraute sich, etwas zu sagen; denn des Königs Leute entsetzten sich auch alle und mußten es ruhig geschehen lassen.
Als der Haarige Stück für Stück von dem Tisch genommen und verzehrt hatte, sagte er zum König: »Jetzt will ich gehen, aber morgen komme ich wieder.«
»Wart«, dachte der König, »ich will dir es schon verleiden, daß du mir nicht wieder kommst.« Schnell ließ er fünfhundert Soldaten aufbieten, die mußten sich dicht vor dem Schloß aufstellen und
hatten den Befehl, auf den Haarigen zu schießen, sobald er sich blicken lasse.
Am anderen Tage, als der selbe mit der Tanne wieder auf des Königs Schloß zugeschritten kam, da gaben die Soldaten alle miteinander ein Feuer auf ihn. Aber der Haarige las alle Kugeln ruhig von seinem Leibe ab und warf sie, je fünfzig um fünfzig, auf die Soldaten zurück, bis er sie alle zusammen zu Tode geworfen hatte.
Als er in das Schloß kam, saß der König wieder bei Tische und wollte eben Mahlzeit halten. Da sagte der Haarige zu ihm: »Aber, Vater, was machst du für Sachen? Da liegen deine Soldaten allesamt erschlagen von ihren eigenen Kugeln! Ich bin ja dein Sohn und will mit dir von deinem Tisch essen.«
Und also langte er wieder mit seinen haarigen Händen in des Königs Teller und Schüsseln, und hörte nicht eher auf zu essen, als bis Stück für Stück von der Tafel verschwunden war. »Jetzt will ich gehen«, sagte er endlich, »aber morgen komm ich wieder und bringe meine Mutter mit.«
»Halt«, dachte der König, »das wirst du bleiben lassen.« So gleich bot er tausend Soldaten auf, und schärfte ihnen ein, daß sie sich vor das Schloß stellen sollten, die eine Hälfte in den Schloßhof, die andere rings ums Schloß herum, und daß sie den Haarigen bei Leibe nicht herein lassen dürften.
Folgenden Tages kam der selbe und führte seine Mutter an der Hand; und als die Soldaten auf ihn schossen, stellte er sich vor seine Mutter hin, las alle Kugeln wieder von seinem Leibe ab und warf je hundert um hundert zurück, bis alle Soldaten tot lagen. Hierauf trat er ins Schloß, und als er zu dem König kam, sagte er zu ihm: »Aber, Vater, was machst du wieder für Sachen? Da liegen deine Soldaten alle mausetot von ihren eigenen Kugeln! Geh, sieh nur selber!«
Da faßte er ihn an der Hand, und als bald flog der König in den Schloßhof hinunter; und als er ihn zum zweiten Mal anfaßte, flog der König wieder zum Fenster herein; aber zum dritten Mal fiel er zu Boden und war tot. So gleich kam nun die alte Königin herbei; die mußte gar freundlich tun, damit der Haarige sie am Leben lasse; und mußte ihm auch versprechen, daß sie ihm die garstigen Haare wieder vom Leibe schaffen wollte.
Da braute sie ihm wieder einen Kaffee; davon vergingen ihm alle Haare an Rumpf und Händen, und von Stund an hatte er auch nicht mehr Kräfte, als die anderen Menschen. Aber das Königreich gehörte fortan ihm, und er regierte mit seiner Mutter in Freude und Herrlichkeit.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DER WITTNAUER HANS ...
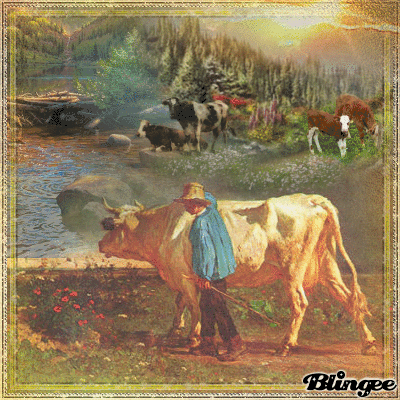
Der Wittnauer Hans war noch ganz klein, als sein Vater in einem Steinbruch zu Tode fiel; und nicht lange danach starb auch seine arme Mutter, die ihr liebes Leben lang sich mit Spinnen abgearbeitet hatte. Sie hatte aber dem Hans noch einen guten Rat gegeben, bevor sie die Augen schloß, und den führte er auch gleich an dem nämlichen Tag noch aus, da sie die Mutter beerdigt hatten.
Er machte sich auf den Weg und ging zu einem reichen Vetter, der droben auf dem Berg ein großes Bauerngut besaß. Aber da kam er zuerst übel an. Denn der Vetter war ein alter, mürrischer Kauz und der größte Geizhals weit und breit. Weil jedoch Hans nicht nachließ mit Bitten und Beten, daß er ihn doch in seinen Dienst nehmen möchte, da er nun so ein armes Waislein sei, der auf der Welt nichts habe, so sagte der Alte endlich brummend: »He so nu so denn! Wenn du mir den Herbst über das Vieh hüten und dich gut halten willst, so kann man es ja mit dir probieren.«
So war der Hans außer Sorgen. Alle Morgen in der Frühe, Sonn- und Werktage, fuhr er mit den acht Kühen und zwei Kälbern des Vetters auf die Weide den Berg hinan und hatte jedesmal seine größte Freude, wenn er drunten im Tal den Rauch aus seinem alten Heimatort aufsteigen sah oder die Kirchenglocken von dort herauf schallten.
Mit der Zeit aber wurde ihm schwer ums Herz, so oft er dort hinunter blickte, und es war ihm, als sei er schon eine Ewigkeit fort, und hatte keine Ruhe mehr, bis er endlich wieder einmal heim durfte. Er gab also eines Tages seine Herde dem Schäfer in die Hut, der neben ihm auf dem Berge die Schafe hütete, und ging hinab nach der Kirche, wo sein Vater und seine Mutter begraben waren und feierte andächtig den Gottesdienst der Gemeinde mit. Und dies wiederholte er noch mehrmals.
Aber als er einmal am Sonntagabend des Vetters Herde nach Hause trieb, und der Vetter schon von der Haustüre aus zu seinem Schrecken sah, daß dem Hans nur neun Stücke zur Hand waren und das schöne rote Kalb fehlte, da ging ein anderes Wetter übers Land. Grimmig fuhr der Vetter auf Hans los; der aber merkte, wie viel Uhr es geschlagen, und nahm einen Satz auf die Seite nach dem Stall zu, wo gerade der Knecht einen großen Haufen Heu aufgeworfen hatte; da hinein bohrte er sich mit dem Kopf, daß also bald nur noch die Füße heraus guckten.
Da packte der Vetter in der Wut die Heugabel und stach hinein; aber Hans war mittlerweile vollends hinein gekrochen und die Gabel kitzelte ihn nur hinten an der Ferse, daß kaum ein Tropfen Blut daran hängen blieb. Als nun der Vetter das Blut sah, da vermeinte er aber nichts anderes, als daß er den Hans erstochen hätte. Er entsetzte sich, warf das Mordwerkzeug weg und lief heulend zum Tor hinaus und ins Weite. Als Hans merkte, daß der Vetter fort war, besann er sich nicht länger, kroch hervor und rannte gleichfalls so schnell davon, daß in dem Schrecken um den Meister niemand auf dem Hof ihm nachsah.
Spornstreichs lief er zu dem Schäfer auf den Berg und fragte ihn nach dem verlorenen Kalb. Allein der hatte nichts von dem Tier gesehen und gehört; doch erzählte er ihm, wie heute ein Trupp Diebsgesindel gerade da, wo Hans sonst weidete, sich zu einem leckeren Mahl gelagert habe; wer weiß, ob es nicht just das Kälblein zum Schmaus gestohlen hat. Das leuchtete dem Hans ein; er ließ sich von dem Schäfer die Richtung zeigen, welche die Diebe genommen hatten und setzte ihnen unverzüglich nach.
Bald sah er auch hellen Feuerschein durch die Tannen schimmern; vorsichtig schlich er näher, und richtig: da lagerte die Räuberbande zechend um ein großes Feuer, und an einem Baume in der Nähe hing das rote Kalbfell. Da ging dem Hans ein Stich durchs Herz, denn das Kälblein war sein Liebling gewesen; und leise wollte er zurück schleichen; da knackte ein dürrer Ast unter seinem Fuß; die Räuber sprangen auf und ergriffen ihn; und ohne weiteres wurde er in ein leeres Faß gesteckt und da lag der arme Hans und hörte nur noch, wie die Gesellen ein Hohngelächter verführten und den Deckel zu schlugen.
Jetzt war guter Rat teuer; hätten die Räuber nicht bereits den Spunten aus dem Faß geschlagen gehabt, so hätte Hans ersticken müssen. Unterdessen hatte sich aber ein schweres Gewitter am Himmel zusammengezogen; der Wind pfiff durch die Tannen, und durch die Schluchten rollte der Donner; und Hans merkte, daß nach und nach das Knattern des Kochfeuers aufhörte und das Gespräch und der Lärm der Räuber verstummte.
Diese hatten sich davon gemacht und ein Obdach unter den Heuscheuern der unteren Bergmatten gesucht. Eben als Hans aus dem Faß kriechen wollte, kam jedoch einer von ihnen wieder hastig herauf gerannt, um das Kalbfell zu holen, das sie vergessen hatten. Schon hatte er die Hand danach ausgestreckt, da kam ein Blitz und ein Schlag, daß der ganze Baum in Flammen zu stehen schien.
Der Räuber war zu Boden gefallen, Hans hörte ihn keuchen und sah zum Spuntloch hinaus, wie er sich aufsammelte und verblendet gegen das Faß taumelte - krach! Fing das Faß an zu rollen und rollte ohne Aufhören Berg runter von Satz zu Satz, die Reifen fuhren ab, die Dauben platzten, und Hans war befreit.
Unten in der Tiefe sprangen die Trümmer klingend an eine Felswand; aber Hans blieb sitzen, gerade hinter der letzten Sturzklippe. Das Sausen und Dröhnen im Kopf vertoste, der Schmerz in den zerschlagenen Gliedern gab allmählich nach; aber jetzt war erst guter Rat teuer! Ringsum die rabenschwarze Nacht, auf schwindligen, unwegsamen Felsen, in der Nähe das gefährliche Gesindel und daheim der wütende Meister!
Um sich wenigstens vor den Räubern zu retten, kletterte Hans endlich durch die scharfen Felsenrunsen und über die Bergwasser hinunter, bis er den Boden eines engen Waldtales unter den Füßen hatte. Da sah er von fern ein Licht schimmern. Darauf ging er los; denn das war der Waldhof, an dem er öfters seine Herde vorbei getrieben hatte; und da das Unwetter eben noch einmal los brach, so machte er keine Umstände, sondern schlich hinter dem Haus in die Obertenne, um sich da ins Stroh zu verkriechen.
Aber kaum hatte er angefangen, einige Garben zum Nachtlager auszubreiten, so drang durch den schlecht gebretterten Boden wieder ein Lichtschimmer zu ihm herauf; und da sah er mit Schrecken die Räuber alle wieder beisammen, die zechten und lärmten da von Neuem, und es schien Hans, als hielten sie erst jetzt die eigentliche Mahlzeit von seinem armen roten Kälblein; er hörte so was von Teller Klappern und Gabel Stochern.
Das mußte er doch wissen; also kroch er behutsam zu dem Garbenloch und wollte sich da zum Zusehen bequem auf ein Strohbündel der Länge nach hin strecken - rutsch! rutsch! Da ging es plötzlich kopfüber und Hans schoß pfeilschnell aus dem Garbenloch mitten unter das Diebesgesindel hinab, wie das Brot in den Ofen.
Eine mächtige Garbenmasse stürzte hinter ihm drein und eine mitfahrende Staubwolke verhüllte den Hans und die Garben dazu; und der Luftstoß hatte das Feuer ausgelöscht. Voll Schrecken stoben die Räuber auseinander, und da war Hans wieder allein und fühlte sich die Knochen, die zum Glück alle ganz und heil geblieben waren.
Rasch blies er das Feuer wieder an; da sah er nun auch, wie die wilden Gesellen gewirtschaftet hatten. So eine Mahlzeit hatte er noch nie mitgehalten: Braten und Wein die Hülle und Fülle. Hei, das ließ er sich schmecken. Tapfer griff er es an und hörte nicht auf, bis er draußen die Räuber zurück kommen hörte, die sich allmählich von ihrem blinden Schrecken erholt hatten.
Eilig schlüpfte er zur Hintertüre hinaus und versteckte sich in einen leeren Bienenkorb, den er in dem Bienenstand hinten im Baumgarten fand. Mittlerweile waren die Räuber ihrerseits wieder über
den Braten und Wein hergefallen.
Nachdem sie sich aber gesättigt hatten, lüsterte ihnen nach einem süßen Nachtisch.
»Zu diesen Ankenschnitten hier«, rief einer, »gehört auch Honig; kommt, wir wollen Honig holen!« Als bald gingen ihrer zwei hinaus in den Garten zum Bienenhaus, und lüpften Korb um Korb, um den schwersten und ausgiebigsten herauszusuchen; und da griffen sie natürlich bald denjenigen an, in welchem der arme Hans saß.
Der eine trug hinten, der andere vorne am Brette, worauf der Korb stand. Aber der eine behauptete, links gehe der Rückweg zur Scheune; der andere dagegen meinte, rechts müsse man sich halten, um nicht finsterlings im Baumgarten anzurennen und den vollen süßen Korb auszuschütten.
Dem Hans schien dieser Streit ganz ergötzlich; und dieweil es stockende Finsternis um sie herum war, so konnte er nicht anders, es juckte ihm in der Hand, er langte also oben zum Schlupfloch heraus und stupfte den Vordermann heimlich in den Rücken.
»Setz ab«, sagte der zum Hintermann, »was hast du mich zu stupfen?« Während der noch redete, zupfte Hans den Hintermann am Bart. »Und was hast du mich zu zupfen?« schnauzte dieser entgegen. Nun war das Wort wieder am anderen; aber der ließ jetzt das Brett fallen und ging auf den Kameraden los und die Ohrfeigen flogen nach allen Seiten.
Während sich die beiden aus Leibeskräften zerwalkten, nahm Hans seine günstige Stunde wahr, hob den Korb über sich ab und sprang unbemerkt davon. Er lief und lief, und da nach solchen Abenteuern die Furcht vor dem Meister viel kleiner geworden war, so lief er gradaus nach dem Hof des Vetters.
Als er nahe herzu kam, nahm es ihn Wunder, warum alles so früh auf sei; die Weiber rannten hin und her, und die Knechte lärmten; die Hoftüre stand offen und alles Gesinde feierte. Ein Knecht sah ihn zuerst und rief: »Herr Gott, bist du es, Hans? wir alle glaubten, der Meister habe dich erstochen und verscharrt. Ihn selber haben die Schulkinder im Wald erhängt gefunden, er hat sich selbst gerichtet, der Schinder und Schaber.«
So wurde Hans aus einem armen Küherbuben ein reicher Bauer; denn er war der einzige Erbe des geizigen Vetters; und er lebte lange und glücklich, und die Armen waren es wohl zufrieden.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE SCHLÜSSELJUNGFRAU ...
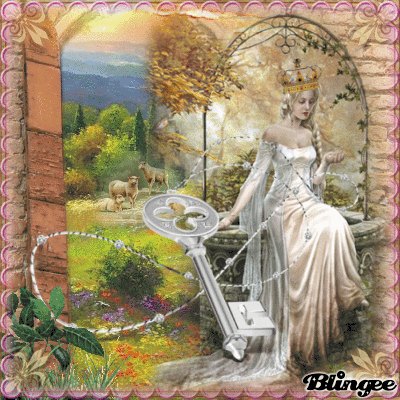
Es war einmal ein Schustergeselle, den nannte das ganze Dorf einen Sonderling, denn so oft abends die Vesperglocke läutete, legte er sein Handwerksgeschirr auf die Seite und begab sich auf seine einsamen Spaziergänge, ohne sich um seinesgleichen zu bekümmern.
Damit verhielt es sich aber so: Dem Gesellen war das Leben in dem abgelegenen Dorfe schon lange verleidet, und er sann hin und her, wie er es anfangen könnte, um bald ein Meister in einer großen Stadt zu werden.
Eines Abends nach Sonnenuntergang ging er in den Wald hinter dem Dorf und klomm dort einen Hügel hinauf, auf welchem vor undenklichen Zeiten ein Schloß gestanden hatte, von dem jetzt nur noch ein verwitterter, viereckiger Wartturm dastand.
Da kam von oben herunter eine Jungfrau in fremder Tracht; die sah gar seltsam aus; in der einen Hand hielt sie einen Schlüsselbund, in der anderen eine schlanke Gerte, und auf dem Haupte trug sie eine prächtige Goldkrone, in welcher ein großer Goldschlüssel steckte.
Der Geselle verbeugte sich untertänig und ging vorüber; aber die fremde Jungfrau rief ihn an und sagte: »Bist du in hiesiger Gegend daheim?« »Mit Vergunst«, antwortete der Gesell, »ich bin
nur beim Schuhflicker drunten im Geding.«
»Nun«, sagte die Jungfrau, »dann kannst du mir doch wohl ein Paar Schuhe machen; aber bis nächsten Samstag müssen sie fertig sein.«
»Das will ich meinen, kann ich es«, antwortete er und zog schon das Maß aus der Tasche. »Hinten müssen die Schuhe rote Stöckchen haben«, sagte die Jungfrau, »und vorne rote Laschen, aber das Vorgeschühe bleibt ungewichst.«
»Alles zu dienen«, erwiderte der Gesell, »so seid nur so gut und setzt Euch nieder, daß ich sie Euch anmessen kann.« Im gleichen Augenblick ließ sich von dem Schloßturm her eine Nachtigall hören. »Es ruft mich jemand«, sagte die Jungfrau, »ich muß schnell gehen«; und verschwand hinter den Bäumen.
Am Samstag trug der Gesell die Schuhe nach dem alten Wartturm hinauf; er war selber in seine Schuhe verliebt, so fein und sauber sahen sie aus. An der gleichen Stelle wie das erste Mal war wieder die Jungfrau; sie hatte schon auf ihn gewartet und war jetzt wohl zufrieden mit seiner Arbeit.
»Über acht Tage«, sagte sie, »sollst du mir aber noch deine Bürste mitbringen, damit du mir noch das Vorgeschühe wichsen kannst; hier hast du einstweilen ein Drangeld.« Damit gab sie ihm ein blankes Goldstück; da schlug wieder vom Schloßturm herab die Nachtigall, und die Jungfrau verschwand.
Als er am nächsten Samstag mit der Rötelbürste herauskam, saß sie an einer Erle und hieß ihn zu sich setzen und fragte: »Du hast mir mit den Schuhen zweimal einen großen Dienst geleistet; ich bin in den alten Wartturm verzaubert; sobald ich aber dieses Paar Schuhe durch gelaufen habe, so bin ich erlöst.
Zum Dank will ich dir bis dorthin beistehen, so oft du in Nöten gerätst. Wenn du mich brauchst, so komm allemal am Samstag hierher, da wirst du ein Pfeifchen finden; und wenn du darauf bläst, so werde ich erscheinen. Ich werde freilich nicht mehr reden können; mußt du aber notwendig einen Rat von mir haben, so drehe nur den Schlüssel an meiner Krone um, dann werde ich die Sprache wiederbekommen.«
Das schrieb sich der Gesell redlich hinter die Ohren; und es ging keine Ewigkeit, so fand er sich wieder auf dem Waldplatz ein, da lag richtig das Pfeifchen und als er darauf blies, lag an der Stelle, wo er es aufgehoben hatte, ein Goldstück. Und so trieb er es nun so oft er es mochte und hatte immer vollauf Geld.
Aber er ließ es auch immer drauf gehen und strich den reichen Bauerstöchtern nach. Er lebte wie der Spatz im Hanfsamen und wollte nicht mehr arbeiten. Der Meister jagte endlich den Faulenzer fort, aber weil er in seinem Saus und Braus schon lange jede Woche noch ein dickes Stück mehr Schulden gemacht hatte, als das Goldstück vertrug, so wollte ihn der Amtmann einstecken lassen.
Da mußte er sich entschließen, der Jungfrau seine Bedrängnis zu klagen und sie um Hilfe anzuflehen. Er machte sich also auf den Weg; und als er auf der Pfeife blies, erschien die Jungfrau diesmal selber. Da griff er nach dem goldenen Schlüssel in ihrer Krone und wollte ihn umdrehen.
Aber kaum hatte er ihn berührt, so verwandelte sich der Schlüssel in eine feurige Schlange, die ihn umschlang und fast erdrückte. Mit Schrecken rannte er davon und war froh, daß er nur mit einer verbrannten Hand unten im Dorf ankam.
Hier lief er gerade dem Amtmann in die Hände. Der setzte ihn an den Schatten und da war es aus mit den reichen Bauerstöchtern und mit dem Meister Schuhmacher in der großen Stadt.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DAS UNHEIMLICHE SPINNRAD ...
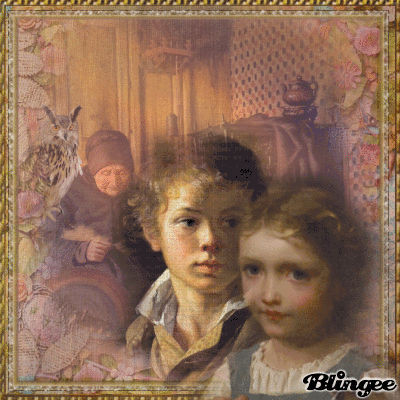
Vor mehr als hundert Jahren lebten in einem Bergdorf im Wallis zwei Waisenkinder. Der neunjährige Bub hiess Hubert und das sechsjährige Mädchen Käthi. Ihr Vater war beim Holzen von einer Tanne erschlagen worden, und die Mutter vor Kummer bald darauf gestorben. Nun wurden die Kinder zu einer Frau in Pflege gegeben, die ganz allein auf einem kleinen Hof hoch über dem Dorf wohnte.
«Weltende» nannten die Leute den Bauernhof. Im Winter musste man mühsam viele Stunden durch den Schnee stapfen, um ihn zu erreichen.
Die Kinder hatten kein gutes Leben bei ihrer Pflegemutter. Mit Fusstritten jagte sie den Buben zur Arbeit, und sie liess keine Gelegenheit aus, Käthi an den Zöpfen zu zerren. Kein gutes Wort kam je über ihre Lippen, und das Essen, das sie den Kindern gab, war dürftig und mager. Die böse Frau liebte nichts als ihr Spinnrad und ihren zahmen Uhu. Den Tag über sass der Uhu auf ihrer rechten Schulter, und nachts schlief er in ihrem Bett.
Das Spinnrad sah unheimlich aus. Es war schwarz, voller Spinnweben und Ungeziefer. An der Querstange steckten zwei geschnitzte Teufelshörner. Abends, wenn es dunkelte, setzte sich die böse Frau an das gruselige Möbel, drehte den schmutzigen Faden und sang mit krächzender Stimme:
«Auf dem Rad, auf dem Rad,
reit ich einmal hopsassa
aus der Stuben, aus der Stuben
ins heisse Land der Beelzebuben.»
Der Uhu hockte dabei auf ihrer Schulter, seine gelben Augen rollten wie
feurige Räder, und er krächzte schauerlich:
«Uhu, uhu, wann fahren wir dem Teufel zu?»
Es war unheimlich. Die Kinder drängten sich in den hintersten Winkel der Küche und hielten sich fest bei der Hand.
Am glücklichsten waren Käthi und Hubert im Sommer, wenn sie im Wald Beeren und Holz sammeln konnten. Es war wunderschön im Bergwald, da gab es Vögel, Eichhörnchen und neugierige Hasen. Die Kinder
konnten spielen, herumtollen und sich Geschichten erzählen.
Als aber der Winter kam, mussten sie im Haus bleiben und wurden von früh bis spät herum gestossen und geplagt. Einen Tag vor Weihnachten sagte die böse Frau zu Käthi: «Es wird Zeit, dass du spinnen lernst, du fauler Tropf. Los, setz dich her und fang an!»
Kaum aber hatte Käthi die Spule in die Hand genommen, fing das Spinnrad an, Funken in der Stube herumzusprühen. Dabei quietschte es wie ein Schwein. Käthi schrie auf vor Entsetzen, Hubert aber packte das Teufelsgestell und warf es in den Schnee hinaus.
Es schlitterte den hart gefrorenen Hang hinunter und stürzte in den Bergbach. Wie eine Furie fuhr die böse Frau auf den Buben los und kreischte: «Hol mir mein Spinnrad zurück, ich muss es wiederhaben! Warte, das wirst du mir büssen!» Rasend vor Wut packte sie Käthi an den Zöpfen, stiess es in eine dunkle Kammer und sperrte die Tür zu:
«So, da kannst du bleiben und mit den Ratten spielen, bis Hubert mir das Spinnrad wieder bringt!»Sie lachte so laut und gellend, dass es den Kindern durch Mark und Bein ging.
Rasch sprang Hubert in die Scheune, griff sich ein kleines Holzbrett — einen richtigen Schlitten besass er nicht — setzte sich darauf und sauste den Abhang hinunter. Er hoffte, das Spinnrad sei vielleicht an einem Felsvorsprung hängen geblieben, aber er konnte keine Spur davon entdecken.
Während der ganzen Nacht hastete Hubert dem Bachufer entlang, kletterte über Geröll, stolperte über Baumwurzeln und suchte im Mondschein das Spinnrad. Vor Kälte und Müdigkeit erschöpft,brach er manchmal beinahe zusammen. Aber der Gedanke an seine arme Schwester gab ihm immer wieder neue Kraft.
Endlich gegen Morgen erreichte Hubert eine kleine Mühle. Zum Umfallen müde setzte er sich auf die Bank vor dem Haus. Tränen liefen über seine Backen aus Angst und Sorge um das eingesperrte Käthi. Da öffnete sich die Eingangstür, und eine alte Frau mit schneeweissem Haar trat heraus.
Bei Huberts Anblick rief sie erschrocken: «Ach du lieber Himmel, du bist ja ganz blau gefroren! Komm herein und wärme dich! Ich mache dir auch gleich etwas zu essen.» Sie zog Hubert in die Küche hinein und schob ihm einen Stuhl ans Feuer. Sie setzte Milch auf und fing an, den Tisch zu decken.
Hubert schaute sich in der heimeligen sauberen Küche um, und auf einmal wurden seine Augen gross und rund. Neben dem Herd stand das schwarze Spinnrad mit den Teufelshörnern.
«Wo habt Ihr denn das her?» stotterte Hubert. Die alte Frau lachte: «Gell Bub, das ist ein merkwürdiges Gestell! Mein Sohn hat es vor einer Stunde aus dem Bach gefischt. Es ist am Mühlrad hängen geblieben.»
Hubert bekam ganz rote Backen vor Freude: «Gott sei Dank, es gehört meiner Pflegemutter, ich muss es ihr schnell bringen. Sie hat meine kleine
Schwester eingesperrt, und es ist noch weit bis zum Hof.»
Dann nimm wenigstens etwas auf den Weg mit, heute ist doch Weihnachten», sagte die alte Frau. Sie füllte Huberts rechte Tasche mit Weihnachtsgebäck, die linke mit roten Rübchen. Dann packte sie ein grosses selbst gebackenes Birnbrot in rotes Seidenpapier und verschnürte es mit einem goldenen Band. Dieses Geschenk verstaute sie in einem kleinen Rucksack.
«Vergelt's Gott viel tausend Mal!» rief Hubert, packte das Spinnrad und machte sich auf den Weg zum «Weltende».
Er lief, so schnell er konnte, aber auf dem hart gefrorenen Schnee rutschte er immer wieder aus. Als er auf den steilen Waldweg kam, der zum Haus der bösen Frau führte, dunkelte es schon. Auf einmal leuchteten ihm zwei gelbe Augen entgegen, und vor ihm stand ein grosser grauer Wolf. Er fletschte die Zähne, und Hubert hatte nur einen Gedanken: Was wird aus Käthi, wenn der Wolf mich auffrisst?
Blitzschnell holte er ein Weihnachtsguetzli aus dem Hosensack und hielt es dem Wolf vors Maul. Der Wolf sperrte seinen grossen Rachen auf, und schwupp — schon hatte er das Zuckerringlein hinuntergeschluckt. Dann stellte er sich auf die Hinterbeine, machte Männchen wie ein zahmer Hund und frass hintereinander noch vier Anisbrötlein, drei Butterkringeln und zwölf Zimtsterne. Als der Wolf das ganze Weihnachtsgebäck aufgefressen hatte, machte er rechtsumkehrt und verschwand im dichten Wald.
Hubert kletterte weiter auf seinem beschwerlichen Weg, hungrig und mit schmerzenden Füssen. Wie aus heiterem Himmel stand plötzlich ein riesiger Bär vor ihm. Er stellte sich auf die Hinterbeine und patschte die dicken Pfoten zusammen wie ein Kind, das bitte, bitte sagt. Hubert zog ein Rübchen nach dem anderen aus der Tasche und streckte sie dem Bären hin. Der frass alle Rübchen auf, brummte zufrieden und trottete davon.
Es war schon Mitternacht, als Hubert endlich zu Hause ankam. Die böse Frau stürzte ihm mit dem Uhu auf der Schulter entgegen. Als sie das Spinnrad erblickte, heulte sie laut auf vor Freude: «Mein
Spinnrad, mein Spinnrad!»
Sie drückte das Möbel an sich und tanzte wie eine Verrückte damit herum. Dann setzte sie sich rittlings darauf wie auf einen Besen, sauste auf ihrem sonderbaren Gefährt den steilen Abhang
hinunter und ward nicht mehr gesehen.
Der Wind heulte und tobte, es donnerte und krachte, und von weither hörte man noch den Uhu schreien: «Uhu, uhu, jetzt fahren wir dem Teufel zu!»
Hubert befreite seine kleine Schwester, fand in einer Schublade zwei Kerzen, steckte sie auf einen Tannenast und zündete sie an. Die Kinder assen zusammen das Birnbrot und tranken heisse Geissenmilch dazu.
Am nächsten Morgen schien hell die Sonne. Hubert führte Käthi über die glitzernden Schneefelder hinab ins Dorf und erzählte, was geschehen war. Die Kinder kamen zu guten Leuten in Pflege, und von nun an wuchsen sie glücklich auf. Von der bösen Hexe, ihrem Spinnrad und dem Uhu hat man nie mehr etwas gehört.
ein Volksmärchen aus der Schweiz
DER FUCHS UND DIE SCHNECKE ...
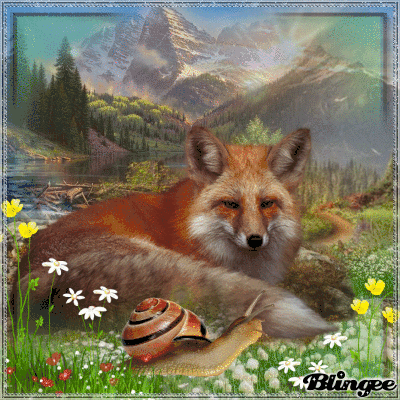
Meister Fuchs hatte einmal an einem warmen Sommertag in der Schwägalp gelagert; da erblickte er neben sich eine Schnecke. Der trug er flugs eine Wette an: wer von ihnen beiden schneller nach St. Gallen laufen könne. Topp, sagte die Schnecke und machte sich ohne Verzug auf den Weg - zwar ein wenig langsam, denn das Haus auf dem Rücken nahm sie gewohnheitshalber auch mit.
Der Fuchs hingegen lagerte sich allfort gemächlich, um erst am kühlen Abend abzuziehen, und so schlummerte er ein. Diesen Anlaß benutzte die Schnecke und verkroch sich heimlich in seinen dicken Zottelschwanz.
Gegen Abend begab sich nun der Fuchs auf den Weg und war verwundert, daß er der Schnecke nirgends begegnete. Er vermutete, sie werde einen kürzern Weg eingeschlagen haben. Als er aber vor dem Tore von St. Gallen noch immer nichts von ihr sah, da wandte er sich stolz um und rief höhnisch: »Schneck, kommst bald?«
»Ich bin schon da!« antwortete die Schnecke; denn sie hatte sich unbemerkt aus seinem Schwanz los gemacht und schlich gerade unterm Tor durch. Da mußte der hochmütige Fuchs die Wette verloren geben.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE BEIDEN HIRTEN ...

Es waren einmal zwei Hirten, die trieben ihre Herden auf ungleiche Weiden. Der eine ließ sein Vieh nur auf steinigem, unfruchtbarem Boden grasen, damit es nicht im Überfluß mutwillig werde und ihm das Hüten erschwere.
Das ertrugen aber die armen Tiere nicht lange; sie magerten und schwächten so ab, daß sie ihm endlich einmal auf dem Flecke liegen blieben. Dafür wurde der Hirte zur Strafe in einen Wiedehopf verwandelt, der muß nun in einem fort hüp! hüp! schreien, um sie wieder heim zu bringen.
Der andere Hirte dagegen trieb sein Vieh auf lauter fette Weide, denn er wollte es vor der Zeit fett haben. Davon wurden aber die Tiere wild und übermütig und sprangen rechts und links aus; und nun warf er ihnen Steine und Stöcke nach, wie es ihm eben in die Hand fiel, und warf manche von ihnen krank und lahm.
Da wurde er zur Strafe in eine Rohrdommel verwandelt, die ruft nun unaufhörlich Oha! um die davon Gelaufenen zum Stehen zu bringen. Wer Ohren hat, der hört es.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
RIESENBIRNE UND RIESENKUH ...

In alten Zeiten gab es in unserm Lande Birnen, die waren tausend Mal größer als die jetzigen; das waren die »überwelschen«. Wenn so eine überwelsche Birne abgefallen war, wurde sie in den Keller gerollt und da zapfte man ihr den Saft ab.
Zwei Männer sägten mit der Waldsäge den Stiel ab und fuhren ihn in die Sägemühle, wo die Bretter für das Täferholz daraus geschnitten wurden.
Viel Sorge machte es den Leuten dazumal, die Milch aufzuheben. Die Kühe waren nämlich so groß, daß man Teiche graben mußte, um die viele Milch, die sie gaben, darin aufzufangen.
Alle Tage fuhren dann die Sennen auf kleinen Schiffen in dem Teich herum und schöpften den Rahm ab. Das merkwürdigste waren aber die großen Kuhhörner: Die waren so lang, wenn man um Ostern hinein blies, so kam der Ton um Pfingsten heraus.
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
DIE HENNENKRIPPE ...
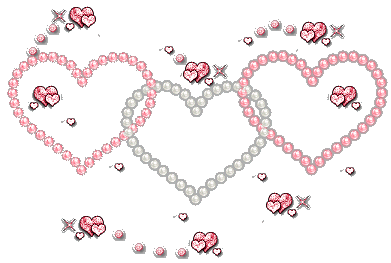
Ein Büble und ein Mädchen, die, um Erdbeeren zu pflücken, ausgegangen waren, verirrten sich im Walde. Es fiel die Nacht ein und die zwei armen Geschöpfe wußten nun gar nicht mehr, wo aus und wo ein. Plötzlich schimmerte ihnen ein Licht entgegen, und sie liefen eilends über Stock und Stein auf das selbe zu und kamen in die Hütte der Waldfänkin.
Sie klagten der Wilden Frau, daß sie sich beim Erdbeerpflücken im Walde verirrt hätten und in der dunkeln Nacht weder Weg noch Steg heim zur Mutter wüßten. Die Waldfänkin, die aufmerksam zugehorcht hatte, erfaßte die beiden Kleinen und sperrte sie in die Hennenkrippe.
Nach einer Weile kam der Wilde Mann, der Gemahl der Waldfänkin, in die Hütte und schnupperte aus weit geöffneten Nasenlöchern, sein unförmliches, breites Gesicht gegen die Hennenkrippe gewendet: »I schmeck, i schmeck Menschenfleisch«, grinste er. »Du Narr!« entgegnete die Waldfänkin, »du schmeckst nu Hennadreck.«
Der Wilde gab sich zufrieden und trottete brummend aus der Hütte. Darauf öffnete die Waldfänkin die Hennenkrippe, ließ die Kinder aus und führte sie zum Walde hinaus bis auf den Weg, der sie schnurstracks heim zur Mutter führte.
Könnt ihr euch denken, wie viel das Büble und das Mädchen von dem finstern Walde, dem Wilden Manne und der Waldfänkin, durch deren List sie gerettet wurden, der Mutter zu erzählen hatten!
Schweiz: Otto Sutermeister: Kinder- und Hausmärchen aus der Schweiz
