"VERZEICHNIS
"Das Leben der Hochgräfin Gritta"
"Die Bergelfe und die Saat des Zauberwaldes"
"Das Märchen vom Kobold und der Königstochter"
"Die drei Fragen"
"Der Schneemann und die Schneekönigin"
"Die Geschichte vom müden Weihnachtsmann"
"St. Nikolaus, die Geschichte eines Bischofs"
"Eine kleine Weihnachtsgeschichte"
"Der Christbaumständer"
"Rudolph, das Rentier mit der roten Nase"
"Die Gabe der Weisen"
"Von kleinem Finchen und dem Zauberstöckchen"
"Warum die Tanne Christbaum ist"
"Der allererste Weihnachtsbaum"
"Die Salzprinzessin"
"Das andere Land"
"Sternsplitter"
"Die Jenaische Christnachttragödie"
"Das Weihnachtsfest"
"Woher der Fliegenpilz seine weißen Flecken hat"
"Die Geschichte von den sieben weißen Mäusen"
"Wie der Hirsch zu seinem schönen Geweih kam"
"Vom roten und gelben Fingerhut"
"Im Garten der Seejungfrau"
"Wie der Frosch Schulze vom Teich wurde"
"Von der stolzen Tanne"
"Das Märchen vom steinernen Krüppelchen"
"Der Sonnenfünkchen Erdenfahrt"
"Fee Sonnentau"
"Von Heidelbeeren und Preiselbeeren"
"Sternenmoos und Becherflechte"
"Hold Emmchen und der silberne Mann"
"Woher die Glockenblumen kommen"
"Warum Kiefer und Birke zusammenwohnen"
"Der kleine Wurzelprofessor"
"Der starke Zwerg auf dem Kyffhäuser"
"Das Kellermännchen"
"Der kleine Tannenbaum"
"Die Postkutsche"
"Der Hampelmann"
"Der Generaloberhofzeremonienmeister"
"Das Männchen mit dem Kohlkopf"
"Das Tagewerk vor Sonnenaufgang"
"Der Schneemann"
"Mummelchen"
"Himmelsschlüssel"
"Vom kleinen Teufelchen und vom Muff, der Kinder kriegte"
"Die alte Burg bei Löbnitz"
"Thrin Wulfen"
"De Kröger van Poseritz" (Mundart)
"Der Falscheid"
"Der Alte von Granitz"
"Das Silberglöckchen"
"Die Unterirdischen in den Neun Bergen bei Rambin"
"Der Riese Balderich"
"Die alten und die jungen Frösche"
"Ein Bauer wirft einen Pfleger in den Bach"
"Die dankbare Maus"
"Kleine Fabel"
"Der Hamster und die Ameise"
"Das Geschenk der Feen"
"Das Märchen von der grünen Schlange und der weißen Lilie"
"Das harte Gelübde"
"Die Traumbuche"
"Das Märchen vom Schneider Siebentot auf einen Schlag"
"Das Märchen vom Murmeltier"
"Der Vogel und der Bauersmann"
"Der Lügner"
"Der Reiter und sein Ross"
"Das Märchen von den Kücheln"
"Ein gutes Rezept"
"Stumme Liebe"
"Das Wunderschiff"
"Der Wasserverkäufer"
"Richilde"
"Libertas und ihre Freier"
"Kannitverstan"
"Heino im Sumpf"
"Goldener"
"Eine Kindergeschichte"
"Drei Wünsche"
"Die künstliche Orgel"
"Die drei Diebe"
"Des Totengräbers Sohn"
"Der Wolf und die Nachtigall"
"Der Bäcker zu Dortmund"
"Der Rubin"
"Der Roßschweif an der Krippe"
"Der kleine Mohr und die Goldprinzessin"
"Der geheilte Patient"
"Das wohlbezahlte Gespenst"
"Pechvogel und Glückskind"
"Baron Hüpfenstich"
"Der gläserne Schuh"
"Wie der Teufel ins Weihwasser fiel"
WIE DER TEUFEL INS WEIHWASSER FIEL ...

Zeichnung zum Märchen von Richard Leander
Daß der Teufel öfters Unglück hat, weiß jedermann. Ja, es kommt so häufig vor, daß man einen Menschen, der Zahnschmerzen hat oder im Winter mit zerrissenen Stiefeln auf der Chaussee Steine klopfen muß oder dem sein Schatz an seinem Geburtstage einen Brief schickt, in dem kein Glückwunsch steht, wohl aber eine Absage auf immer - daß man sie alle drei arme Teufel nennt.
Eines Tages schnupperte der Teufel im Kölner Dome umher, in der Hoffnung, vielleicht ein fettes Mönchlein oder eine alte Betschwester zu erhaschen, da stolperte er und - plantsch! - fiel er mitten in das Becken mit dem Weihwasser hinein. Da hättet ihr sehen sollen, was er für Gesichter schnitt, wie er sprudelte und prustete und wie er flink machte, daß er wieder herauskam! Und wie er sich nachher schüttelte und wie ein begossener Pudel davon schlich! Dabei war es noch um die Weihnachtszeit, so daß er vor Frost klapperte, als er vor dem Dome stand, aus dem er schleunigst retiriert war, weil er fürchtete, daß die Frommen es bemerkt haben und ihn auslachen könnten.
"Was fang' ich nun an?" sagte er und besah sich von oben bis unten. "Zu Haus, in die Hölle, getraue ich mich in dem Aufzuge nicht. Meine Großmutter würde mir gut den Text lesen. Ich werde auf ein paar Stunden ins Mohrenland gehen, da ist es warm und ich kann meine Kleider trocknen. Außerdem werden heute dort Gefangene geschlachtet. Hab ich meinen Operngucker mit?"
Er ging also nach Mohrenland, sah beim Schlachten zu, klatschte tüchtig Bravo, wenn es ihm gefiel, und als sein Rock völlig trocken war, trollte er sich vergnügt nach Hause, in die Hölle. Als er aber kaum in die Stube eingetreten war und die Großmutter seiner angesichtig wurde, ward sie abwechselnd veilchenblau und schwefelgelb im Gesicht und rief:
"Wonach riechst du wieder einmal, und wie siehst du aus, du Lump?! Hast du dich schon wieder in den Kirchen herumgetrieben?" - Da erzählte der Teufel stotternd, was ihm passiert war.
"Zieh den Rock aus", herrschte die Großmutter ihn an, "und leg dich einstweilen ins Bett." Und der Teufel tat, wie ihm befohlen war, und zog sich das blau und rot karierte Federbett so weit über die Ohren, daß unten die schwarzen Fußspitzen herausguckten; denn er schämte sich gewaltig. Die Großmutter aber faßte den Rock mit zwei Fingern an seinem äußersten Zipfel wie die Köchin eine tote Maus am Schwanz.
"Brr!" sagte sie und schüttelte sich vor Ekel. "Wie der Rock aussieht!" Dann trug sie ihn in die Gosse, wo der ganze dicke Höllenschlamm und das ganze Spülwasser aus der Hölle abläuft, zog ihn ein paarmal durch, weichte ihn ein und wusch ihn in der Gosse. Darauf hing sie ihn über einen Stuhl ans Feuer und ließ ihn trocknen.
Als er ganz trocken war und der Teufel eben schon ein Bein aus dem Bett herausstreckte, um aufzustehen und den Rock anzuziehen, nahm sie den Rock noch einmal und beroch ihn: "Pfui!" sagte sie und nieste, "was doch so ein Kirchengeruch schwer wegzubringen ist", holte ein Kohlenbecken, streute ein paar Hände voll klein gehackter Hundehaare und geraspelter Pferdehufe darauf, und wie es so recht brenzlig zu riechen begann, hielt sie den Rock darüber.
"So", sagte sie zum Teufel, "nun ist der Rock rein, nun kannst du dich doch wieder in anständiger Gesellschaft sehen lassen! Aber ich verbitte mir, daß so etwas wieder vorkommt! Verstehst du mich?"
Richard von Volkmann-Leander
DER GLÄSERNE SCHUH ...

Ein Bauer aus Rothenkirchen, Johann Wilde genannt, fand einmal einen gläsernen Schuh auf einem der Berge, wo die kleinen Leute zu tanzen pflegen. Er steckte ihn flugs ein und lief weg damit und hielt die Hand fest auf der Tasche, als habe er eine Taube darin. Denn er wusste, dass er einen Schatz gefunden hatte, den die Unterirdischen teuer wiederkaufen müssten.
Andere sagen, Johann Wilde habe die Unterirdischen mitternächtlich belauert und einem von ihnen den Schuh ausgezogen, indem er sich mit einer Branntweinflasche dort hingestreckt und gleich einem Besoffenen gebärdet habe. Denn er war ein sehr listiger und schlimmer Mensch und hatte durch seine Verschlagenheit manchen betrogen und war deswegen bei seinen Nachbarn gar nicht gut angeschrieben, und keiner hatte gern mit ihm zu tun.
Viele sagen auch, er habe verbotene Künste gekonnt und mit den Unholden und alten Wettermacherinnen geheimen Umgang gepflogen. Als er den Schuh nun hatte, tat er es denen, die unter der Erde wohnen, gleich zu wissen, indem er um die Mitternacht zu den Neun Bergen ging und lauten Halses schrie: "Johann Wilde in Rothenkirchen hat einen schönen gläsernen Schuh, wer kauft ihn? Wer kauft ihn?"
Denn er wusste, dass der Kleine, der einen Schuh verliert, den Fuß solange bloß tragen muss, bis er in wiederbekommt. Und das ist keine Kleinigkeit, da die kleinen Leute meist auf harten und steinigen Boden treten müssen. Der Kleine säumte auch nicht, ihn wieder einzulösen. Denn sobald er einen freien Tag hatte, wo er an das Tageslicht hinaus durfte, klopfte er als ein zierlicher Kaufmann an Johann Wildens Türe und fragte, ob er nicht gläserne Schuh zu verkaufen habe? Denn die seien jetzt eine angreifische Ware und werden auf allen Märkten gesucht.
Der Bauer antwortete, er habe einen sehr kleinen, netten gläsernen Schuh, so dass auch eines Zwerges Fuß davon geklemmt werden müsse, und dass Gott erst eigene Leute dazu schaffen müsse; aber das sei ein seltener Schuh und ein kostbarer Schuh und ein teurer Schuh, und nicht jeder Kaufmann könne ihn bezahlen.
Der Kaufmann ließ ihn sich zeigen und sprach: "Es ist eben nichts so Seltenes mit den gläsernen Schuhen, lieber Freund, als Ihr hier in Rothenkirchen glaubt, weil Ihr nicht in die Welt hinaus kommt"; dann sagte er nach einigen Hms: "Aber ich will ihn doch gut bezahlen, weil ich gerade einen Gespann dazu habe." Und er bot dem Bauern tausend Taler.
"Tausend Taler ist Geld, pflegte mein Vater zu sagen, wenn er fette Ochsen zu Markt trieb", sprach der Bauer spöttisch; "aber für den lumpigen Preis kommt er nicht aus meiner Hand, und mag er meinethalben auf dem Fuße von der Docke meiner Tochter prangen. Höre Er, Freund, ich habe von dem gläsernen Schuh so ein Liedchen singen hören, und um einen Quark kommt er nicht aus meiner Hand.
Kann Er nicht die Kunst, mein lieber Mann, dass ich in jeder Furche, die ich auspflüge, einen Dukaten finde, so bleibt der Schuh mein, und Er fragt auf anderen Märkten nach gläsernen Schuhen." Der Kaufmann machte noch viele Versuche und Wendungen hin und her; da er aber sah, dass der Bauer nicht nachließ, tat er ihm den Willen und schwur es ihm zu.
Der Bauer glaubte es ihm und gab ihm den gläsernen Schuh; denn er wusste, mit wem er es zu tun hatte. Und der Kaufmann ging mit seinem Schuh weg. Und nun hat der Bauer sich flugs in seinen Stall gemacht und Pferde und Pflug bereitet und ist ins Feld gezogen und hat sich ein Stück mit der allerkürzesten Wendung ausgesucht, und wie der Pflug die erste Scholle gebrochen, ist der Dukaten aus der Erde gesprungen, und so hat er es bei jeder neuen Furche wieder gemacht.
Da ist des Pflügens denn kein Ende gewesen, und der Bauer hat sich bald noch acht neue Pferde gekauft und auf den Stall gestellt zu den achten, die er schon hatte, und ihre Krippen sind nie leer geworden von Hafer, damit er je alle zwei Stunden zwei frische Pferde anschirren und desto rascher treiben könnte.
Und der Bauer ist unersättlich gewesen im Pflügen und ist immer vor Sonnenaufgang ausgezogen und hat oft noch nach der Mitternacht gepflügt, und immerfort, immerfort, solange die Erde nicht zu Stein gefroren war, Sommer und Winter. Er hat aber immer allein gepflügt und nicht gelitten, dass jemand mit ihm gegangen oder zu ihm gekommen ist; denn er wollte nicht sehen lassen, warum er so pflügte.
Und er ist weit geplagter gewesen als seine Pferde, welche den schönen Hafer fraßen und ordentlich Schicht und Wechsel hielten; und er ist bleich und mager geworden von dem vielen Wachen und Arbeiten.
Seine Frau und Kinder haben keine Freude mehr an ihm gehabt; auf die Schenken und Gelage ist er nicht mehr gegangen und hat sich allen Leuten entzogen und kaum ein Wort mehr gesprochen, sondern ist stumm und in sich gekehrt so für sich hingegangen und hat des Tages auf seine Dukaten gearbeitet, und des Nachts hat er sie zählen und darauf grübeln müssen, wie er noch einen geschwinderen Pflug erfände.
Und seine Frau und die Nachbarn haben ihn bejammert wegen seines wunderlichen Tuns und wegen seiner Stummheit und Schwermut und haben geglaubt, er sei närrisch geworden; auch haben alle Leute seine Frau und Kinder bedauert, denn sie meinten, durch die vielen Pferde, die er auf dem Stalle hielt, und durch die verkehrte Ackerwirtschaft mit dem überflüssigen Pflügen müsse er sich um Haus und Hof bringen.
So ist es aber nicht ausgefallen. Aber das ist wahr, der arme Bauer hat keine vergnügte Stunde mehr gehabt, seit er so die Dukaten aus der Erde pflügte, und es hat wohl mit Recht von ihm geheißen: Wer sich dem Golde ergibt, ist schon halb in des Bösen Klauen.
Auch hat er es nicht lange ausgehalten mit diesem Laufen in den Furchen bei Tage und Nacht. Denn als der zweite Frühling kam, ist er eines Tages hinterm Pflug hingefallen wie eine matte Novemberfliege und vor lauter Golddurst vertrocknet und verwelkt, da er doch ein sehr starker und lustiger Mensch war, ehe er den unterirdischen Schuh in seine Gewalt bekam.
Seine Frau aber fand nach ihm einen Schatz, zwei große vernagelte Kisten voll heller, blanker Dukaten. Und seine Söhne haben sich große Güter gekauft und sind Herren und Edelleute geworden. So macht der Teufel zuweilen auch große Herren. Aber was hat das dem armen Johann Wilde gefrommt?
Ernst Moritz Arndt
BARON HÜPFENSTICH ...
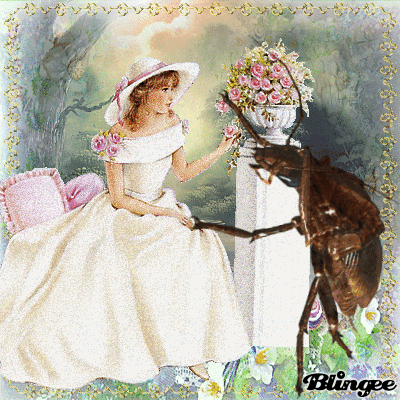
In dem ehrlichen Lande regierte der König Haltewort, ein sehr guter, aber noch viel strengerer Herr, dann und wann auch sehr grob. Er hatte sehr viel zu tun, denn er hielt Wort, und seine Vorfahren waren so vielversprechende Herren gewesen, dass er alle Hände voll hatte, für sie Wort zu halten, besonders da einer manchmal das Gegenteil vom anderen versprochen hatte. Aber das machte ihn nicht irr. Er hielt immer recht wacker zu Wort. Sonst kümmerte er sich um nichts und war gar nicht neugierig; denn er fürchtete immer, er möchte ein neues Versprechen erfahren, das er halten müsse, und das wäre ihm fatal gewesen.
Er lebte sehr friedlich in seinem Lande und hatte mit allen Königen der Welt einen Frieden geschlossen, welcher in den Worten bestand: "Tue mir nichts, ich tue dir auch nichts." Dieser gute König hatte eine Tochter, die sehr neugierig war und überall mit ihrem Näschen vorne dran sein musste. Sie war so neugierig gewesen, zu wissen, wie es auf der Welt aussähe, dass ihre Mutter ihr noch gar die Wiege nicht zurechtgemacht hatte, als das Kind schon vom Himmel herab der Frau Mutter entgegenhüpfte, worüber die gute Königin, die gern alles in der Ordnung hatte, vor Schrecken starb, indem sie ihr Töchterlein ans Herz drückte und sprach:
"Mein Kind will wissen, wie es auf der Welt aussieht, drum muss ich sehen, wie es im Himmel aussieht. Möge die Woche, um die du mir zu früh gekommen bist, dir einstens treue Dienste leisten!" Nach diesen Worten starb die Königin, und die umstehenden Frauen zeigten dem herbeigerufenen König Haltewort den Tod der Königin und die Geburt seiner Tochter an.
Der König fragte vor allem: "Wie lauteten die letzten Worte meiner Gemahlin, damit ich sie ihr halten kann, da sie selbst gestorben ist?"
Da sagte die älteste Hofdame: "Sie sprach: Mein Kind will wissen" - "So soll die Prinzessin heißen," sagte der König; "sie soll Prinzess Willwischen heißen, weil die sterbende Mutter sie so angeredet." Nun ließ er sich noch die übrigen Worte der Verstorbenen sagen: aber da war nichts beizuhalten; nur dass die Woche, um die sie zu frühe gekommen, ihr große Dienste leisten solle, das konnte er nicht recht begreifen und nahm sich vor, viel darüber nachdenken zu lassen. Nun ließ er die gute Königin ins Grab und das Kind Willwischen in die Wiege legen.
Eine große Sorge hatte der gute König jetzt, die plagte ihn sehr, er hatte seiner Gemahlin versprochen, er wolle, wenn sie vor dem Kinde sterbe, Mutterstelle an ihm vertreten. Wie er das machen sollte, wenn er Wort halten sollte, wusste er nun gar nicht, er ließ auch darüber stark nachdenken. Und siehe da, nach einer halben Stunde kam der Hofnachdenker herein und sprach: "Ihro Majestät, haben Sie etwas heraus?" Der König sagte: "Haben Sie etwas?" Der Nachdenker sagte: "Ihro Majestät, ich habe nichts heraus," und der König sagte: "Und habe auch nichts." Da sagte der Nachdenker: "Da haben wir also alle beide nichts heraus," und nun gingen sie wieder frisch ans Nachdenken. Nach einer Stunde kamen sie ebenso zusammen und gingen ebenso auseinander.
Nun hätten die Hofdamen dem Kind Willwischen gern eine Amme gegeben, aber Haltewort gab es nicht zu und sagte, er wolle schon Wort halten und selbst Mutterstelle vertreten. Zur größten Verwunderung schien das Kind Willwischen gar keine Nahrung zu bedürfen, es ward dick und gesund, und der König glaubte, dass es bloß von seinem Nachdenken lebe. Endlich fiel es ihm einmal in der Nacht ein, dass eine gute Mutter manchmal nachts nach dem Kinde sehen müsse. Das ließ er sich nicht zweimal einfallen, sondern sprang gleich beim erstenmal mit beiden Beinen aus dem Bett und ging in die Nebenstube, wo die Wiege stand.
Ganz sachte, sachte machte er die Türe auf; aber welche Wunder sah er da! Eine ziemlich alte Frau hatte das Kind Willwischen an der Brust, und sieben andre Wickelkinder lagen vor ihr, hübsch eingefatscht wie sieben Backfische, in einer Reihe an der Erde. "Ei, das ist eine Kunst," schrie der König, "wenn Ihr dem Kinde zu trinken gebt, aber es geht platterdings nicht an, ich habe versprochen, Mutterstelle zu vertreten, und darum dürft Ihr nicht, also marsch fort! Nehmt Eure sieben Backfische nur in der Schürze mit und lasst Euch nicht mehr hier sehen!"
"Gebt mir meinen Wochenlohn!" sagte die Frau und gab dem Willwischen frische Windeln und legte es in die Wiege; da gab ihr der König seine Traumbörse; denn er nahm immer einen Beutel voll Gold mit ins Bett, um, wenn ihm in der Nacht jemand im Traum vorkam, dem er bei Tag Geld versprochen hatte, Wort halten zu können.
Nun sagte die Frau zum König: "Haltewort, ich verlasse dein Kind, jetzt ist ohnedies meine Zeit aus, es ist gleich zwölf Uhr, und ... geht an; aber weil du mir meinen Wochenlohn so ehrlich gezahlt hast, so will ich dir auch sagen, wie du an dem Kind Mutterstelle vertreten kannst, du musst mir aber versprechen, dem ersten Verbrecher, der dich beleidigt, und sollte er dich auch bis aufs Blut stechen, zu verzeihen und ihn mit dem Besten, was du hast, zu ernähren." "Bis aufs Blut stechen," sagte der König, "das ist ein starkes Stück, aber ich verspreche es dir, aus mütterlicher Liebe." "Wohlan," sagte die Frau, "so ernähre den Verbrecher, und du wirst dein Kind ernähren", und verschwand.
Der König aber fühlte einen Stich in den Arm und erwachte; da sah er, dass ihm nur geträumt hatte, denn er lag ganz breit in seinem Bette. Der heftige Stich, den er am linken Arm fühlte, machte, dass er dahin fasste, und was ergriff er da? Einen sehr großen Floh. Erzürnt rieb der König ihn zwischen den Fingern und wollte ihn soeben mit dem Nagel tot knicken, als ihm sein Versprechen, das er der Frau im Traum gegeben, einfiel: er wolle dem Verbrecher nicht allein verzeihen und ihn sogar mit seinem Besten ernähren. Er setzte daher den Floh in ein leeres Medizinglas gefangen und sprach:
"Dir soll verziehen sein, und du sollst mein Blut trinken." Dieses tat er besonders, weil er seine Traumbörse nicht mehr fand und also gewiss glaubte, er habe sie der Frau gegeben, und sie müsste doch etwas mehr als ein leeres Traumgebilde sein. Er dachte einige Stunden lang über diese Sache nach und betrachtete den Verbrecher in dem Arzneiglas; der schien zu schlafen. Er schüttelte das Glas, da wurde der Floh wach, und das Kind Willwischen weinte in der Nebenstube. Er wiegte das Arzneiglas, da hörte er auch die Wiege des Kindes sich bewegen, und Floh und Kind schliefen ein, und Haltewort auch.
Morgens weinte das Kind wieder, und der Floh war sehr unruhig im Glase; der König setzte den Floh auf seinen Arm und ließ ihn sein Blut trinken, da ward auch das Kind Willwischen still. Genug, der König merkte, dass alles, was er dem Floh tat, der Prinzessin auch geschah, und deswegen ließ er dem Floh nichts abgehen, und auch das Kind Willwischen ward groß und stark. Der Verbrecher im Arzneiglas aber ward bald so dick und fett, dass er keinen Platz mehr in dem Glase hatte und in eine Flasche musste gesetzt werden.
Der König tat dieses sehr insgeheim, und niemand hatte den Floh bis jetzt gesehen. Bald war auch die Flasche nicht mehr groß genug, und der König setzte ihn in seinen Stiefel, aber nun wurde es dem König unmöglich, ihn länger zu ernähren, denn er wurde selbst ganz krank und mager darüber. Er fing daher an, das Kind Willwischen mit Mehlbrei zu füttern, und gab dem Floh Ochsenblut. Und so wuchs die Prinzessin und der Floh heran, ohne sich persönlich zu kennen; der Floh war schon so groß geworden wie ein Rind, und Willwischen sechzehn Jahre alt, als ein unglücklicher Zufall sie bekannt machte.
Willwischen war ganz erstaunlich neugierig und guckte durch alle Schlüssellöcher. Nun hätte sie längst gern gewusst, was der König nur immer in seiner Schlafkammer verborgen habe; denn nie wollte er sie hineinlassen, und doch hörte sie oft ein gewaltiges Geschnurre und Geklapper drin, als wenn ein Geißbock darin herumspringe. Die Neugier ließ sie nun gar nicht mehr ruhen, und so lauschte sie einstens in der Nacht an der Türe des Königs, der folgendes Gespräch mit dem Floh hielt, von dem sie aber nicht wusste, dass es ein Floh war.
Der König sprach: "Sag mir einmal, du Bengel, was soll ich nur mit dir anfangen? Du wächst mir über den Kopf und machst mir die Stube fast zu enge." Da antwortete der Floh: "Bester König, ich kann es auch gar nicht mehr vor Langeweile hier aushalten; und dächte, du gäbst mir eine hübsche Livree und machtest mich zum Edelknaben bei meiner Schwester Willwischen."
"Schwester? Wie meinst du das? Unterstehst du dich, die Prinzessin deine Schwester zu nennen?" sagte der König, und der Floh sprach hierauf: "Bin ich etwa nicht von königlichem Geblüt?" "Gewissermaßen wohl," erwiderte der König, "aber ich verbitte mir, davon zu sprechen." "Was braucht es viele Worte?" sagte der Floh. "Ich verlange standesmäßigen Unterhalt; ich mag nicht länger unter Eurem Bett neben alten Pantoffeln schlafen, es liegt ein juchtenledernes Felleisen da unter, dessen Geruch mir schrecklich zuwider ist; ich sage dir, König, lässt du mich nicht zu Willwischen, so steche ich mich selbst tot." "Gut," sagte der König, "es soll geschehen. Jetzt schlafe wohl, mein Herr von Hüpfenstich!" "Ich danke für den Titel, Herr König Haltewort! Schlafet wohl!" sprach der Floh.
Nun ward es still in des Königs Kammer, und Willwischen legte sich zu Bett, aber schlafen konnte sie nicht; die Neugier, wer ihr Bruder gewissermaßen sei, wer ihr Edelknabe werden wolle, ließ sie nicht ruhen. Am anderen Morgen ward der Hofschneider zum König gerufen. Als er herauskam, rief ihm die Prinzessin: "Heda, Herr Höllenfleckel, was hat der König bestellt?" Der Schneider sagte: "Einen vollständigen Anzug für Herrn von Hüpfenstich, Ihre königliche Hoheit." "Wer ist Herr von Hüpfenstich?" sagte die Prinzessin. "Ach, ein sehr munterer Herr," sagte der Schneider, "ich habe ihm über Tisch und Brett nachspringen müssen, als ich ihm das Maß nahm; aber die Arbeit pressiert. Untertänigster Diener!" und so lief er fort.
Nun kam der Schuster aus des Königs Zimmer. "Heda, Herr Schlappenpich,", rief Willwischen, "was hat der König bestellt?" - "Tanzschuhe und Samtstiefel für den Herrn von Hüpfenstich", sagte er. "Wer ist das?" sagte sie. "Ei ein Herr von ungemeiner Leichtfüßigkeit, ich musste ihm über Tisch und Bänke nachsetzen, ihm das Maß nehmen; aber die Arbeit pressiert. Gehorsamer Diener!" sagte der Schuster. Nun kam der Perückenmacher heraus, und mit dem ging es ebenso.
Endlich kam der König auch heraus und fand Willwischen ganz betrübt in der Ecke des Saales sitzen. "Was fehlt dir, mein Kind Willwischen?" sagte er. "Ei, ich habe einen kuriosen Traum gehabt", sagte sie, "und den musst du mir erfüllen, Vater, sonst werde ich krank." "Wenn's möglich ist, so soll es geschehen," sagte der König, und Willwischen sagte nun, sie habe geträumt, dass sie einen sehr schönen und flinken Edelknaben gehabt, und der habe ihr unendliche Freude gemacht mit seiner großen Leichtigkeit und Geschicklichkeit, aber sie habe gar nicht erfahren können, wo er her sei, und nun solle ihr der König sagen, wo der Edelknabe her sei.
Der König sprach: "Einen Edelknaben, der leicht und geschickt ist, sollst du haben; wo er aber her ist, muss er dir selbst sagen, ich weiß es nicht. Morgen soll er dir beim Frühstück zuerst aufwarten." Die Prinzessin musste sich gedulden. Als der Schneider am anderen Morgen die braunsamtene Uniform mit goldnen Tressen brachte, betrachtete sie Willwischen sehr neugierig, so auch die roten Saffianstiefel, die der Schuster brachte, und die schöne braune Perücke und alles, was in des Königs Stube getragen wurde.
Endlich ging die Tür auf, der König trat heraus, und neben ihm stand ein sehr kurioser Kerl, der große Floh, Herr von Hüpfenstich, in einem braunsamtenen Husarenhabit, mit roten Stiefeln, einer schwarzen Bärenmütze und einer großen Allongeperücke; er hatte eine Tasse Schokolade auf einem goldnen Präsentierteller in der Hand und schien sich eine entsetzliche Gewalt anzutun und sich gewaltig zurückzuhalten. Er war so auf dem Sprung wie ein gespannter Hahn an einer Flinte, wenn der Finger des Schützen am Drücker liegt; er stand da wie ein Aderlassschnepper über der Ader.
Die Prinzessin saß am anderen Ende des Saales und stand auf, dem König guten Morgen zu sagen. Dieser blieb aber in der Entfernung stehen und sprach: "Willwischen, hier bringt dir der Herr von Hüpfenstich, dein neuer Edelknabe, eine Tasse Schokolade; und hoffe, er wird seine Sache gut machen und dir gefallen."
Willwischen verneigte sich und streckte die Augen vor Neugier wie eine Schnecke heraus. "Ihro Majestät haben zu befehlen", sprach sie. Da sagte der König zu dem braunen Husaren: "Nun, Hüpfenstich, lasse Er sehen, wie Er eine Prinzessin zu bedienen weiß!" Kaum hatte der König diese Worte halb ausgesprochen, als der Hüpfenstich mit seiner Schokolade einen Bogensprung durch den langen Saal machte und vor der Prinzessin mit seinem Präsentierteller auf den Knien lag. Die Prinzessin war so darüber erschrocken, dass sie mit einem Schrei in Ohnmacht fiel.
Herr von Hüpfenstich wusste aber so, was er zu tun hatte, dass der König kaum am anderen Ende des Saales angekommen war, um ihm ein paar Ohrfeigen zu geben, als er die Prinzessin auch schon durch einen Aderlass am Arm wieder zu sich zu bringen suchte. Der König geriet über diese Aufmerksamkeit in das größte Vergnügen, und als Willwischen die Augen aufschlug, drehte Herr von Hüpfenstich bereits den Quirl in der Schokoladenkanne so geschwind, dass sie die Schaumschokolade mit großem Appetit genoss und sich bald erholte.
Alles dieses ging so geschwind und plötzlich, dass einem Hören und Sehen verging; aber der König ernannte ihn sogleich zum Geheimen Geschwindigkeitsrat und gab ihm den schnellen Katharinenorden. Zugleich ließ er ihm die Stiefel so schwer mit Gold beschlagen, dass er nicht mehr so entsetzlich springen konnte, und so ging es eine Zeit lang recht gut.
Willwischen konnte ohne Hüpfenstich nicht mehr leben; allen Hofdamen musste er zur Ader lassen, alle schnellen Geschäfte musste er ausführen. Besonders schön wusste er hinten auf den Wagen zu springen, und auf der Hasenhetze war er allen Hunden voraus. Kurz, er war so angenehm, dass alles die Finger nach ihm leckte. Es ist nicht zu wundern, dass er durch diese großen Begünstigungen endlich sehr frech und sehr hoffärtig ward, viele ehrliche Leute quälte und plackte und alle die, welche sich zurückgesetzt sahen, nur auf eine Gelegenheit harrten, ihn aus der Gnade des Königs und womöglich ins höchste Verderben zu bringen.
Als ihm der König einstens mit Übergehung vieler verdienter Offiziere ein Husarenregiment gab, wurde der Unwille auf das höchste gereizt, und die zurückgesetzten Offiziere machten eine förmliche Verschwörung gegen ihn. Einer unter ihnen, der Rittmeister Zwickelwichs, nahm das Geschäft auf sich, den Hüpfenstich ins Unglück zu stürzen. Er schmeichelte sich bei ihm ein und wurde endlich sein vertrauter Freund und lobte alle seine Eigenschaften so, dass Hüpfenstich vor Hoffart fast zum Narren ward; endlich setzte er ihm in den Kopf, er solle bei dem König die Prinzessin Willwischen zur Gemahlin begehren. Der Prinzessin aber ließ er durch ihre Kammerfrauen die größte Neugier erregen, wer Hüpfenstich doch wohl eigentlich sei.
Hüpfenstich ward der Kopf bald so verdreht, dass er einstens den König nach der Parade beiseite zog und ihm sagte: "Ihro Majestät sind von meinen Verdiensten so überzeugt, dass Sie mich nicht abschlagen werden, der Gemahl Ihrer Tochter Willwischen zu werden." Der König sprach hierauf zu ihm sehr erzürnt: "Hopp, hopp! Herr von Hüpfenstich, weiß Er, wer Er ist? Wenn Er es nicht weiß, will ich es Ihn lehren," und somit drehte er ihm den Rücken.
Hüpfenstich schüttelte es durch Mark und Bein, als er dies gehört hatte; es war ihm nur einmal so gewesen in seinem Leben, nämlich als ihn der König, da er ihn noch als gemeinen Floh zum erstenmal in den Arm stach, zwischen den Fingern rieb. Finster und ahnungsvoll führte er sein Regiment unter Willwischens Fenster vorbei, aber er ließ nicht ihr Lieblingsstückchen blasen, er ließ seine Pferdchen nicht tanzen. Die Prinzessin konnte gar nicht begreifen, warum er diese gewöhnliche Artigkeit unterlassen habe. "Ach," dachte sie, "er muss wohl etwas sehr Vornehmes sein, dass er so stolz gegen mich tut; oh, wenn ich nur wüsste, wer er eigentlich ist!"
Rittmeister Zwickelwichs hatte wohl gesehen, wie der König den Hüpfenstich angefahren hatte, und suchte ihn nun auf, um ihn zu trösten. Er fand ihn in der Reitbahn, wo er aus Zorn und Ärger ganz verzweifelte Sätze machte. Als er ein wenig ruhig geworden, sagte der Zwickelwichs zu ihm: "Teurer Freund und Kamerad, du bist schrecklich gekränkt; das kannst du nicht auf dir sitzen lassen, ich will dir einen Vorschlag tun, der dich rächt und glücklich macht.
Du weißt, es ist das benachbarte Königreich jetzt in der Gewalt des Königs Allmeinius, er respektiert den Frieden: "Tue mir nichts, ich tue dir auch nichts" gar nicht und zieht bereits seine Strickleiter zusammen, uns den Krieg anzukünden; er hat mir herübersagen lassen, wenn Ihr mit dem Husarenregiment zu ihm kommen wollt, wollte er Euch zum Statthalter des ehrlichen Landes machen, sobald er den König Haltewort gefangen habe. Wie wär's, wenn Ihr das Willwischen hinter Euch auf den Sattel nähmt und über die Grenze rittet, und wir ritten alle hinterdrein?"
Dem übermütigen, zornigen Hüpfenstich gefiel diese Verräterei sehr gut, und er sagte zu dem Zwickelwichs: "Ich will die Prinzessin schon hinwegbringen, komme du mir nur mit den Husaren nach!"
Als alles dies verabredet war, ging Hüpfenstich zu der Prinzessin; sie war sehr verdrießlich und fragte warum er nicht ihr Leibstückchen habe blasen lassen bei der Parade. Hüpfenstich sagte: "Ach, Ihro Königliche Hoheit, es ist heute der Sterbetag meiner erhabenen Eltern; verzeihen Sie, dass mir die Trauer nicht erlaubte, die Trompete blasen zu lassen." "Aber," sagte die Prinzessin, "wer sind Eure Eltern? Ihr wollt mir sie nie nennen." "Hier darf ich's nicht," erwiderte Hüpfenstich, "ach, ich bin sehr unglücklich; wenn ich Euch hier sage, wer ich bin, so muss ich sterben."
"Das ist außerordentlich kurios," sagte sie, "aber ich muss und will es wissen teurer Freund! Gibt es denn gar kein Mittel, mir es zu sagen?" "Eines, teure Prinzessin, wenn Ihr heute Abend im Mondschein wollt am Ende des Schlossgartens spazieren gehen, da werde ich es wagen, ganz unbelauscht Euch das wunderbare Geheimnis zu vertrauen." Die Prinzessin willigte ein, sie kam gegen Abend an das Ende des Schlossgartens, da war Hüpfenstich; aber er sagte der Prinzessin nichts, er schwang sie auf den Rücken und machte so ungeheure Sprünge mit ihr bis in das Land des Königs Allmein.
Als er über die Grenze war, setzte er die weinende Prinzessin in einem Walde in das Gras und sagte ihr: "Willwischen, weine dich nur aus, ich habe dich entführt; meine Husaren kommen auch nach, und wenn mich der König Allmein zum Statthalter des ehrlichen Landes macht, so wirst du meine Gemahlin, und dann sage ich dir, wer ich bin. Jetzt muss ich mich hier in dem Bache baden und mich dann recht putzen, damit ich hübsch sauber vor den König Allmeinius treten kann." Nach diesen Worten machte er einen Sprung über einige Hecken hinweg, hinter welchen ein Bach lief, um sich dort zu baden.
Willwischen war so verwirrt und betrübt und ermüdet, dass sie einschlief. Aber auf einmal hörte sie die Trompeten blasen und sah, als sie erwachte, das Husarenregiment über die Wiese angesprengt kommen. Sie erhob sich und warf sich auf die Knie und bat um Hilfe; aber es war gar nicht nötig; denn der Zwickelwichs hatte alles gleich dem König Haltewort gesagt, und die Husaren kamen nach, um den Hüpfenstich gefangen zu nehmen.
Sie eilten gleich ans Wasser, und Hüpfenstich, der bemerkte, dass er verraten war, wollte fortspringen; aber er konnte nicht, weil er ganz nass war. Sie banden ihm also Hände und Füße und legten ihn quer über sein Pferd, setzten die Prinzessin in einen Wagen und kehrten nach der Hauptstadt zurück. Der König hatte dort schon einen hohen Galgen aufrichten lassen, und es ward nun überlegt, mit welchem Tod der Verbrecher gestraft werden sollte.
Endlich fällte der König das Urteil: "Es soll ihm erst die Uniform und dann die Haut abgezogen werden." Das geschah. Als man die Uniform abgezogen hatte, sagte die Prinzessin: Hüpfenstich, wenn du mir sagst, wer du bist, so will ich meinen Vater um Pardon bitten." Hüpfenstich schüttelte mit dem Kopf. Da ward ihm die Haut abgezogen, und die Prinzessin sagte wieder: "Hüpfenstich, sage, wer du bist, so will ich meinen Vater um Pardon bitten." Aber Hüpfenstich schüttelte nicht mit dem Kopf, sondern - er war nicht mehr da, kein Mensch wusste, wo er hingekommen war.
Man verwunderte sich sehr darüber; aber was war zu tun? Man musste sich mit der Haut begnügen; die ward an den Galgen aufgehängt, und der Platz war niemals leer von Menschen, welche die wunderliche Haut des Husarenobristen von Hüpfenstich ansahen. Sie hatte so viel Beine und Borsten und Schnurrbärte und einen so schrecklichen Zopf; kein Mensch konnte herausbringen, was er doch wohl immer für ein Tier mochte gewesen sein. Willwischen starb schier vor Neugierde, zu erfahren, wer er doch wohl möge gewesen sein, und quälte ihren Vater Tag und Nacht, aber der König hatte versprochen, es nie zu sagen.
Willwischen sollte sich nun bald vermählen; der König Haltewort war schon sehr alt und wollte gern einen Nachfolger haben; er bat also die Tochter, sie möge unter den vielen Prinzen, die um ihre Hand ansuchten, einen wählen. Sie sagte aber: "Ich will keinen nehmen, ehe ich weiß, von wem die Haut ist." Da sagte der König endlich: "Wohlan, mein Kind, wenn das dein Wille ist, so will ich in aller Welt bekannt machen lassen, dass der, welcher rät, von wem die Haut ist, dein Gemahl werden soll; bist du es zufrieden?" "Ja, ja", sagte Willwischen, und der König ließ nun überall bekannt machen: Wer errate, welche Haut in der Residenz am Galgen hänge, der solle seine Tochter zur Frau haben.
Nun entstand ein entsetzliches Gefahre und Gereite und Geschiffe und Gelaufe nach der Residenz. Da kamen Prinzen und Ritter und Lederhändler und Riemer und Sattler und Säckler und Gerber und Schuster und Buchbinder und Kürschner und Pelzhändler und Jäger und Seelenverkäufer und Juden und Professoren der Naturgeschichte, und wer nur mit Häuten und Leder zu tun hatte und mit dergleichen Bescheid wusste, kam, um seine großen Kenntnisse an den Tag zu legen und die schöne Prinzessin Willwischen zu gewinnen.
Als die Leute vom Hundertsten ins Tausendste hin und her rieten und den König immer fragten, ob sie recht geraten hätten, ward er ungeduldig und sagte: "Es kömmt hier nicht drauf an, zu erraten, sondern zu wissen, was für eine Haut es ist; drum sage jeder seine Meinung!" Da sagte einer: "Es ist ein Meerochse"; der andere: "Ein Landkraken"; der dritte: "Ein Muhdrache"; "Ein Prenzlauer Rhinozeros"; "Ein Kümmeltürke"; "Mir scheint es eine Gendarmenhaut", sagte ein armer Dorfschuster, wurde aber gleich eingesteckt.
Endlich trat ein Professor auf und behauptete, es sei die Haut eines afrikanischen Buschmanns; der Seelenverkäufer aber behauptete, sie sei von einem Amsterdamer Juden. Kurz, keiner konnte es erraten, und alle zogen ab. So ging dies mehrere Monate lang, und die Neugier Willwischens stieg immer höher. Schier war im ganzen Reiche kein Mensch, der nicht schon geraten hatte.
Nun kam eines Morgens, da die Stadt noch zu war, ein gewaltiger Grobian vors Tor und pochte mit seiner Faust an, dass die Angeln krachten. "Aufgemacht, aufgemacht," schrie er, "ihr Schlafmützen!" Die Torschreiber sprangen aus den Betten und fragten durchs Schlüsselloch, wer so anpoche; da antwortete eine Stimme wie ein Büffelochse: "Macht auf, ich bin der Wellewatz!"
Zitternd öffnete der Torwächter und sah einen abscheulichen Kerl hereinschreiten; er stieß beinahe oben am Tor an und war so breit und zottigt wie ein Pelznickel. "Ach, dürfte ich um Ihren Charakter bitten," sagte der Torschreiber, "dass ich Sie aufschreiben kann?" Aber der Herr Wellewatz donnerte so auf ihn ein: "Ich heiße Wellewatz und bin ein privatisierender Menschenfresser", dass der arme Torschreiber vor Schrecken hinter das Schildhaus fiel.
Wellewatz trabte mit seinen breiten Füßen durch die Straßen; alles schlief noch, und da er Hunger hatte und einige Bäckerknechte am Backofen beschäftigt sah, griff er zu und fraß sie wie Kramtsvögel ohne Brot hinunter. Als er auf den Markt kam, sah er den Galgen mit der Haut und las den Anschlagzettel, dass der die Prinzessin zum Weibe erhalte, wer rate, was es für eine Haut sei. Er schüttelte den Kopf und lachte und rief mit lauter Stimme: "Auf, auf, König Haltewort, dein Schwiegersohn ist da! Auf, auf, Prinzessin Willwischen, dein Mann ist da!"
Da flogen alle Fensterladen auf, und tausend erschrockne Gesichter guckten heraus, und die Sonne ging auf und schien dem Wellewatz in die Augen; da nieste er, dass die Fenster im Schlosse sprangen und die Scherben der Prinzessin ins Bett fielen. Weil ihm aber niemand "Zur Gesundheit!" gesagt hatte, wurde der Wellewatz so böse, dass er das Steinpflaster aufriss und nach den Leuten warf.
Endlich kam der König ans Fenster und wollte soeben wegen dem großen Lärm recht tüchtig zanken, aber als er den entsetzlichen Wellewatz vor Augen sah, wurde er vor Schrecken ganz sanft und sagte: "Was steht zu Seinen Diensten, mein Freund?" Da antwortete der Wellewatz: "König Haltewort, rufe deine Tochter Willwischen herbei, ich will die Haut erraten!" "Es ist zwar noch ein wenig früh," sagte Haltewort, "aber meinethalben; Er hat doch einmal die ganze Stadt aus den Federn gejagt."
Schon wollte der König zu Willwischen gehen, da kam sie selbst; die Neugierde, was für ein Lärm in der Stadt sei, ließ sie nicht ruhen. Als sie an das Fenster trat, patschte der Wellewatz in die Hände und lachte, dass die große Stadtmühle vor Schrecken darüber still stand. "Ei potztausend, Büffelochsen!" schrie er. "Welch schöne Prinzessin für eine Flohhaut!"
Bei den Worten Flohhaut lief dem König der Angstschweiß von der Stirne, und in der Stadt lief das Wort Flohhaut von Mund zu Mund, und alle Türmer bliesen Flohhaut, und alle Trommelschläger trommelten Flohhaut, alle Chorschüler sangen Flohhaut, Flohhaut ward die Parole der braunen Husaren, und alle Kanonen wurden los gebrannt; denn Haltewort hatte mit dem Schnupftuch geweht, und das war das bestimmte Zeichen, dass die Haut erraten sei.
Die Prinzessin lag in Ohnmacht, und Wellewatz stieg die Treppe hinauf; ach, da war kein Herr von Hüpfenstich, der ihr zur Ader gelassen hätte. Wellewatz stieß ihr einen Bund Zwiebeln unter die Nase, und sie kam zu sich. Sie stürzte sich in die Arme des Vaters. "Ist es wahr? Ist es wahr?" weinte sie. "Es ist wahr", sagte er und erzählte die ganze Geschichte des Herrn von Hüpfenstich. "Mein Kind Willwischen, deine Neugier hat dich soweit gebracht, du musst nun mit dem Wellewatz fortgehen, denn ich muss Wort halten."
Nun hätte man Willwischens Jammern hören sollen; sie warf sich an die Erde und umklammerte die Füße ihres Vaters und flehte so beweglich, dass es hätte einen Stein bewegen sollen. Aber der König sprach immer: "Mein Kind, du heißt Willwischen, und ich heiße Haltewort, und da kömmt es nun so heraus, du musst nun fort mit dem Wellewatz." Aber sie wimmerte immerfort, und Wellewatz ward schon ungeduldig und sprach: "Liebste Frau, ich rate dir, werde ruhig und schreie mir die Ohren nicht voll, sonst werde ich andere Saiten aufspannen."
Der König machte nun dem Wellewatz allerlei Vorschläge, damit er von Willwischen ablassen sollte. Er wollte ihn zum Hoftürken, zum Generalissimus, zum Theaterdirektor, zum Oberjägermeister machen; Wellewatz wollte nicht. Der König hängte ihm alle verflossene, gegenwärtige und zukünftige Orden um den Hals; Wellewatz wollte nicht. Der König machte ihn zum Herzogen Watz von Wellenwurz; er wollte nicht.
Endlich sagte er: "Ich sehe, dass Er gar keine Ehre im Leib hat." Da antwortete der Wellewatz: "Nein, aber zwei Bäckerknechte", und erwischte die Prinzessin Willwischen beim Rockzipfel und zerrte sie zur Stadt hinaus; weil sie sich aber gar so erbärmlich stellte, so ward der König auch auf sie zornig und schimpfte und zankte hintendrein. Die ganze Stadt war im Auflauf, und es ward auf allen Straßen folgendes Lied gesungen:
Heil dir, o Wellewatz,
Der sich so schnelle Platz
Bei uns gemacht!
Du rietst dir halt den Schatz,
Hast nun die Braut beim Latz,
Gibst ihr so laut den Schmatz,
Dass es nur kracht.
Heil dir, Willwischen Braut,
Die wissen will die Haut
Vom Hüpfenstich!
Wer auf die Neugier baut,
Durch Schlüssellöcher schaut
Und auf Husaren traut,
Den trifft's, wie dich.
Ach, Herr von Hüpfenstich,
Wer ließ entschlüpfen dich
Aus deiner Haut?
Dein Balg am Galgen hing,
Mancher sich balgen ging;
Durch deinen Balg nun fing
Wellewatz die Braut.
Der König aber sperrte sich mit seinem Nachdenker ein und ließ stark über seinen Unfall nachdenken.
Wellewatz packte vor dem Tor das Willwischen auf seine Schulter und ging mit ihr querfeldein immer fort, fort, über Stock und Stein, Distel und Dorn, Berg und Tal, und kam am Abend in einen dicken, dunklen Wald, wo sich die Wölfe einander gute Nachte sagen. "Du magst wohl Hunger haben," sagte er zu Willwischen, "warte, und ich will dir gleich etwas Süßes zu schmecken geben. Ich höre meinen Zuckerbäcker schon brummen."
Willwischen zitterte und bebte, denn sie kamen zu einem großen Bären, der mit einem großen Bienenkorb unter dem Arm nach seiner Höhle spazierte. Wellewatz holte ihn bald ein und gab ihm eine Ohrfeige, dass er um und um fiel, dann riss er eine Honigwabe aus dem Korb, wo alle Bienen und alles Wachs noch drin staken, und wollte, Willwischen sollte sie essen. Aber ihr schauderte. "Potz Leckermaul," sagte der Wellewatz, "so hungere!" und fraß den ganzen Honigkorb allein aus. Willwischen aber aß einige wilde Brombeeren, die da herum wuchsen.
Der Wellewatz packte sie wieder auf und sagte: "In einigen Stunden werden wir in meinem Schlosse Knochenruh ankommen." Das war ein schrecklicher Name. Der Mond schien, der Wind wehte, und in den hohen Fichten klapperte es. "Das ist mein Lustgarten Klapperbach," sagte Wellewatz; "die Totengerippe, die da in den Bäumen rappeln, scheuchen mir die Raben weg; ich habe die Kerls alle selbst aufgezehrt und brauche keine Schwarzröcke dazu."
Willwischen war vor Angst und Schrecken eine einzige Gänsehaut; sie zitterte so, dass der Wellewatz zu ihr sagte: "Klappere nicht so mit den Beinen, du kitzelst mich, und wenn du mich lachen machst, so fresse ich dich vor Liebe auf." Ach, wie stille hielt sich da Willwischen! Endlich kamen sie an einen freien Platz im Walde vor ein wunderbares, hohes Gebäude. Der Mond schien. Das Haus war nicht ganz fertig gebaut. Auf der linken Seite fehlte ein Turm, auf der rechten Seite war es fertig. Es war nicht ohne Kunst gebaut. Lauter Totenbeine und Totenköpfe, die standen oben herum, und weil die Haare noch auf ihnen waren, spielten diese recht schön im Wind und sausten. Es war gar nicht so übel ausgedacht.
Wellewatz blieb, mit Willwischen auf dem Rücken, eine Zeit lang vor dem Schlosse in stiller Bewunderung stehen; endlich sagte er: "Wie gefällt dir das, mein Schatz? Sieh, alle diese Knochen haben meine Vorfahren und ich selbst abgenagt, und mit welchem Geschmack sind sie geordnet! Ist das nicht modisch? Ist das nicht gotisch? Aber jetzt, mein Schatz, auf unserm Hochzeitsschmaus, da soll es so hergehen, dass der ganze Turm auf dem linken Flügel mit den Knochen soll fertig gebaut werden. Wie gefällt dir das, mein Schatz?" "O Gott, entsetzlich schön", seufzte Willwischen.
Nun führte er sie hinein; alles Knochen und alles Knochen. "Das ist dein Kabinett," sagte Wellewatz; ach, es war mit lauter Kinderknöchelchen tapeziert! "Hier hast du was zu essen," sagte Wellewatz; es waren lebendige Krebse. "Ich habe keinen Appetit", sagte Willwischen. "Wird schon kommen," sagte Wellewatz und aß die Krebse ruhig hinunter; "wenn sie einen so im Magen mit den Scheren kneipen," sagte er, "das macht Appetit. Aber gute Nacht, lass dir was Gutes träumen; ich will auf die Jagd gehen und Vorrat anschleppen. Morgen lade ich meine Vettern ein, da soll Hochzeit werden." Und damit ging er fort und schlug die Türe zu, dass der ganze Knochenpalast eine halbe Stunde lang klapperte.
Willwischen war vor Schreck und Hunger und Jammer ganz von Sinnen, sie konnte es vor Angst nicht mehr in dem Hause aushalten, auch quälte sie der Hunger. Sie schlich zur Tür hinaus und setzte sich in den Wald und riss Gras aus und aß es und sagte einmal übers andermal: "Ach Gott, warum heiße ich Willwischen? Ach Gott, warum bin ich so neugierig? Ach, wäre ich wieder bei meinem Vater! Ich wollte ja in meinem Leben gar nichts mehr erfahren. Oh, wer hilft mir aus diesem schrecklichen Elend?"
Während sie so jammerte, hörte sie im Walde reden und glaubte schon, Wellewatz kehre mit einigen guten Freunden zurück. Sie wollte geschwind wieder in das Knochenschloss laufen, aber sie fiel über ein Bein und stürzte, vor Mattigkeit laut schreiend, an die Erde. Als sie wieder zu sich kam, war die Sonne aufgegangen, und sie lag in den Armen einer freundlichen alten Frau, welche ihr Zuckerbrot und Wein gab und zu ihr sprach: "Ei, Kind Willwischen, wie lange habe ich dich nicht gesehen, und in welchem Zustande muss ich dich wiederfinden!"
Willwischen erstaunte sehr, dass die Frau ihren Namen nannte, aber sie fragte gar nicht, wer sie sei, weil ihr die Neugierde auf ewig vergangen war. Die Frau aber fing von selbst an und sagte: "Mein Kind Willwischen, ich kenne dein ganzes Unglück, und ich will dir helfen. Als deine sterbende Mutter dich in den Armen hatte, sagte sie: Die Woche, welche du zu früh auf die Welt kamst, möge dir einst gute Dienste leisten! Nun sieh, ich bin die Woche; ich habe dich sieben Nächte neben meinen sieben Söhnen an meiner Brust ernährt, bis dein Vater mich fand und fortschickte, und da hab ich den Hüpfenstich zu ihm geschickt, den verzauberten Floh, dessen Haut dich in das Elend mit dem Wellewatz gebracht.
Aber ein andermal mehr; halte dich nur ruhig und gehe in das Schloss, und lasse dir nichts merken, wenn der Wellewatz wiederkömmt! Morgen Nacht um ein Uhr komme ich mit meinen sieben Söhnen, das sind erstaunlich geschickte und kluge Burschen, die sollen dich nach Haus führen." Nun gab sie dem Willwischen noch Wein und Zuckerbrot und befahl ihr, heimlich davon zu essen, küsste es und ging weg. Willwischen sah ihr lange mit Tränen nach und schlich dann in das grässliche Schloss zurück.
Gegen Mittag kam Wellewatz zurück; er trug ein Wildschwein, an einer jungen Fichte gespießt, auf der Schulter und brachte noch ein Nest voll junger wilder Katzen. "Holla! Willwischen!" schrie er, "da ist Mundvorrat, hungern sollst du mir nicht, und Gesellschaft kriegst du auch; ich muss heut Abend wieder weg, ich muss mir einige Handwerksburschen zum Hochzeitsbraten einfangen, die Bäckerknechte in deines Vaters Stadt schmeckten vortrefflich; ich habe dir deswegen eine Dame von hohem Stande auf heute Nacht zur Gesellschaft gebeten, die Frau von Euler; das wilde Katzennest kannst du ihr vorsetzen; dass du nur keine von den kleinen Katzen herausfrisst, ehe die Dame kömmt!" "Ach, gewiss nicht, mir ekelt, und gar lebendig!" sagte Willwischen. "Ja, ja, papperlapapp, ich kenne euch Leckermäuler, ihr sprecht immer von Ekel und dann leckt ihr die Finger danach."
Unterdessen hatte er ein Feuer angemacht und das Wildschwein an dem Spieß drüber befestigt; Willwischen musste es umdrehen, und er riss ein Stück nach dem anderen herunter und verschlang es mit Haut und Haar. Als er wieder wegging, sagte er: "Dass du mir nur die Frau von Euler gut unterhältst, sonst gibt's Prügel!"
Willwischen saß wieder allein in dem Knochenhaus und zitterte und bebte wegen der Frau von Euler. Was konnte sie sich von einer Dame versprechen, die lebendige wilde Katzen fraß! Sie guckte die armen Wildkätzchen recht mitleidig an: "Ach," sagte sie, "ihr armen Dinger! Euch geht es nicht besser als mir," und gab ihnen etwas von dem Wildschwein zu fressen; "wenn es möglich ist, will ich euch erretten", und somit trug sie die Tierchen in einen entlegenen Teil des Hauses.
Als es dunkel ward, vernahm sie einige grässliche Töne; sie wusste nicht, woher; aber auf einmal flatterte mit abscheulichem Geräusch und Gekrächze etwas den Schornstein herunter in die Stube. Willwischen sah mit Angst nach dem Winkel, da glühten ihr zwei runde Augen entgegen und knappte es entsetzlich mit dem Schnabel; es war eine ungeheure, riesenhafte alte Nachteule, sie raschelte auf Willwischen zu; aber die floh mit großem Geschrei zur Türe hinaus und schlug die Knochentüre zu.
"Scharmante Frau von Wellewatz," rief die Eule ihr nach, "wie schreckhaft und blöde sind Sie; hat der Herr von Wellewatz mich nicht gemeldet? Ich habe Sie gewiss in süßen Schwärmereien gestört; kommen Sie doch wieder herein!" Willwischen sagte: "Ich will nur Licht anzünden." "Nein, das wäre zu naiv," schrie die Eule, "ich habe kranke Augen, ich verbitte mir das Licht; allons, kommen Sie herein und bringen Sie mir mein Abendbrot mit!"
Willwischen goss den Wein, den ihr die Frau Woche gegeben, in eine Schüssel voll Brot und machte so eine kalte Schale, die schob sie zur Türe herein und sagte: "Bedienen Sie sich einstweilen, gnädige Frau!" und hielt die Türe fest zu. "Delikat, delikat!" hörte sie die Frau von Euler sagen. "Aber eine kuriose scheue Person hat sich der Wellewatz geholt; sie muss vom Lande sein." Über solchem Geschwätz fraß die Frau von Euler die Weinsuppe aus und schlief berauscht ein.
Willwischen saß in rechter Herzensangst auf der Schwelle der Haustüre. Auf einmal hörte sie Gesang im Walde, und der kam immer näher; da sah sie die Frau Woche anspaziert kommen mit ihren sieben Söhnen, und der erste hatte eine blaue Jacke an und sang recht handwerksburschenmäßig vor den anderen her:
Willwischen, liebstes Willwischen mein,
Wann werden wir wieder beisammen sein?
Am Montag!
Ei, so wollt ich, dass alle Tag Montag wär,
Auf dass ich bei meiner Willwischen wär!
...............................................................................
Kaum waren sie heran, so sagte Frau Woche: "Nun, ihr Bengels, da habt ihr endlich eure Prinzessin; je zeigt eure Künste und macht, dass wir sie sicher nach Haus zum König Haltewort bringen!" Dann sagte sie zur Prinzessin: "Sieh, Willwischen, ich bin die Woche, und die Jungens sind der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend und Sonntag."
"Erzählt nicht so lange," sagte der Montag, "wir müssen fort; hast du dein Bündelchen geschnürt, Willwischen?" "Ach! ich will nur die jungen Wildkätzchen mit in den Wald nehmen", sagte sie und ging, das Nest zu holen.
Montag trat aber in die Stube, wo die Frau von Euler an der Erde schlief, und nahm sie auf den Rücken und schleppte sie vor den Knochenpalast und nagelte sie mit den Flügeln an das Tor und schrie ihr in die Ohren: "Sie können dem Herrn Wellewatz nur alles erzählen, es liegt uns gar nichts dran." Nun wachte die Frau von Euler auf und zappelte und schrie gewaltig. Aber die Woche zog mit Willwischen, von den sieben Söhnen umgeben, den Montag an der Spitze, immer in den Wald hinein, und da Willwischen Katzen schreien hörte, dachte sie: "Das ist gewiss meiner Katzenmutter", und stellte das Nest in eine Baumhöhle.
So waren sie bis um zwölf Uhr der folgenden Nacht gegangen, als plötzlich die Frau Woche sich an die Erde legte und lauerte. "Aufgepasst, Montag!" schrie sie. "Wellewatz ist nach Haus gekommen, die Frau von Euler hat ihm alles gesagt, er hat die Beine auf die Schulter genommen und wird gleich hier sein." Kaum hatte sie dies gesagt, als sie auch schon ein Gekrache und ein Geräusch im Walde von Wellewatzens breiten Fußtritten hörten.
Da sprang aber der Montag vor, nahm die Feder, die er hinterm Ohr hatte, tauchte sie in ein Tintenfass, das er am Gürtel hängen hatte, und spritzte die Feder aus; da entstand ein Tintenfleck zwischen ihnen und dem Wellewatz, wie ein kleines schwarzes Meer. Wellewatz wollte anfangs durchwaten, als es ihm aber zu tief ward, schrie er: "Ich komme ohne Löschpapier nicht durch!" und lief nach Haus, solches zu holen.
Die Reisenden eilten immer fort, und Dienstag sang an der Spitze dasselbe Liedchen wie gestern der Montag, nur dass er statt "am Montag" "am Dienstag" sang. Nachts um zwölf Uhr lauerte die Frau Woche wieder an der Erde und sprach: "Dienstag, mache du nun dein Kunststück; der Wellewatz hat soeben sein großes Löschpapier über den Klecks gelegt; gleich wird er da sein." Kaum hatte sie das gesagt, als sie den Wellewatz bereits ganz in der Nähe singen hörten.
Löschpapier und Fließpapier
Und grüne Petersilien.
Da nahm der Dienstag seine Streusandbüchse und streute sie hinter sich aus, und es entstand auf einmal ein so tiefes Sandmeer hinter ihnen, dass der Wellewatz bis an die Knie einsank. "Ich muss nach Haus und muss mir meine Chaussee holen", sagte er und kehrte wieder um. Nun ging der Mittwoch an der Spitze, und der Dienstag war der Letzte. Der Führer sang wieder wie sein Vorgänger, nur sang er "am Mittwoch" statt "am Dienstag".
Nachts um zwölf Uhr lauschte die Frau Woche wieder und sprach: "Geschwind, Mittwoch, mache deine Kunststücke! Wellewatz hat eben einen langen Steinweg über das Sandmeer geschlagen und fährt mit sechs Schimmelgerippen Extrapost an." Als sie dies gesagt hatte, hörten sie schon das Posthorn blasen und den Wellewatz dazu singen:
Fahr, fahr, fahr auf der Post,
Frag, frag, frag nicht, was es kost't,
Spann mir's Willwischen ein,
Ich will der Postknecht sein.
Da legte der Mittwoch sein Lineal hinter sich, und sieh da, ein ungeheurer Schlagbaum lag quer über dem Weg, an dem die Schimmelgerippe so anrannten, dass sie zu tausend Knochensplittern zusammenprasselten. "Holla," schrie ein schnauzbärtiger Kerl, der hinter einem Baum hervortrat, "Er fährt wie ein Narr! Ich bitte mir den Wegzettel von der letzten Station aus." "Ich habe keinen Wegezettel", sagte Wellewatz. "Ja, da müssen Sie wieder zurück und sich einen holen." Wellewatz ärgerte sich abscheulich, und weil sein Fuhrwerk zertrümmert war, musste er zu Fuß zurück.
Als er umgekehrt war, kam der Zolleinnehmer zu Willwischen, und sie sah, dass es niemand anders war als der wilde Kater, dem sie seine Jungen gerettet hatte. Er freute sich, dass er ihr habe seine Dankbarkeit erweisen können, und sie zogen weiter. Nun trat der Donnerstag an die Spitze, und alles ging wie das vorige Mal. Als sie Nachts der Wellewatz wieder einholte, steckte der Donnerstag seine Schreibfeder in die Erde, und es einstand daraus ein großer Wald von entsetzlich großen Gänseflügeln, die immer durcheinander wehten, dass der Wellewatz nicht durch konnte und wieder nach Hause musste, um sich eine Axt zu holen.
In der folgenden Nacht führte der Freitag den Zug; die Frau Woche hörte den Wellewatz den Wald niederhauen. "Jetzt, jetzt kömmt er," schrie sie, "jetzt mache deine Künste, mein Freitag!" Der Freitag nahm seinen Bleistift und machte einen langen Strich an den Boden, der ward sogleich ein breiter, wilder Fluss. Der Wellewatz aber war schon entsetzlich ungeduldig, er riss die Kleider vom Leibe und schwamm hinüber; aber das Wasser war reißend und trieb ihn weit hinunter.
In der folgenden Nacht, als der Sonnabend den Zug führte, schrie Frau Woche auf einmal: "Er kömmt, er kömmt!" Da stieß der Sonnabend seine blecherne Federbüchse in die Erde, und es ward auf einmal ein ungeheurer, hoher Turm daraus, auf welchen sie alle miteinander hinaufstiegen, und da Wellewatz ankam, lachten sie ihn von oben herunter brav aus. Er ließ sich aber nicht irremachen, sondern lief wieder nach Haus, um eine große Leiter zu holen.
In der nächsten Nacht kam der Sonntag an die Spitze der Gesellschaft, und als die Frau Woche ausrief: "Ich höre den Wellewatz schon seine große Leiter heranschleifen", befahl er, dass alle den Turm verlassen und sich verstecken müssten. Das taten sie; nun legte Wellewatz die Leiter an und stieg oben in den Turm hinein; da nahmen sie die Leiter weg und machten den Turm zu, und der Sonntag stieß an den Turm, der fiel um und war nichts als eine entsetzlich große Federbüchse, worin der Wellewatz stak.
Nun sagte der Sonntag: "Liebe Prinzessin, liebe Mutter, liebe Brüder, der Wellewatz ist glücklich gefangen, die Gefahr ist vorüber, lasset uns Gott danken!" Da knieten alle nieder und dankten Gott, und Willwischen weinte vor Freuden; denn sie hörten die Glocken ihrer Vaterstadt läuten, so nahe waren sie. Sie setzten ihren Zug nun fort, und siehe da, der Wellewatz wälzte sich ihnen in der großen Federbüchse nach, was ihnen recht lieb war, denn so konnten sie ihn lebendig gefangen bringen.
Nun zogen sie in die Stadt hinein, und die Federbüchse rollte immer nach. Der König umarmte seine Tochter mit vielen Tränen der Freude; da sie ihm aber sagte, dass der Wellewatz in der Federbüchse stecke, sagte er: "Ei, ei, mein Kind, wenn er noch lebt, so musst du wieder zu ihm, weil ich mein Wort halten muss"; da tat die Prinzessin einen lauten Schrei vor Schmerz und bat den Vater, doch erst darüber nachdenken zu lassen. Das versprach der König Haltewort.
Nach Tisch waren sehr große Lustbarkeiten in der Stadt, alle Handwerkszünfte brachten der Prinzessin Willwischen ein Geschenk; auch ließ der König ausrufen, wer seine Tochter von dem Wellewatz frei machen könne, der solle begehren, was er wolle. Als die Bäckerzunft eben einen schönen, großen gebackenen Husaren von Butterteig vor die Prinzessin zum Geschenk niedersetzte und alle über die große Ähnlichkeit mit dem seligen Hüpfenstich lachten, rief der Herold jene königliche Aufforderung aus.
Willwischen sah mit trauriger Erinnerung auf den gebackenen Husaren und schrie auf einmal aus: "O mein Hüpfenstich! Sie haben einen guten Mann in Butter gebacken, und mir war er mehr! Oh, wenn du noch lebtest, du wärest flink, mir zu helfen! Ach, ich habe dich immer geliebt, Hüpfenstich! Hüpfenstich, abgeschiedener Geist, hilf mir!" Bei diesen Worten der Prinzessin sprang der Kuchenhusar auf, und seine Wacholderaugen funkelten, und sein Mund von Rosinen sprach laut und vernehmlich:
"Geliebteste Prinzessin, teuerster König, Hüpfenstich lebt noch. Als mir die Haut abgezogen wurde, floh meine Seele bei dem Hofbäcker vorbei, und da dieser gerade meine Figur zum Spott gebacken, kroch ich in den Teig hinein. Da habe ich den grässlichen Anblick gehabt, wie der Wellewatz zwei Bäckerknechte morgens ohne Brot gefressen." "Da steht der Tod drauf," schrie der König, "Viktoria, nun sind wir ihn los!"
Der Wellewatz sollte mitsamt der Federscheide in das Wasser geworfen werden; weil er sich aber immer herumdrehte, so nahmen sie ihn als eine Mühlwelle, und hat er nachher lange Jahre die königliche Mühle getrieben. Das närrischste ist, dass er immer noch meint, er laufe hinter Willwischen her.
Weil der gebackene Herr von Hüpfenstich durch seine Angabe die Prinzessin gerettet hatte, fragte ihn der König Haltewort, was er zur Belohnung wolle. "Die Prinzessin soll mich aufessen", sagte er. Willwischen wollte nicht, aber er bat so dringend, dass sie ein tüchtiges Stück aus ihm heraus biss. Aber kaum hatte sie es getan, als ein wunderschöner Prinz vor ihr stand und sagte: "Nun ist alles richtig." "Ja, es ist alles richtig", rief Willwischen aus und umarmte den schönen Prinzen, und der König war es zufrieden und schenkte ihm die Hälfte seines Reichs. Der alte König Haltewort aber heiratete die Frau Woche zur Belohnung ihrer edeln Handlungen, und die sieben Söhne kriegten jeder ein Regiment.
Clemens von Brentano
PECHVOGEL UND GLÜCKSKIND ...
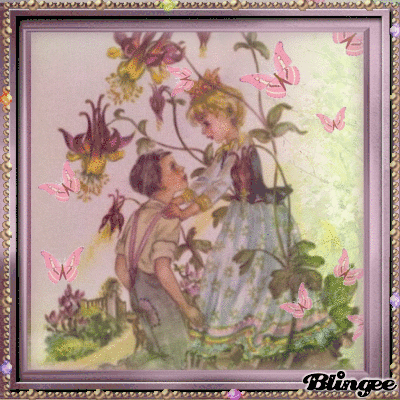
In einer kleinen Stadt, nicht weit von dem Orte, wo ich wohne, lebte einmal ein junger Mann, dem alles zum Unglück ausschlug, was er anfing. Sein Vater hatte Pechvogel geheißen, und so hieß er denn auch Pechvogel. Beide Eltern waren ihm früh gestorben, und die lange, dürre Tante, die ihn damals zu sich genommen hatte, prügelte ihn jedes Mal, wenn sie aus der Messe kam. Da sie nun aber jeden Tag in die Messe ging, so prügelte sie ihn eben auch alle Tage.
Er hatte aber auch wirklich viel Unglück. Denn wenn er ein Glas trug, fiel es ihm gewöhnlich hin; und wenn er dann weinend die Scherben auflas, schnitt er sich stets in die Finger. So ging es in allen Dingen. Zwar die lange Tante starb eines Tages, und er pflanzte um ihr Grab so viel Büsche und Bäume, als wenn er auf ihnen noch einmal alle die Stöcke ziehen wolle, die sie auf seinem Rücken zerschlagen hatte; aber sein Unstern schien mit jedem Jahre nur mehr und mehr zuzunehmen.
Da bemächtigte sich seiner eine große Traurigkeit, und er beschloss, in die weite Welt zu gehen. Schlechter kann es nimmer werden, dachte er; vielleicht wird es besser. Er steckte daher seine ganze Barschaft in die Tasche und wanderte zum Tor hinaus. Vor dem Tor, auf der steinernen Brücke, blieb er noch einmal stehen und lehnte sich über das Geländer. Er sah in die Wellen hinab, die reißend an den Pfeilern vorbei schäumten, und es wurde ihm gar wehmütig ums Herz. Es war ihm fast, als wenn es ein Unglück wäre, die Stadt, in der er so lange gelebt, zu verlassen.
Und vielleicht hätte er noch lange so gestanden, wenn ihm nicht plötzlich der Wind den Hut vom Kopfe geweht und in den Fluss geworfen hätte. Da erwachte er aus seinen Träumen, aber der Hut war schon unter der Brücke fort geschwommen und tanzte auf der anderen Seite mitten im Strom; und jedes Mal, wenn ihn eine Welle hochhob, schien er höhnisch zurückzurufen: "Adieu, Pechvogel! Ich reise; bleibe du zu Hause, wenn du Lust hast."
So machte sich denn Pechvogel ohne Hut auf den Weg. Lustige Gesellen zogen oft genug singend und jubilierend an ihm vorüber und luden ihn ein, in Gemeinschaft mit ihnen die Wanderschaft fortzusetzen. Doch er schüttelte jedes Mal traurig den Kopf und sagte: "Ich passe nicht zu euch und würde euch nicht viel Glück bringen! Außerdem heiße ich Pechvogel!"
Sobald sie diesen Namen hörten, wurden die lustigen Burschen ernsthaft und verlegen und machten sich eilends aus dem Staube. Erreichte er abends müde ein Wirtshaus und saß er an einer einsamen Ecke des Schanktisches, den Kopf in die Hand gestützt und vor sich den zinnernen Krug mit Wein, der nimmer leer werden wollte, so trat wohl zuweilen das Wirtstöchterlein leise zu ihm heran, tippte ihn auf die Schulter, so dass er sich erschrocken umdrehte, und fragte, warum er so traurig sei.
Wenn er aber dann seine Geschichte erzählte oder gar seinen Namen nannte, schüttelte sie den Kopf, ging zu ihrem Spinnrad zurück und ließ ihn allein sitzen und seinen Gedanken nachhängen.
Nachdem Pechvogel mehrere Wochen lang gewandert war, ohne recht eigentlich zu wissen wohin, kam er eines Tages an einen wundervollen großen Garten, der von einem hohen, vergoldeten Geländer umgeben war. Durch das Geländer hindurch sah man uralte Bäume und niedriges Buschwerk, abwechselnd mit großen Rasenplätzen. Dazwischen schlängelte sich ein Bach, über den eine Menge kleiner Brücken führte. Zahme Hirsche und Rehe spazierten auf den gelben Sandwegen umher, kamen bis ans Gitter, streckten ihre Köpfe heraus und fraßen ihm das Brot aus der Hand.
In der Mitte des Gartens aber sah man aus den Bäumen ein stattliches Schloss hervorragen. Die silbernen Dächer blitzten in der Sonne, und von den Türmen wehten bunte Fahnen und Banner. Er ging das Geländer entlang; endlich fand er einen großen, offen stehenden Torweg, von dem eine lange schattige Allee gerade auf das Schloss führte. Im Garten selbst war alles still; kein Mensch ließ sich sehen oder hören. Am Tor hing eine Tafel. Aha! dachte er, wie gewöhnlich!
Wenn man an einem recht schönen Garten vorbeikommt, wo die Tore einladend offen stehen, dann hängt immer eine Tafel daneben, worauf steht, dass der Eintritt verboten ist. Zu seiner Überraschung sah er jedoch, dass er sich diesmal täuschte: denn auf der Tafel stand weiter nichts als: "Hier darf nicht geweint werden!" - "So, so", sagte er, "eine närrische Inschrift", zog das Taschentuch heraus und rieb sich ein wenig die Augen; denn er war nicht ganz sicher, ob nicht in einer Ecke irgendwo doch eine halbe Träne sitzen geblieben sei.
Darauf trat er in den Garten ein. Der große breite Weg, der schnurstracks aufs Schloss zu lief, machte ihn beklommen. Er schlug lieber einen Seitengang mitten zwischen hohen Jasmin- und Rosenhecken ein. Den verfolgte er und gelangte in einen kleinen Wald, aus dem ein Weg mit vielen Windungen zu einem Hügel hinauf führte. Als er jetzt abermals um eine Ecke bog, lag die Spitze des Hügels vor ihm, und auf dem Hügel im Grase saß ein wunderschönes Mädchen.
Sie hatte eine goldene Krone auf dem Schoß, auf die sie fortwährend hauchte. Dann nahm sie ihre seidene Schürze, rieb die Krone mit ihr, und als sie sah, dass sie wieder ganz blank wurde, klatschte sie vor Freude in die Hände, strich sich ihre langen Haare hinter die Ohren und setzte sich die Krone wieder auf.
Den armen Pechvogel überfiel bei ihrem Anblicke eine sonderbare Angst. Sein Herz pochte so laut, als wenn es zerspringen wollte. Er trat hinter einen Busch und duckte sich nieder. Aber es war eine Berberitze, und ein Zweig legte sich ihm gerade quer übers Gesicht. Und wie der Wind den Busch leise hin und her bewegte, kitzelte ihm ein Dorn fortwährend an der Nasenspitze herum, so dass er laut niesen musste.
Erschrocken drehte sich das Mädchen mit der Krone um und sah Pechvogel hinter dem Busche kauern. "Warum versteckst du dich?" rief sie. "Willst du mir etwas Böses tun, oder fürchtest du dich vor mir?" Da trat Pechvogel zitternd wie Espenlaub hinter dem Busche hervor. "Du tust mir nichts!" sagte sie lachend.
"Komm her, setze dich ein wenig zu mir; meine Gespielinnen sind alle fortgelaufen und haben mich allein gelassen. Du kannst mir etwas recht Hübsches erzählen, aber was zum Lachen! Hörst du? Aber du siehst ja so traurig aus! Was fehlt dir denn? Wenn du kein so finsteres Gesicht machtest, wärst du wirklich ein ganz hübscher Mensch."
"Wenn du es haben willst", antwortete Pechvogel, "will ich mich wohl einen Augenblick zu dir setzen. Aber wer bist du denn? Ich habe ja mein Lebtag noch nie etwas so Schönes und Herrliches gesehen wie dich!"
"Ich bin die Prinzessin Glückskind, und dies ist meines Vaters Garten." "Was machst du denn hier so allein?" "Ich füttere meine Rehe und Hirsche und putze meine Krone." "Und nachher?"
"Dann füttere ich meine Goldfische!" "Und wenn du damit fertig bist?" "Dann kommen meine Gespielinnen wieder, und dann lachen wir und singen und tanzen!" "Ach, was du für ein glückseliges Leben führst! Und das geht so alle Tage?" "Ja, alle Tage! Nun sage aber auch einmal, wer du bist und wie du heißt."
"Ach, allerschönste Prinzessin, verlangt nur das nicht von mir! Ich bin der allerunglücklichste Mensch unter der Sonne und habe den allerhässlichsten Namen." "Pfui!" sagte sie, "ein hässlicher Name ist sehr hässlich! In meines Vaters Ländern gibt es einen, der heißt Entengrütze, und einen anderen, der heißt Fettfleck; du wirst doch nicht etwa so heißen?"
"Nein", antwortete er, "Entengrütze heiße ich nicht, auch nicht Fettfleck. Mein Name ist noch viel hässlicher. Ich heiße Pechvogel."
"Pechvogel? Das ist ja zum Totlachen! Kannst du denn keinen anderen Namen kriegen? Höre, ich will mir einmal einen recht hübschen Namen für dich ausdenken, und dann will ich meinen Vater bitten, dass er dir erlaubt, ihn zu tragen. Mein Vater kann alles, was er will; denn er ist König. Aber nur unter der Bedingung tue ich es, dass du ein ganz vergnügtes Gesicht machst. Nimm doch die Hand vom Gesicht; du musst dir nicht immer so an der Nase herumzupfen! Du hast eine ganz hübsche Nase und wirst sie dir noch ganz und gar verderben. Streich dir einmal die Haare aus der Stirn! So! Nun siehst du doch einigermaßen vernünftig aus. -
Sage einmal, warum bist du eigentlich so traurig? Denn ich bin immer vergnügt, und jeder, mit dem ich rede, freut sich. Nur dir sieht man es gar nicht an!" "Warum ich so traurig bin? Weil ich mein ganzes Leben traurig war und stets Unglück habe. Und du bist immer lustig? Wie fängst du das an?"
"Mich hat eine Fee über die heilige Taufe gehalten, der hatte mein Vater früher einmal einen großen Dienst erwiesen. Sie nahm mich auf den Arm, küsste mich auf die Stirn und sagte zu mir: 'Du sollst immerdar fröhlich sein und alle Welt fröhlich machen. Wenn dich ein recht trauriger Mensch ansieht, soll er sein Unglück vergessen! Glückskind sollst du heißen!' - Dich aber hat wohl keine Fee geküsst?" "Nein, nein!" antwortete er hastig, "niemals!"
Darauf wurde die Prinzessin sehr still und nachdenklich und sah ihn mit ihren großen blauen Augen so sonderbar an, dass es ihm eiskalt den Rücken hinunter lief. Dann hub sie wieder an: "Ob es auch immer eine Fee sein muss? Eine Prinzessin ist auch etwas. Komm her, knie dich einmal hin; denn du bist mir zu groß." Darauf trat sie vor ihn, gab ihm einen Kuss und lief lachend fort.
Ehe sich Pechvogel noch recht besinnen konnte, war sie verschwunden. Langsam stand er auf. Es war ihm, als wenn er aus einem Traum erwachte; und doch fühlte er, dass es kein Traum sein könne, denn eine wunderbare Fröhlichkeit war über sein Herz gekommen. "Wenn ich nur meinen Hut hätte", sagte er, "dass ich ihn in die Luft werfen könnte. Vielleicht finge er an zu trillern und flöge als Lerche davon! Zumut ist es mir so. Ich glaube wirklich, ich bin lustig. Das wäre doch zu merkwürdig." - Er pflückte sich noch einen großen Blumenstrauß im Garten und wanderte singend die Landstraße weiter.
Sobald er in die nächste Stadt kam, kaufte er sich ein rot samtenes Wams mit Atlasschlitzen und ein Barett mit einer langen weißen Feder, besah sich im Spiegel und sagte: "Pechvogel heiße ich? Wir wollen doch sehen, ob ich nicht einen anderen Namen bekomme. Aber den schönsten, den es gibt, sonst nehme ich ihn nicht an." Dann stieg er auf ein Pferd, gab ihm die Sporen, dass es lustig dahin tanzte, und setzte seine Reise fort.
Prinzessin Glückskind aber, nachdem sie dem Pechvogel den Kuss gegeben hatte, lief und lief. Dann ging sie langsamer und langsamer, und zuletzt setzte sie sich auf eine Bank unweit vom Schlosse und fing an, bitterlich zu weinen. Als ihre Gespielinnen zurückkehrten und sie fanden, weinte sie immer noch. Sie versuchten sie zu trösten, aber es half nichts. Da liefen sie in ihrer Angst zum König und riefen: "Um Gottes Willen, Herr König! Ein Unglück für das ganze Land! Prinzessin Glückskind sitzt im Garten und weint, und niemand kann ihr helfen."
Als dies der König hörte, wurde er vor Schrecken blass und sprang eilig die Treppe in den Garten hinunter. Da saß die Prinzessin weinend auf der Bank und hatte die Krone auf dem Schoß, und es waren auf sie so viele Tränen gefallen, dass sie in der Sonne blitzte, als wenn sie mit tausend Diamanten besetzt wäre. Der König nahm seine Tochter in den Arm und tröstete sie und redete ihr zu; aber sie weinte immerfort.
Er führte sie in das Schloss und ließ ihr aus dem ganzen Lande alles, was es nur Schönes und Kostbares gab, kommen; doch sie blieb traurig; und so oft er sie auch bat, ihm doch zu sagen, welch ein schweres Herzeleid ihr widerfahren sei, sie antwortete nicht. Aber der König fragte immer wieder, und zuletzt musste sie es sagen; und sie erzählte, wie sie im Garten gesessen und wie ein junger Mensch gekommen wäre, der so überaus traurig ausgesehen, und wie sie ihn geküsst hätte, um zu sehen, ob er dadurch nicht vielleicht etwas fröhlicher würde.
Da schlug der König die Hände über dem Kopf zusammen. "Einen fremden, hergelaufenen Menschen, wahrscheinlich einen ganz gewöhnlichen Handwerksburschen! Mit schlechten Kleidern; und noch dazu ohne Hut! Es ist unglaublich!" "Er dauerte mich so sehr!" "Ein hübscher Grund für eine Prinzessin, den ersten besten Strolch zu küssen! Und Pechvogel heißt er? Unerhört! Aber den Menschen muss ich haben, und wenn ich ihn habe, wird er geköpft. Das ist die allergeringste Strafe, die ihn treffen kann!"
Darauf befahl der König seinen Reitern, das Land nach allen Richtungen hin zu durchstreifen und auf den armen Pechvogel zu fahnden. "Wenn ihr einen jungen Menschen findet, der aussieht, als hätten ihm die Mäuse das Brot weg gefressen, und keinen Hut hat, der ist es! Den bringt ihr sofort hierher!" Und die Reiter stoben auseinander wie Spreu, in die der Wind fährt, und durchzogen das ganze Land.
Manche von ihnen kamen auch an Pechvogel vorbei, der in seiner vornehmen Kleidung stolz auf dem Pferde saß; aber sie erkannten ihn nicht, und die meisten von ihnen kehrten unverrichteterdinge in das Schloss zurück, wo sie der König zornig anfuhr und alberne, ungeschickte Menschen schalt, die zu gar nichts zu gebrauchen seien. Die Prinzessin aber blieb traurig wie zuvor und kam jeden Mittag mit verweinten Augen zu Tisch; und der König tat auch weiter nichts, als dass er immer wieder seine schöne, traurige Tochter ansah, und ließ darüber Suppe und Braten kalt werden.
So ging es Woche um Woche. Eines Tages jedoch entstand plötzlich ein Lärmen auf dem Schlosshofe. Alles lief zusammen, und ehe noch der König Zeit gehabt, ans Fenster zu treten, um nach der Ursache zu sehen, führten schon zwei Reiter den armen Pechvogel in sein Zimmer. Sie hatten ihm die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, aber sein Gesicht strahlte, als wenn ihm in seinem Leben noch nie etwas Lieberes widerfahren wäre. Er verneigte sich vor dem Könige und richtete sich dann stolz auf, abwartend, was er über ihn beschließen würde.
"Wir haben den sauberen Vogel gefangen, Majestät!" sagte der ältere der beiden Reiter. "Er muss sich aber inzwischen gemausert haben; denn Eure Beschreibung passt wie die Faust aufs Auge! Gewiss hätten wir ihn auch nie gefunden, wenn uns nicht der dumme Tölpel, als wir im Wirtshaus mit ihm zusammentrafen, die ganze Geschichte selbst erzählt hätte. Und wisst ihr, was er getan hat, nachdem wir ihn gefangen und gebunden? Weitergelacht und weitergesungen!
Und wie wir ihn auf sein Pferd gesetzt, zwischen unsere Pferde genommen und hierher gejagt? Geschimpft und gezankt, dass wir so langsam ritten! Als wenn er es nicht erwarten könne, bis er geköpft würde. Wenn das der traurigste Mensch in der ganzen Christenheit sein soll, Majestät, so möchte ich wohl den allerlustigsten sehen. Der muss sich dann zum Frühstück die Beine ausreißen und in den Kaffee tauchen. Alles andere hat der hier schon unterwegs gemacht!"
Als der König dies gehört, trat er vor Pechvogel mit gekreuzten Armen hin und sagte: "Also du bist der Mensch, der die Frechheit gehabt hat, sich von der Prinzessin küssen zu lassen?" "Ja, Herr König! Und ich bin seitdem der allerglückseligste Mensch der Welt geworden!" "Werft ihn in den Turm, er soll morgen geköpft werden!"
Hierauf führten die Reiter Pechvogel hinaus und in den Turm; der König aber ging mit langen Schritten in seinem Zimmer auf und ab. "Das ist ein schlimmer Handel", sagte er. "Haben tue ich ihn, und geköpft wird er; aber davon allein wird mein Glückskind nicht wieder lustig." Dann ging er leise bis an das Zimmer seiner Tochter, sah durchs Schlüsselloch, schüttelte den Kopf, ging wieder lange auf und ab und ließ endlich seinen Geheimen Rat kommen. Als dieser alles gehört, besann er sich und sagte:
"Ich weiß nicht, ob es hilft, aber man könnte es versuchen. Dass der Pechvogel vorher traurig war und jetzt lustig ist, ist sicher; ebenso, dass unsere schöne Prinzessin früher stets fröhlich war und nun fortwährend weint. Dass der Kuss daran schuld ist, ist doch sehr wahrscheinlich. Also, der Pechvogel muss der Prinzessin den Kuss wiedergeben. Majestät, das ist meine untertänigste Meinung!"
"Das ist ja ganz unmöglich", erwiderte der König ärgerlich, "und ganz gegen die Sitte meines Hauses!" "Ehrwürdige Majestät müssen die Sache nur als Staatsakt betrachten, dann geht es wohl, und niemand kann etwas dagegen einwenden." Der König überlegte sich die Angelegenheit noch etwas, dann sagte er: "Gut, wir wollen es versuchen. Rufe alle Grafen und Ritter ins Thronzimmer und lass den Gefangenen herauf führen!"
Darauf legte der König seine Staatskleidung an und nahm auf dem Throne Platz. Neben ihm stand die Prinzessin, der er gar nicht gewagt hatte zu sagen, weshalb er sie hatte rufen lassen, und um ihn herum in großem Kreise der ganze Hof; lauter vornehme Herren in goldgestickten Kleidern mit Sternen und Schärpen. Alles war ganz still. Da ging die Tür auf, und Pechvogel wurde hereingebracht.
"Du wirst morgen geköpft", fuhr ihn der König an, "aber zuvor wirst du augenblicklich und vor allen diesen edlen und erlauchten Herren meiner Tochter den Kuss wiedergeben, den sie dir unüberlegterweise gegeben hat!" "Wenn Ihr nur das wünscht, Herr König", entgegnete Pechvogel, "so will ich es herzlich gern tun, und wenn es möglich ist, dass ein Mensch noch glücklicher werden kann, als ich es jetzt schon bin, so werde ich es gewiss werden!" "Das wollen wir erst einmal sehen", unterbrach ihn der König barsch. "Diesmal könntest du dich verrechnet haben!"
Darauf schritt Pechvogel auf die Prinzessin zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuss. Sie aber nahm seine Hand, sah ihn sehr freundlich an, und beide blieben vor dem Throne stehen.
"Bist du nun wieder vergnügt, meine liebe Tochter?" fragte der König. "Ein klein bisschen, Herr Vater", entgegnete sie. "Aber es wird gewiss nicht lange vorhalten." "Ja, ja!" sagte der König traurig, "ich sehe es schon. Er ist ja nicht wieder traurig geworden, wie es sein müsste, wenn es richtig wäre. Er steht ja noch immer da und lächelt und macht immer noch das unverschämt vergnügte Gesicht! Was nun anfangen?"
Da schlug die Prinzessin die Augen nieder und sagte leise: "Ich weiß es, Vater, und will es dir sagen; aber bloß ins Ohr." Darauf ging der König mit der Prinzessin auf den Vorsaal, und wie sie wieder hereintraten, nahm er die Hand Pechvogels, legte sie in die der Prinzessin und sagte zu allen den versammelten Herren und Grafen: "Es ist nicht zu ändern, Gottes Wille geschehe; dies ist mein lieber Sohn, der König wird, wenn ich einmal sterbe."
Und Pechvogel wurde Prinz und später König. Er wohnte in dem goldenen Schlosse und gab der Prinzessin so viele Küsse, dass sie noch viel fröhlicher wurde als zuvor. Prinzessin Glückskind aber schenkte ihm für seinen hässlichen Namen die allerschönsten; jeden Tag einen anderen. Nur zuweilen, wenn sie recht übermütig lustig war, sagte sie zu ihm: "Weißt du noch, wie du früher hießest?" und dann wollte sie sich totlachen. Er aber hielt ihr den Mund zu und sprach: "Still! was sollen die Leute denken, wenn sie es hören? Ich verliere ja allen Respekt!"
Richard von Volkmann-Leander
DAS WOHLBEZAHLTE GESPENST ...

In einem gewissen Dorfe, das ich wohl nennen könnte, geht ein üblicher Fußweg über den Kirchhof und von da durch den Acker eines Mannes, der an der Kirche wohnt, und es ist ein Recht. Wenn nun die Ackerwege bei nasser Witterung schlüpfrig und ungangbar sind, ging man immer tiefer in den Acker hinein und zertrat dem Eigentümer die Saat, so dass bei anhaltend feuchter Witterung der Weg immer breiter und der Acker immer schmäler wurde, und das war kein Recht.
Zum Teil wusste nun der beschädigte Mann sich wohl zu helfen. Er gab untertags, wenn er sonst nichts zu tun hatte, fleißig acht, und wenn ein unverständiger Mensch diesen Weg kam, der lieber seine Schuh als seines Nachbars Gerstensaat schonte, so lief er schnell hinzu und pfändete ihn oder tat es mit ein paar Ohrfeigen kurz ab.
Bei Nacht aber wo man noch am ersten einen guten Weg braucht und sucht, war es nun desto schlimmer, und die Dornenäste und Rispen, mit welchen er den Wandernden verständlich machen wollte, wo der Weg sei, waren allemal in wenig Nächten niedergerissen oder ausgetreten und mancher tat es vielleicht mit Fleiß. Aber da kam dem Mann etwas anderes zustatten.
Es wurde auf einmal unsicher auf dem Kirchhofe, über welchen der Weg ging. Bei trockenem Wetter und etwas hellen Nächten sah man oft ein langes weißes Gespenst über die Gräber wandeln. Wenn es regnete oder sehr finster war, hörte man im Beinhaus bald ein ängstliches Stöhnen und Winseln, bald ein Klappern, als wenn alle Totenköpfe und Totengebeine darin lebendig werden wollten.
Wer das hörte, sprang bebend wieder zur nächsten Kirchhoftüre hinaus, und in kurzer Zeit sah man, sobald der Abend dämmerte und die letzte Schwalbe aus der Luft verschwunden war, gewiss keinen Menschen mehr auf dem Kirchhofweg, bis ein verständiger und herzhafter Mann aus einem benachbarten Dorfe sich an diesem Ort verspätete und, den nächsten Weg nach Haus doch über diesen verschrienen Platz und über den Gerstenacker nahm.
Denn ob ihm gleich seine Freunde die Gefahr vorstellten und lange abwehrten, so sagte er doch am Ende: "Wenn es ein Geist ist, gehe ich mit Gott als ein ehrlicher Mann den nächsten Weg zu meiner Frau und zu meinen Kindern heim, habe nichts Böses getan, und ein Geist, wenn es auch der schlimmste unter allen wäre, tut mir nichts.
Ist es aber Fleisch und Bein, so habe ich zwei Fäuste bei mir, die sind auch schon dabei gewesen." Er ging. Als er aber auf den Kirchhof kam und kaum am zweiten Grab vorbei war, hörte er hinter sich ein klägliches Ächzen und Stöhnen, und als er zurückschaute, siehe, da erhob sich hinter ihm, wie aus einem Grabe herauf, eine lange weiße Gestalt.
Der Mond schimmerte weiß über die Gräber. Totenstille war ringsumher, nur ein paar Fledermäuse flatterten vorüber. Da war dem guten Mann doch nicht wohl zumute, wie er nachher selber gestand, und wäre gerne wieder zurück gegangen, wenn er nicht noch einmal an dem Gespenst hätte vorbeigehen müssen. Was war nun zu tun?
Langsam und still ging er seines Weges zwischen den Gräbern und manchem schwarzen, Totenkreuz vorbei. Langsam und immer ächzend folgte zu seinem Entsetzen das Gespenst ihm noch, bis an das Ende des Kirchhofs, und das war in der Ordnung und bis vor den Kirchhof hinaus, und das war dumm. Aber so geht es.
Kein Betrüger ist so schlau, er verratet sich. Denn sobald der verfolgte Ehrenmann das Gespenst auf dem Acker erblickte, dachte er bei sich selber: Ein rechtes Gespenst muss wie eine Schildwache auf seinem Posten bleiben, und ein Geist, der auf den Kirchhof gehört, geht nicht aufs Ackerfeld. Daher bekam er auf einmal Mut, drehte sich schnell um, fasste die weiße Gestalt mit fester Hand und merkte bald, dass er unter einem Leintuch einen Burschen am Brusttuch habe, der noch nicht auf dem Kirchhof daheim sei.
Er fing daher an, mit der anderen Faust auf ihn loszutrommeln, bis er seinen Mut an ihm gekühlt hatte, und da er vor dem Leintuch selber nicht sah, wo er hin schlug, so musste das arme Gespenst die Schläge annehmen, wie sie fielen.
Damit war nun die Sache abgetan, und man hat weiter nichts mehr davon erfahren, als dass der Eigentümer des Gerstenackers ein paar Wochen lang mit blauen und gelben Zierrat im Gesicht herumging und von dieser Stunde an kein Gespenst mehr auf dem Kirchhof zu sehen war.
Denn solche Leute, wie unser handfester Ehrenmann, das sind allein die rechten Geisterbanner, und es wäre zu wünschen, dass jeder andere Betrüger und Gaukelhans ebenso sein Recht und seinen Meister finden möchte.
Johann Peter Hebel
DER GEHEILTE PATIENT ...

Reiche Leute haben trotz ihrer gelben Vögel (Goldstücke) doch manchmal auch allerlei Lasten und Krankheiten auszustehen, von denen gottlob der arme Mann nichts weiß, denn es gibt Krankheiten, die nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schüsseln und Gläsern und in den weichen Sesseln und seidenen Betten wie jener hautreiche Amsterdamer ein Wort davon reden kann.
Den ganzen Vormittag saß er im Lehnsessel und rauchte Tabak, wenn er nicht zu faul war, oder hatte Maulaffen feil zum Fenster hinaus, aß aber zu Mittag doch wie ein Drescher, und die Nachbarn sagten manchmal: "Windet es draußen, oder schnauft der Nachbar so?" -
Den ganzen Nachmittag aß und trank er ebenfalls bald etwas Kaltes, bald etwas Warmes, ohne Hunger und ohne Appetit, aus lauter Langeweile bis an den Abend, also dass man bei ihm nie recht sagen konnte, wo das Mittagessen aufhörte und wo das Nachtessen anfing. Nach derb Nachtessen legte er sich ins Bett und war so müde, als wenn er den ganzen Tag Steine abgeladen oder Holz gespalten hätte.
Davon bekam er zuletzt einen dicken Leib, der so unbeholfen war wie ein Maltersack. Essen und Schlaf wollte ihm nimmer schmecken, und er war lange Zeit, wie es manchmal geht, nicht recht gesund und nicht recht krank; wenn man aber ihn selber hörte, so hatte er 365 Krankheiten, nämlich alle Tage eine andere.
Alle Ärzte, die in Amsterdam sind, mussten ihm raten. Er verschluckte ganze Feuereimer voll Mixturen und ganze Schaufeln voll Pulver und Pillen wie Enteneier so groß, und man nannte ihn zuletzt Scherzweise nur die zweibeinige Apotheke. Aber alles Doktern half ihm nichts, denn er folgte nicht, was ihm die Ärzte befahlen, sondern sagte: Joudre, wofür bin ich ein reicher Mann, wenn ich soll leben wie ein Hund, und der Doktor will mich nicht gesund machen für mein Geld?"
Endlich hörte er von einem Arzt, der hundert Stund weit weg wohnte, der sei so geschickt, dass die Kranken gesund werden, wenn er sie nur recht anschaue, und der Tod gehe ihm aus dem Weg, wo er sich sehen lasse. Zu dem Arzt fasste der Mann ein Zutrauen und schrieb ihm seinen Umstand. Der Arzt merkte bald, was Ihm fehle, nämlich nicht Arznei, sondern Mäßigkeit und Bewegung, und sagte: "Warte, dich will ich bald kuriert haben!"
Deswegen schrieb er ihm ein Brieflein folgenden Inhalts "Guter Freund, Ihr habt einen schlimmen Umstand, doch wird Euch zu helfen sein, wenn Ihr folgen wollt. Ihr habt ein bös Tier im Bauch, einen Lindwurm mit sieben Mäulern. Mit dem Lindwurm muss ich selber reden, und Ihr müsst zu mir kommen. Aber fürs erste, so dürft Ihr nicht fahren oder auf dem Rösslein reiten, sondern auf des Schuhmachers Rappen, sonst schüttelt Ihr den Lindwurm, und er beißt Euch die Eingeweide ab, sieben Därme auf einmal ganz entzwei.
Fürs andere dürft Ihr nicht mehr essen, als zweimal des Tages einen Teller voll Gemüse, mittags ein Bratwürstlein dazu, und nachts ein Ei, und am Morgen ein Fleischsüpplein mit Schnittlauch drauf. Was Ihr mehr esset, davon wird nur der Lindwurm größer, also dass er Euch die Leber verdrückt, und der Schneider hat Euch nimmer viel anzumessen, aber der Schreiner. Dies ist mein Rat, und wenn Ihr mir nicht folgt, so hört Ihr im anderen Frühjahr den Kuckuck nimmer schreien. Tut, was Ihr wollt!"
Als der Patient so mit ihm reden hörte, ließ er sich sogleich den anderen Morgen die Stiefel salben und machte sich auf den Weg, wie ihm der Doktor befohlen hatte. Den ersten Tag ging es so langsam, dass perfekt eine Schnecke hätte können sein Vorreiter sein, und wer ihn grüßte, dem dankte er nicht, und wo ein Würmlein auf der Erde kroch, das zertrat er.
Aber schon am zweiten und am dritten Morgen kam es ihm vor, als wenn die Vögel schon lange nimmer so lieblich gesungen hätten wie heut, und der Tau schien ihm so frisch und die Kornrosen im Felde so rot, und alle Leute, die ihm begegneten, sahen so freundlich aus, und er auch; und alle Morgen, wenn er aus der Herberge ausging, war es schöner, und er ging leichter und munterer dahin, und als er am achtzehnten Tage in der Stadt des Arztes ankam und den anderen Morgen aufstand, war es ihm so wohl, dass er sagte: "ich hätte zu keiner ungeschickteren Zeit können gesund werden, als jetzt, wo ich zum Doktor soll.
Wenn es mir doch nur ein wenig in den Ohren brauste, oder das Herzwasser lief' mir." Als er zum Doktor kam, nahm ihn der Doktor bei der Hand und sagte ihm. "Jetzt erzählt mir denn noch einmal von Grund aus, was Euch fehlt." Da sagte er: "Herr Doktor, mir fehlt gottlob nichts, und wenn Ihr so gesund seid wie ich, so soll es mich freuen."
Der Doktor sagte: "Das hat Euch ein guter Geist geraten, dass Ihr meinem Rat gefolgt habt. Der Lindwurm ist jetzt abgestanden. Aber Ihr habt noch Eier im Leib, deswegen müsst Ihr wieder zu Fuß heimgehen und daheim fleißig Holz sägen, dass es niemand sieht, und nicht mehr essen, als Euch der Hunger ermahnt, damit die Eier nicht ausschlüpfen, so könnt Ihr ein alter Mann werden", und lächelte dazu.
Aber der reiche Fremdling sagte: "Herr Doktor, Ihr seid ein feiner Kauz, und ich verstehe Euch wohl", und hat nachher dem Rat gefolgt und 87 Jahre, 4 Monate, 10 Tage gelebt, wie ein Fisch im Wasser so gesund, und hat alle Neujahr dem Arzt 20 Dublonen zum Gruß geschickt.
Johann Peter Hebel
DER KLEINE MOHR UND DIE GOLDPRINZESSIN ...
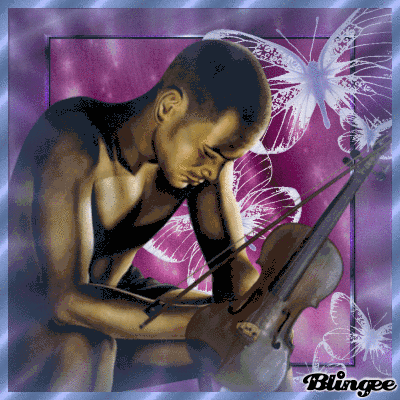
Es war einmal ein armer kleiner Mohr, der war kohlschwarz und nicht einmal ganz echt in der Farbe, so dass er abfärbte. Abends war sein Hemdkragen stets ganz schwarz, und wenn er seine Mutter anfasste, sah man alle fünf Finger am Kleid. Deshalb wollte sie es auch nie leiden, sondern stieß und schuppte ihn stets fort, wenn er in ihre Nähe kam. Und bei den anderen Leuten ging es ihm noch schlimmer.
Als er vierzehn Jahre alt geworden war, sagten seine Eltern, es sei höchste Zeit, dass er etwas lerne, womit er sich sein Brot verdienen könne. Da bat er sie, sie sollten ihn in die weite Welt hinausziehen und Musikant werden lassen; zu etwas anderem sei er doch nicht zu gebrauchen.
Doch sein Vater meinte, das wäre eine brotlose Kunst, und die Mutter wurde gar ganz ärgerlich und erwiderte weiter nichts als: "Dummes Zeug, du kannst nur etwas Schwarzes werden!"
Endlich kamen sie überein, er passe am besten zum Schornsteinfeger. Also brachten sie ihn zu einem Meister in die Lehre, und weil sie sich schämten, dass er ein Mohr war, so sagten sie, sie hätten ihn gleich schwarz gemacht, um zu sehen, wie es ihm stände. So war nun der kleine Mohr Schornsteinfeger und musste tagaus, tagein in die Essen kriechen. Und die Essen waren oft so eng, dass er Angst hatte, er bliebe stecken. Doch er kam stets glücklich wieder auf dem Dache heraus, obschon es ihm oft so war, als wenn Haut und Haare hängen blieben.
Wenn er dann hoch oben auf dem Schornstein saß, wieder Gottes freie Luft atmete und sich die Schwalben um den Kopf fliegen ließ, wurde ihm die Brust so weit, als sollte sie ihm zerspringen. Dann schwenkte er den Besen und rief so laut Ho-i-do! Ho-i-do! wie's die Schornsteinfeger zu tun pflegen, dass die Leute auf der Straße stehen blieben und sprachen: "Seht einmal den schwarzen Knirps, was der für eine Stimme hat!"
Als er ausgelernt hatte, befahl ihm der Meister, er solle in seine Kammer gehen und sich waschen und ganz fein und nobel anziehen. Er wolle ihn freisprechen, dann wäre er Geselle.
Da überkam den armen kleinen Mohr eine Todesangst, denn er sagte sich: "Nun wird alles herauskommen!" Und das geschah auch; denn als er in seinem besten Staate wieder in die Meisterstube eintrat, wo schon Lehrlinge und Gesellen sich versammelt hatten, war er immer noch sehr schwarz, wenn auch hier und da etwas Helles durchschimmerte, wo er sich das Schwarze in den Essen abgescheuert hatte.
Da merkten alle mit Entsetzen, wie es mit ihm stand. Der Meister erklärte, Geselle könne er nun nicht werden, denn er sei ja nicht einmal ein ordentlicher Christenmensch; die Lehrjungen aber fielen über ihn her, zogen ihm die Kleider aus und trugen ihn in den Hof. Dort legten sie ihn trotz alles Sträubens unter die Plumpe, pumpten wacker darauf und rieben ihn mit Strohwisch und Sand, bis ihnen die Arme lahm wurden. Als sie endlich gewahr wurden, dass trotz aller Mühe gar wenig abging, stießen sie ihn unter Scheltworten zur Hoftüre hinaus.
Da stand er nun mitten auf der Straße, hilflos und wie ihn der liebe Gott geschaffen, der arme kleine Mohr, und wusste nicht, was anfangen. Da kam durch Zufall ein Mann vorbei, der besah ihn sich von oben bis unten, und als er merkte, dass er ein Mohr war, sagte er, er sei ein vornehmer Herr und wolle ihn in seinen Dienst nehmen. Er solle nichts weiter zu tun bekommen, als hinten auf seinem Wagen stehen, wenn er mit seiner Frau spazieren führe, damit man gleich sähe, dass vornehme Leute kämen.
Da besann sich der kleine Mohr nicht lange, sondern ging mit, und anfangs ging alles gut. Denn die Frau des vornehmen Mannes mochte ihn gut leiden, und wenn sie an ihm vorbeiging, streichelte sie ihn jedes Mal. Das war ihm in seinem Leben noch nie begegnet. Eines Tages jedoch, da sie auch wieder spazieren fuhren und er hintendrauf stand, erhob sich ein furchtbares Unwetter, und der Regen floss in Strömen. Als sie wieder nach Hause kamen, sah der vornehme Herr, dass es hinten schwarz vom Wagen herabtröpfelte.
Da fuhr er den kleinen Mohr barsch an, was das heißen solle. Der erschrak heftig, und weil ihm nichts Besseres einfiel, so antwortete er, die Wolken wären ganz schwarz gewesen, da hätte es gewiss auch schwarz geregnet. "Larifari", erwiderte der vornehme Herr, der schon merkte, woran es lag, nahm das Taschentuch, leckte zum Überfluss am Zipfel und fuhr damit dem kleinen Mohr über die Stirn. Da war der Zipfel schwarz.
"Dachte ich mir es doch gleich", rief er aus, "du bist ja nicht einmal echt! Das ist eine hübsche Entdeckung! Such dir einen anderen Dienst. Ich kann dich nicht gebrauchen!" Da packte der arme kleine Mohr weinend seine Siebensachen zusammen und wollte gehen. Doch die Frau des vornehmen Mannes rief ihn noch einmal zurück und sagte, es sei recht schade, dass ihr Mann es gemerkt hätte, denn sie wisse es schon lange.
Freilich, ein großes Unglück sei es, ein Mohr zu sein, und besonders einer, der abfärbe. Doch er solle nicht verzagen, sondern brav und gut bleiben, dann würde er mit der Zeit noch ebenso weiß werden wie die anderen Menschen. Darauf schenkte sie ihm eine Geige und einen Spiegel, in dem solle er sich jede Woche einmal besehen.
So zog denn der kleine Mohr in die Welt hinaus und wurde Musikant. Einen Meister, der ihm vorspielte, hatte er freilich nicht. Doch er horchte auf das, was die Vögel sangen und was die Büsche und Bäche rauschten, und spielte es ihnen nach. Nachher ward er inne, dass die Blumen im Walde und die Sterne in der dunkeln Mitternacht auch ihre besondere Musik machten, wenn auch eine ganz stille, die nicht jedermann hörte.
Das war schon viel schwerer nachzuspielen. Doch das Schwerste lernte er zu allerletzt: so zu spielen, wie die Menschenherzen pochen. Er war wohl schon sehr viel die Kreuz und die Quer umhergewandert und hatte vielerlei erlebt, ehe er das lernte. Und es ging ihm auf seiner Wanderschaft zuweilen gut, meistenteils aber schlecht.
Wenn er abends in der Dunkelheit vor irgendeinem Hause halt machte, ein schönes Lied spielte und um Herberge für die Nacht bat, ließen ihn die Leute wohl ein. Sahen sie aber am anderen Morgen, wie schwarz er war und dass man nicht gut tat, sich mit ihm einzulassen, weil er abfärbte, so regnete es spitze Redensarten oder wohl gar Püffe. Deshalb verlor er aber den Mut nicht, sondern dachte an das, was die Frau des vornehmen Mannes zu ihm gesagt hatte, und fiedelte sich weiter von Stadt zu Stadt und von Land zu Land.
Jeden Sonntag zog er den Spiegel hervor und sah nach, wie viel abgegangen war. Viel war's freilich nicht von einem Sonntag zum anderen, denn es saß sehr fest, aber doch etwas: und als er fünf Jahre gewandert war, sah man überall die Grundfarbe durchschimmern. Gleichzeitig war er ein solcher Meister auf der Geige geworden, dass, wo er hin kam, jung und alt zusammen strömte, um ihm zuzuhören.
Eines Tages kam er in eine wildfremde Stadt, in der herrschte eine goldene Prinzessin; die hatte Haare von Gold und ein Gesicht von Gold und Hände und Füße von Gold. Sie aß mit einem goldenen Messer und einer goldenen Gabel von einem goldenen Teller, trank goldenen Wein und hatte goldene Kleider an. Kurz alles war golden, was an ihr und um sie war.
Im übrigen war sie jedoch über die Maßen stolz und hochmütig, und obschon es ihre Untertanen wünschten, dass sie sich einen Prinzen zum Mann nähme, weil sie meinten, Weiberregiment tauge nichts auf die Dauer, war ihr doch keiner schön und vornehm genug. Jeden Morgen ließen sich etwa sechs Prinzen als Freier bei ihr melden, die abends zuvor mit der Post angekommen waren. Denn weit und breit sprach man von nichts als von der Goldprinzessin und von ihrer Schönheit.
Die sechs Prinzen mussten sich dann der Reihe nach vor ihrem Throne aufstellen, und sie besah sich dieselben von allen Seiten. Zuletzt rümpfte sie jedoch jedes Mal die Nase und sagte:
"Der erste ist budlich,
Der zweite ist schmudlich,
Der dritt hat kein Haar,
Der viert ist nicht gar,
Der fünft ist perplex
Und miesrig der sechst!
Die Kur ist aus.
Jagt mir alle sechse zur Stadt hinaus!"
Alsbald erschienen zwölf riesige Heiducken mit mannslangen Birkenreisern und trieben die ganze Gesellschaft zur Stadt hinaus. So ging es schon seit Jahren alle Tage. -
Als der kleine Mohr vernahm, wie wunderschön die Prinzessin war, konnte er an weiter gar nichts denken. Er ging nach ihrem Palaste, setzte sich auf die Treppenstufen, nahm die Geige zur Hand und fing an, sein bestes Lied zu spielen. Vielleicht sieht sie zum Fenster heraus, dachte er, dann bekommst du sie zu sehen.
Es währte nicht lange, so befahl die Goldprinzessin ihren drei Kammermädchen nachzusehen, wer draußen so schön spiele. Da brachten sie die Nachricht, es wäre ein Mensch, der habe eine so absonderliche Gesichtsfarbe, wie sie dergleichen noch nie gesehen. Und die eine behauptete, er sei mausgrau; die zweite, er sei hechtgrau, und die dritte gar, er wäre eselsgrau. Darauf meinte jene, das müsse sie selber sehen, sie sollten den Menschen heraufholen.
Da gingen die Kammermädchen abermals hinunter und führten ihn herauf, und als er die Prinzessin erblickte, die wirklich über und über von Gold war und wie die Sonne glänzte, war er erst so geblendet, dass er die Augen zumachen musste. Als er sich aber ein Herz fasste und die Prinzessin ordentlich ansah, da wusste er sich nicht weiter zu helfen; er warf sich vor ihr auf die Knie nieder und sagte:
"Allerschönste Goldprinzessin! Ihr seid so schön, wie Ihr es gar nicht wisst! Und wenn Ihr es wisst, so seid Ihr noch hunderttausendmal schöner. Ich bin ein kleiner Mohr, der immer weißer wird; und das Lied, das ich gespielt habe, ist noch lange nicht mein allerschönstes. Einen Mann müsst Ihr durchaus haben; und wenn Ihr mich heiraten wollt, werde ich so vergnügt, dass ich mit gleichen Beinen über den Tisch springen will!"
Als die Prinzessin dies hörte, machte sie zuerst ein Gesicht wie die Gänse, wenn's Wetter leuchtet, denn übermäßig klug war sie gerade nicht, trotz aller ihrer Schönheit, und dann fing sie so laut zu lachen an, dass sie sich die Hüften mit den Händen halten musste. Und die drei Kammermädchen meinten, sie müssten auch mitlachen, und auf einmal traten noch die zwölf Heiducken herein, und wie sie sahen, wer vor der Goldprinzessin kniete, schlugen auch sie ein Gelächter auf, dass es durch die ganze Stadt schallte.
Da befiel den kleinen Mohr ein ungeheurer Schrecken, denn er merkte wohl, dass er etwas Dummes gesagt hatte. Er nahm seine Geige, riss die Tür auf und sprang mit drei Sätzen die Treppe hinab. Dann lief er, ohne sich umzusehen, durch die Straße, querfeldein bis in den nächsten Wald. Dort warf er sich todmüde ins Gras nieder und weinte, als wenn er fort schwimmen wollte.
Doch endlich ward er wieder ruhig und sagte zu sich selbst: Wenn der Kutscher betrunken ist, gehen die Pferde durch! Bist du klug oder bist du dumm? Die Goldprinzessin wolltest du heiraten? Ganz dumm bist du! Da darfst du dich nicht wundern, wenn die Leute dich auslachen.
Damit hing er sich die Geige wieder über den Rücken, pfiff sich eins und wanderte weiter und zog wie zuvor von Stadt zu Stadt und von Land zu Land.
Und von Jahr zu Jahr wurde er immer weißer, und die Leute gewannen ihn immer lieber, denn die Lieder, die er sich ausdachte, wurden immer schöner, und kein Mensch konnte sich mit ihm auf der Geige messen. Und als er groß und ein Mann geworden war, sah er ganz weiß aus, ja selbst weißer und reiner als die meisten anderen Leuten. Niemand wollte glauben, dass er früher ein Mohr gewesen sei.
Es trug sich zu, dass er auch einmal in einen Flecken kam, wo gerade Jahrmarkt war. Da sah er eine Bude mit einem roten Vorhang, der war früher einmal neu gewesen, jetzt aber zerlumpt und voller Flecke. Davor stand ein wüster Gesell mit einer bunten Jacke, der stieß in die Trompete und rief, die Leute möchten doch eintreten, es wären die größten Wunder der Welt zu sehen: ein Kalb mit zwei Köpfen, das zweimal fräße und bloß einmal verdaute, ein Schwein, das die Karten legen und wahrsagen könnte, und die hochberühmte, wunderschöne Goldprinzessin, um die sich alle Männer gerissen hätten.
"Das kann doch nicht deine Goldprinzessin sein?" sagte er, ging jedoch trotzdem hinein. Da war es ihm, als solle er vor Schreck in die Erde sinken; denn sie war es wirklich. Aber das Gold war fast überall ab, und er sah, dass sie nur von Blech war. "Heiliger Gott!" rief er aus, "wie kommst du hierher und wie siehst du aus?"
"Was ist denn?" erwiderte sie, als wenn gar nichts wäre. Nachdem sie sich jedoch überlegt, dass er sie gewiss schon früher einmal gesehen, wie sie noch ganz golden war, fügte sie zornig hinzu: "Glaubst du etwa, dass man ewig hält, du alberner Laffe? Zupf dich an deiner eigenen Nase!"
Da hätte er beinahe laut aufgelacht, denn er sah, dass sie ihn nicht erkannt. Doch sie tat ihm viel zu leid, und so fragte er nur leise, ob sie denn gar nicht wisse, wer er sei. Er wäre der kleine Mohr, den sie vorzeiten einmal so sehr ausgelacht hätte.
Nun war die Reihe an ihr, ganz still zu werden und sich zu schämen, und unter vielem Schluchzen erzählte sie, wie erst an ein paar Stellen und dann fast überall das Gold herunter gegangen sei; wie sie das ihren Untertanen lange verborgen und wie diese es endlich doch gemerkt und sie fort gejagt hätten. Nun zöge sie auf den Jahrmärkten umher, habe es aber satt, und wenn er noch so dächte wie früher, wollte sie ihn gern heiraten.
Darauf erwiderte er sehr ernsthaft, er bedaure sie zwar von Herzen, sei aber schon viel zu verständig, um eine Blechprinzessin zu heiraten. Er hoffe bestimmt, noch einmal eine viel bessere Frau zu bekommen wie sie. Damit ging er zur Bude hinaus und ließ die Blechprinzessin stehen, die vor Wut beinahe platzte und ihm, während er ging, fortwährend nachrief:
"Mohrenjunge, Mohrenjunge! kohlschwarzer Mohrenjunge, der abfärbt!" und ähnliches. Doch niemand wusste, wen sie damit meinte, da er ja längst auch nicht ein Tüpfchen Schwarzes mehr an sich hatte. Er ging daher sittsam weiter, ohne sich auch nur umzusehen, und war froh, dass er in seinem Leben nie wieder etwas von der abscheulichen Person erfuhr.
Eine Zeit lang setzte er noch sein altes Wanderleben fort; als er aber fast die ganze Welt gesehen hatte und anfing, des Umherziehens müde zu werden, da traf es sich, dass der König von seinem Spiel hörte und ihn rufen ließ. Ein Lied nach dem anderen musste er ihm bis in die späte Mitternacht vorspielen, und zuletzt stieg der König von seinem Thron, umarmte ihn und fragte, ob er sein bester Freund werden wolle.
Als er dies bejahte, ließ ihn der König in seinem goldenen Wagen durch die Stadt fahren und schenkte ihm ein Haus und so viel Geld, dass er sein Lebtag daran genug hatte. Und eine Frau bekam er auch. Zwar keine Prinzessin und noch weniger eine über und über goldene, aber eine Frau, die ein goldenes Herz hatte. Mit der lebte er vergnügt und hochgeehrt bis an sein spätes Ende.
Die Blechprinzessin aber ward von Tag zu Tag unscheinbarer, und als das letzte bisschen Gold abgegangen war, wurde sie so viel hin und her geworfen, dass sie lauter Buckel und Dellen bekam. Zuletzt kam sie zu einem Trödler. Dort steht sie noch heute in der Ecke zwischen allerhand Tand und Kram und hat Zeit zu bedenken, dass vielerlei abgeht im Leben, Hübsches wie Hässliches, und dass alles darauf ankommt, was drunter ist.
Richard von Volkmann-Leander
DER ROSSSCHWEIF AN DER KRIPPE ...
Ein Landfahrer und Leutebetrüger ist einmal auf Landshut, so eine Stadt in Bayern, ankommen und hat daselbst austrommeln und ausrufen lassen, dass bei ihm eine Wundersache zu sehen sei, nämlich, er habe ein Pferd, welches den Kopf hat, wo andere Rosse den Schweif, wer solches schauen will, der muss einen Groschen geben.
Die Leute, so mehrerteils dem Vorwitz ergeben, sind in großer Menge zugeloffen. Nachdem nun alle bezahlet, da hat er den Stall eröffnet. Ein jeder wollte fast der erste darin sein, es wurden aber alle diesfalls ziemlich betrogen, maßen er das Pferd im Stall umgekehret und mit dem Schweif am Roßbahrn oder Krippen gebunden. "Da schauet", sagt er, "andere Pferde haben den Kopf an diesem Ort, mein Ross aber den Schweif", welches dann nicht ohne Gelächter abgeloffen.
Die Leute und gewinnsichtige Menschen erdenken allerlei Ränke und Betrug, wie sie nur mögen Geld bekommen, sie erwägen dessenthalben nicht weder Gottes Gebot noch der Menschen. Das Geld sollte eigentlich genennet werden Vestra Dominatio, Eure Herrlichkeit, maßen es über die mehreste Menschen herrschet.
Johann Ulrich Megerle
DER RUBIN ...
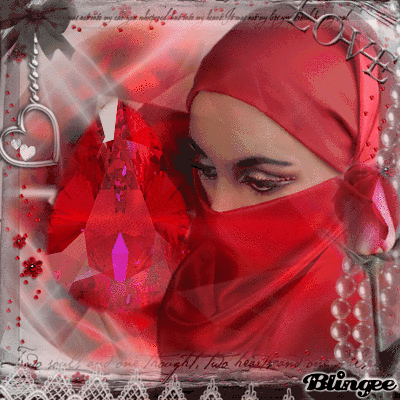
Es war an einem schönen, hellen Nachmittag, da stand Assad, ein junger Türke, der vor wenigen Tagen zum ersten Male die unermessliche Stadt Bagdad betreten hatte und sich nun mit stets gesteigertem Erstaunen unter all ihren Wundern erging, vor der Bude des reichsten und angesehensten Juweliers.
Mit inniger Lust versenkte er sich in das mannigfaltige glühende Leben, das, in Strahlen und Farben sich offenbarend, die edlen Gesteine durchflammt. "Oh, Edelstein", rief er voll Entzücken aus, "wohl mit Recht bist du erkoren, die Kronen der Könige zu schmücken, denn in dir ist alles Herrliche zugleich zusammengedrängt und geläutert, der flüchtige Sonnenstrahl ist gefangen genommen und in deinen geheimnisvollen Kern eingeschlossen; die schnell verlöschende Farbe feiert in dir ihre Verklärung und empfängt Unsterblichkeit, die reinen himmlischen Elemente, Luft, Feuer und Wasser vermählen sich in deinem Glanze! Hier steh' ich an der Grenze der Natur, hier ist das letzte, höchste Produkt der schaffenden Kräfte, weiter - schauernd fühlt es der Geist - kann die Unendlichkeit selbst nicht."
Der Juwelier, ein gutmütiger Mann, der für seine Kunst enthusiastisch eingenommen war, stand gerade in der Tür und empfand großes Vergnügen über die begeisterten Worte, die aus dem Munde des Jünglings hervorgingen. Er trat, bisher ungesehen, lächelnd zu ihm heran, öffnete den Kasten, ergriff seine Hand und steckte ihm einen schweren Ring an den Finger.
Assad bemerkte es kaum, seinen Blick fesselte mit magischer Gewalt ein Rubin von seltener Größe, auf den die Sonne, die eben aus einer verschleiernden Wolke hervortrat, ihren vollen Schein warf. Er drückte unwillkürlich seine gegen das Herz und holte zum Erstaunen des Juweliers einen tiefen Seufzer, dann streifte er den ihm angesteckten Ring mit dem Ausdruck sonderbaren Widerwillens wieder ab und rief, auf den Rubin zeigend, leidenschaftlich aus: "Behaltet das elende Ding und gebt mir den!"
Kopfschüttelnd erwiderte der Juwelier: "Der Stein ist mir um Hunderte nicht feil!" - "Ich muss ihn aber haben!" versetzte der Jüngling wie im Wahnsinn, ergriff den Rubin und stürzte flammenden Auges fort.
Der Juwelier erhob ein großes Geschrei, rannte Assad nach und schalt ihn einen Dieb, ja, da dies nicht zu helfen schien, einen Räuber und Mörder. Alsbald entstand ein Auflauf auf der Straße, der Jüngling wurde ergriffen und mit Ungestüm vor den Kadi geschleppt.
"Herr", begann der Juwelier voll Zorn, "so jung dieser Mensch zu sein scheint und so viel Einnehmendes in seiner Gestalt liegt, so ist er doch ein frecher, undankbarer Bösewicht. Ich sah ihn vor meiner Bude stehen und ergötzte mich, als ich ihn über die dort ausgebreiteten Schätze mit lauter Stimme, wie ein Kind, seine Verwunderung ausdrücken hörte.
Von Wohlwollen übermannt, dachte ich: Du sollst einmal billiger kaufen als ein anderer, nahm einen kostbaren Ring aus dem Kasten und steckte ihm diesen an. Ich erwartete, er würde, so plötzlich beschenkt, große Augen machen und nicht wissen, wie er sich gebärden solle. Stattdessen nahm er kaum Notiz von meiner Freundlichkeit und stieß zu meinem nicht geringen Ärger dumme, unvernünftige Seufzer aus.
Dann zog er den Ring wieder ab, warf ihn mir verächtlich hin und verlangte in einem so gebieterischen Ton, als ob er, wenn es ihm beliebte, auch wohl meinen Kopf fordern dürfte, den wundervollsten Rubin, der je in meine Hände geraten ist. Als ich, meinen gerechten Unwillen bekämpfend, weil ich seine Unwissenheit für den Grund seiner Unverschämtheit hielt, ihm bescheiden bemerkte, dass ein solcher Stein mehr Wert habe als er denke, erklärte er geradezu, er müsse ihn haben, nahm auch, mit der bekannten Abneigung der Straßenräuber gegen Formalitäten, sogleich von meinem Eigentum Besitz und begab sich auf die Flucht.
Ich folgte ihm; wie es mit bei der Last meines Bauches und in einer der Verdauung heiligen Stunde möglich war, ihn wieder einzuholen, begreife ich selbst nicht, die Angst muss dem Menschen übernatürliche Kräfte verleihen."
Der Kadi, ein langer hagerer Mensch mit einem Gesicht, das, wenn er in seiner Gerichtsstube stand, die Inschrift der Danteschen Hölle furchtbar getreu widerspiegelte, war einmal selbst bestohlen worden und sprach seitdem gegen Diebe nur noch Todesurteile aus. Er fragte Assad freundlich, ob er das ihm angeschuldigte Vergehen leugne.
"Wie könnt' ich!" gab der Jüngling finster zur Antwort. "Es wäre auch gleichgültig", versetzte der Kadi, mit jenem dem Teufel abgeborgten Lächeln, womit Gerichtspersonen in allen Ländern der zerquetschten Menschheit in einem Unglücklichen so gern den Gnadenstoß geben, "man führe ihn vor die Stadt hinaus und tue, was Rechtens. Jedoch nicht ohne vorgängige nachdrückliche Bastonade!" setzte er hinzu und griff nach der Pfeife, die ein Sklave ihm darbot.
Assad wurde abgeführt. Auf der Straße wandte er sich an den Juwelier, der in seiner Entrüstung noch gar nicht daran gedacht hatte, sich den Rubin zurückgeben zu lassen, und sagte zu ihm: "Herr, ich bitte Euch um einen letzten Gefallen. Lasst mir den Stein bis zum Tode. Begleitet mich hinaus bis vor das Tor, das ich ihn dort noch einmal anschaue und in Eure Hände überliefere. Nicht wahr, Ihr werdet es mir nicht abschlagen? Es ist ja nur noch kurze Zeit."
In dem Juwelier erwachte Mitleid, ihn dauerte der schöne gefasste Jüngling, der jetzt noch in voller Kraft und Glut des Lebens vor ihm stand und doch schon in wenigen Augenblicken der Natur vor der Zeit zur beliebigen Verwendung für einen neuen Zweck zurückgegeben war. Vielleicht hätte er nun den Rubin gern daran gesetzt, um ihn zu retten, doch das war bei der Gemütsart des Kadi unmöglich, er musste sich also darauf beschränken, dem Scheidenden freundlich seine letzte Bitte zu bewilligen.
Angelangt vor dem Tore zog Assad den Rubin, den er bis dahin auf seinem Herzen bewahrt hatte, hervor, hielt ihn gegen die Sonne, in deren Strahlen er blinkte, wie das Auge eines Menschen, drückte ihn wehmütig an den Mund und machte Anstalt, ihn dem Juwelier zurückzugeben.
Bevor er aber dies noch auszuführen vermochte, trat ein Greis von sehr würdigem Ansehen, dem alles Volk willig Platz machte, auf ihn zu, maß ihn mit einem strengen Blick und sagte: "Assad, du bist ein Dieb!" Glühendes Rot überströmte die Wangen des Jünglings, aber fest und unverwirrt schaute er zu dem Greise auf und antwortete: "Ja, und wie du gleich sehen wirst, ich leide den Tod dafür!" -
"Ist dir dein Diebstahl nicht leid?" fragte der Greis. "Nein", versetzte Assad schnell und bestimmt, "ich weiß nicht, was mich an diesen Stein kettet, aber es mag gut sein, dass ich sterben muss, denn ich fühl's, ehe ich ihn in den Händen eines anderen ließe, könnte ich mich mit Raub und Mord beflecken, obgleich meine Seele vor einem Mord zurückschaudert wie vor dem eigenen Tode." -
"Ei, wunderbar!" entgegnete der Greis, "gib mir doch deine Hand." Assad reichte ihm die Hand.
Plötzlich befand er sich auf einer unbekannten Landstraße. Der Greis stand neben ihm. Mehr verwundert und überrascht als erfreut, schaute der Jüngling seinen Retter mit einem fragenden Blick an.
"Du bist jetzt über hundert Stunden von Bagdad entfernt", begann der Greis, der seinen Blick wohl verstanden hatte, "und sie können dort, wenn sie wollen, ein Lamm strangulieren, das ich zum Zeichen deiner Unschuld an deiner Stelle zurückgelassen habe. Glaube jedoch nicht, dass ich dich gerettet haben würde, wenn Leichtsinn oder schnöde Habsucht dich zum Raub an fremdem Eigentum verleitet hätten. Mir stehen große Kräfte zu Gebote, aber ich missbrauche sie nie, wie so manche Genossen meiner Gewalt.
Die Natur hat jene Macht, die den gewöhnlichen Lauf der Dinge aufhalten und verändern kann, vertrauensvoll in unsere Hände gelegt, damit wir ihr in irgendeinem außerordentlichen Falle, wenn die allgemeine Regel, das einfache Gesetz, nicht ausreicht, zu Hilfe kommen mögen. Solch ein Fall ist der deinige, denn der Rubin, den du dort in der Hand hältst, ist das Grab einer wunderschönen verzauberten Prinzessin.
Aus ihrem Blut hat er das dunkle wunderbare Rot in sich gesogen, in das er getaucht ist. Das Feuer ihres Auges sprüht dir entgegen aus den blitzenden Strahlen, die er so verschwenderisch versendet. Ihr schlummerndes Leben schauerte dich an, als du den Stein im Sonnenschein glänzen sahst, da wurde deine Seele bis in die innersten Tiefen mit süßer Ahnung getränkt, und deine Hand musste vollbringen, was Herz und Sinne geboten." -
"Kann die Prinzessin durch mich erlöst werden?" fragte Assad tief aufatmend. "Das weiß nur sie selbst!" versetzte der Greis, "und du kannst, wenn du willst, sie einmal sehen und mit ihr reden. Sobald du um Mitternacht alle deine Gedanken in den einzigen an sie zusammendrängst und auf den Rubin drei Küsse drückst, so weicht der Zauber auf einen Augenblick, und sie tritt in voller Glorie und Schönheit aus ihrem steinernen Gefängnis hervor.
Aber, wage nicht dein Glück und deinen Frieden an einen ungewissen Moment; mit dem Dämon ist schwer zu kämpfen, dich aber würde die herrlichste der Jungfrauen mit unwiderstehlicher Gewalt in deinem tiefsten Sein gefangen nehmen, und, wenn das dir dann nicht gelänge, ihren Bann zu brechen, so wärst du elend auf ewig. Und nun leb wohl, kein Sterblicher sieht mich zum zweiten Mal!"
Der Greis war verschwunden, sowie er ausgeredet hatte. Assad bemerkte es kaum, denn jede seiner Empfindungen, jeder seiner Gedanken war an das Wunder, das er in seiner Hand hielt, gebunden. Wie freute er sich, dass die Sonne sich schon zum Untergang neigte, dass die Schatten sich verlängerten, wie sehnte er sich nach der Mitternacht, die er sonst als unheimliche Freistunde der Toten und Gespenster gescheut, vor der er sich ängstlich in die schützenden Arme des frommen Schlafs hinein geflüchtet hatte.
Sie erschien ihm jetzt wie ein Gefäß, aus dem seinen durstenden Lippen der holdeste Inbegriff alles Lebens entgegen schäumte, und dass sie über die ganze übrige Welt Angst, Grauen und Entsetzen ausgoss, gab ihr für ihn eben noch einen letzten, schauerlich-zauberischen Reiz. Unterdes eilte er, da es schon dunkel wurde, rastlos fort, um noch vor völligem Einbruch der Finsternis die Stadt, die er in nicht gar weiter Ferne vor sich liegen sah, zu erreichen. Dies gelang ihm, auch war das Glück ihm günstig, dass er bald bei einer alten Frau ein Unterkommen für die Nacht fand.
Er zog sich sogleich, große Müdigkeit vorschützend, in das ihm bestimmte Schlafgemach zurück, legte den Rubin vor sich auf den Tisch und zählte nun bei brennender Lampe und verhängten Fenstern die Minuten, die langsam, langsam, als wollte jede ihm den Inhalt der Ewigkeit vorrechnen, vorüber krochen. Endlich war es zwölf. Mit unsäglicher Inbrunst drückte er jetzt den Rubin an seinen Mund und küsste ihn dreimal.
Da war es, als ob sich der Edelstein in seiner Hand in leichten, gefärbten Duft auflockerte, der zu einer morgenroten Wolke, die das ganze Zimmer erfüllte, anschwoll. Aus der Wolke schimmerte eine weibliche Gestalt hervor, anfangs blass und im schwachen Umriss kaum erkennbar, aber schnell aufblühend zu frischem, glühendem Dasein. Die holde Jungfrau, in ein blaues Gewand gekleidet, das Haupt in kindlicher Anmut ein wenig vorwärts neigend, warf einen schüchternen Blick auf ihre Umgebung und rief:
"Wo bin ich?" Gleich darauf aber heftete sie, wie in trostloser Verzweiflung, ihr Auge starr und tränenlos auf Assad, vor dem es eben noch mädchenhaft scheu zurückgebebt war, und, als erdrückte die erst jetzt erwachte Erinnerung an ihren Zustand, wie ein Leichenstein, jedwede ihrer Lebensregungen, holte sie einen Seufzer, in dem mehr als menschlicher Schmerz sich kundzutun schien, aus tiefster Brust.
Dieser Seufzer schnitt Assad in Mark und Bein. Die Jünglingsblödigkeit, mit der er sich bisher in ehrerbietiger Entfernung hielt, verschwand, männlich fest und die Hand an seinen Dolch legend, trat er vor, verneigte sich und sprach: "Edle Fürstin, wenn Eure Erlösung die schwachen Kräfte eines Menschen nicht übersteigt, so vergönnt mir, dass ich Euch mein Blut und Leben weihen darf."
"Wie gern tue ich das", gab sie hastig zur Antwort, "aber, Ihr werdet, wie standhaft auch Euer Entschluss sei, das Werk nimmer vollbringen, nicht weil es zu schwer ist, sondern weil es zu leicht ist!" "Habe ich recht gehört?" fragte Assad mit höchster Verwunderung. "Ich begreife Eure Frage", versetzte sie, "Ihr könnt Euch nicht vorstellen, dass die Leichtigkeit meiner Entzauberung sie unmöglich macht, und dennoch ist es so.
Der boshafteste und verschmitzteste aller Zauberer hat mich, die Tochter eines mächtigen Sultans, in einen Rubin gebannt, mich im Garten überraschend, weil mein Vater ihm seine Bitte um drei Tropfen meines Blutes, deren er vielleicht zu irgendeinem schnöden Zweck bedurfte, zornig abschlug. -
Durch den jedesmaligen Besitzer des Steines kann der Zauber gebrochen werden, damit ich aber niemals wieder des schönen Lebens mich erfreuen möge, hat er die Entzauberung an ein Mittel geknüpft, auf das, weil es einem jeden an jedem Ort und zu jeder Stunde zu Gebote steht, eben darum keiner verfallen wird, und das ich, obgleich er mich, um meine Qual vollkommen zu machen, damit bekannt gemacht hat, als das teuerste Geheimnis bei mir bewahren muss, wenn ich nicht für ewig begraben sein will. Ach, wie fröstelt's mich! War's denn länger als eine Minute, dass ich die Freiheit genoss? Gib mir einen Becher Wein, schöner Jüngling, denn mich dürstet, aber schnell."
Von seltsamer Rührung über diese Bitte ergriffen, welche ihm aus dem Munde einer Sterbenden zu kommen schien, die vom Leben noch einen letzten Genuss verlangt, um das Leben dadurch noch um einen letzten Augenblick zu betrügen, reichte Assad ihr mit abgewandtem Gesicht den Wein, den seine Wirtin ihm gebracht, und den er in seiner Aufgeregtheit ungetrunken gelassen hatte. -
Freundlich dankend trank sie den Wein, gleich darauf war sie wieder von der Wolke umflossen. Mit einem glühenden Blick auf Assad, indem sie wie ein verlöschendes Licht noch einmal aufzuflammen schien, rief sie aus: "O Gott, ich möchte doch leben!" -
Dunkler wurde die Wolke und ringelte sich dichter und dichter um sie herum; Assad sah mit herzzerschneidendem Schmerz, wie die reizenden Formen sichtlich ineinander schmolzen und zerrannen; noch immer glaubte er ihr, wie in stummem Flehen auf ihn gerichtetes Auge in dem Nebelknäuel unterscheiden zu können, der sie einschlang, doch bald bemerkte er seinen Irrtum, was er für ihr Auge hielt, war nichts anderes als der Rubin, der schon wieder, matt von dem letzten Geflacker der nach Öl schmachtenden Lampe beschienen, auf dem Tisch lag.
"Ihr Leib, ihre Seele, oh!" seufzte Assad und starrte den Edelstein an, die Lampe erlosch, wie ein wirkliches Wesen drängte sich die kalte, laut- und lichtlose Nacht an seine Brust. Ein Jahr war verflossen. Es war ein schöner Morgen. Assad hatte sich aus der großen, geräuschvollen Stadt geflüchtet, still und bleich saß er auf einer Bank, die weit vor dem Tore am Ufer des großen Flusses, dem die Stadt ihr reges Leben, ihre Macht und ihren Reichtum dankte, an einem einsamen Platze stand, in seiner Hand hielt er, ihn nach seiner Gewohnheit in stummer Verzweiflung betrachtend, den Rubin.
"Das ist ein herrlicher Stein", erscholl es auf einmal hinter ihm. Er sah sich um und erblickte einen ältlichen Mann von hoher, gebietender Gestalt, mit edlen Zügen, in denen sich ein tiefer, aber ins Innerste zurück gedrängter Lebensschmerz auszudrücken schien. "Ja, ein herrlicher Stein!" wiederholte Assad düster, und verbarg mit den Gefühlen eines Eifersüchtigen den Rubin wieder auf seiner Brust.
"Junger Mann", sagte der Alte, "diesen Stein kauf' ich dir ab. Es soll Edelsteine geben, die den Menschen sanft und mild machen, andere, die ihm liebliche Träume bringen. Als ich den deinigen erblickte, beschlich mich wunderbare Wehmut und das Bild einer verlorenen Tochter ging mir, als ob sie mir neu geboren würde, in der Seele auf. Überlass mir den Stein und bestimme selbst den Preis."
Assad schüttelte, ohne aufzusehen, den Kopf und erwiderte kalt und bitter: "Und wenn du mir ein Königreich zu Füßen legtest, so würde ich den Stein nicht dafür geben. Ich lass' ihn nur mit dem Tode und auch dann nicht, denn selbst ins Grab nehme ich ihn mit hinunter." "Sklav", rief der Alte ergrimmt, "du gibst den Stein, oder ich nehme den Kopf dazu!"
Er richtete sich bei diesen Worten von der Lehne der Bank, über die er sich mit halbem Leib hingebeugt hatte, auf und warf, brennend vor Zorn, auf Assad einen durchbohrenden Blick. Assad antwortete nichts, aber er erhob sich ebenfalls und lächelte still vor sich hin, wie in verachtendem Hohn.
Der Alte, kreideweiß geworden, wandte sich um und winkte mit der Hand eine stattlich gekleidete Schar Bewaffneter heran. "Zeigt dem Hund da", rief er ihnen entgegen und deutete mit einer heftigen Bewegung auf Assad, "wie der Sultan mit denen verfährt, die ihm trotzen."
Assad zog seinen Dolch, doch sein Widerstand war fruchtlos, er sah sich alsbald von der Menge umringt und war nahe daran, überwältigt zu werden. Da fiel sein Blick auf den Sultan, der ihn scharf beobachtete, ein spöttisches Lächeln überflog sein Gesicht, er zog den Rubin hervor, nickte dem Sultan zu und warf, bevor noch jemand daran denken konnte, ihn zu hindern, den Stein weit von sich in den Fluss.
"Durchstoßt ihn!" rief der Sultan und riss, zitternd vor Wut, sein Schwert aus der Scheide. "Ich tu's selbst!" sagte Assad und zückte den Dolch gegen die eigene Brust. Da tönte auf einmal ein leises Ach, es war nur ein Laut, aber ein Laut, der in Assad das innerste Leben noch im Angesicht des Todes zur ungestümen Flamme auftrieb, er ließ den erhobenen Arm sinken und stand, wie in ein Wunder verloren, regungslos.
"Oh, Fatime, Tochter, so sehe ich dich endliche wieder?" rief der Sultan aus und tat einen Schritt vorwärts, hielt dann aber plötzlich an, als ob er fürchtete, die teure Erscheinung möchte sich in nichts auflösen, sobald er sie zu fassen versuchte. - "Allah sei gelobt!" jauchzten die erstaunten Trabanten und warfen sich, ihr Angesicht verhüllend, zu Boden.
"Vater, führe mich zu meiner Mutter!" rief die süße Stimme, die Assad in jener Mitternacht vernahm, und leidenschaftlich ängstlich umschlang die Jungfrau den alten Mann. - Schmerz und Freude vermischten sich in Assads Brust, er seufzte laut auf, da trat die Prinzessin zu ihm heran, fasste errötend seine Hand und sagte, indem sie ihn zu ihrem Vater führte: "Hier ist mein Retter!"
Der Sultan blieb eine Weile stumm und ernst, dann sprach er zu Assad: "Ich wollte dich töten!"
"Ja", erwiderte Assad, "aber noch leb' ich." "Und du sollst leben bis ans Ende deiner Tage", versetzte der Sultan mit erhöhter Stimme, "und wenn du mein Reich forderst, so will ich's dir zu Füßen legen und mir nichts ausbedingen als einen Turban, ein Schwert und ein Grab."
"Ich habe nichts zu fordern!" entgegnete Assad düster und dumpf. Dann fuhr er, sich zu der Prinzessin wendend, langsam und gemessen fort, wie einer, der über sich selbst ein Todesurteil ausspricht: "Ich hätte gern für dich den letzten Tropfen meines Blutes verspritzt, aber es ward mir nicht vergönnt, ich konnte dich nicht erlösen, ich konnte dich bloß beklagen, und das konnte jedermann.
Und heute - heute war ich sogar nichtswürdig genug, den Stein, der dein holdes Selbst umschloss, in die schlammige Tiefe hinabzuschleudern, als der Mann, der, wie ich jetzt sehe, dein Vater ist und in dem gewiss nur ahnungsvolle Sehnsucht den Wunsch nach seinem Besitz so heftig entzündete, ihn von mir verlangte. Oh! ich verachte mich selbst und du musst mich auch verachten!"
"Du tust dir unrecht", sagte Fatime, "denn dadurch, dass du den Rubin, den du bisher, wie alle früheren Besitzer, nur und starrsinnig festgehalten hattest, freiwillig und aus eigenem Antriebe von dir warfst, ward meine Erlösung vollbracht, dies war ja eben die schlimme Bedingung, die dieselbe, obgleich ein jeder sie an jedem Ort und zu jeder Zeit erfüllen konnte, ungewisser machte, wie ein Kampf mit Ungeheuern und Drachen."
"So ward ich denn glücklich, weil ich erbärmlich war", versetzte Assad. Fatime schaute ihn zugleich bittend und fragend an, denn sie verstand ihn nicht mehr, aber der Sultan trat hinzu und sagte: "Du bist von nun an mein Sohn, tritt nicht zurück, ein Mann muss sich nicht schämen, das von dem Zufall als Geschenk anzunehmen, was er, wenn's nötig wäre, dem Schicksal abtrotzen würde durch Kraft und Beharrlichkeit. Jetzt aber begleitet mich in meinen Palast, denn es ist nicht recht, dass wir uns so lange allein freuen - Fatime hat noch eine Mutter."
Friedrich Hebbel
DER BÄCKER ZU DORTMUND ...

Vor vielen, vielen Jahren hat zu Dortmund ein reicher Bäcker gelebt, der hat zwar keinen Gottesdienst versäumt und ist in der Kirche immer der Andächtigste gewesen, allein dabei blieb sein Herz doch hart wie Stein.
Er hatte durch Wucher und Korn Aufkaufen eine große Menge Geld zusammengebracht, das er in vielen großen Säcken in seinem Keller verborgen hatte. Armen hat er aber nie mehr gegeben als höchstens ein Stückchen halb verschimmeltes Brot und seine einzige Schwester, die Witwe eines armen, aber braven Leinewebers hat er samt ihren Kindern hungern und darben lassen und mit großen Worten, als sie ihn nach dem Tode ihres Mannes um eine Unterstützung bat, von seiner Türe gewiesen.
Da ist einmal eine schlimme Pest und nach ihr eine große Teuerung in ganz Westfalen entstanden, so dass die Armen das Korn nicht mehr bezahlen konnten und das ganze Land voller Bettelleute war. Bei dem Bäcker aber war keine Not. Er buck sein Brot immer kleiner und ließ es sich immer teurer bezahlen und seine Scheuern und Böden waren voll Getreide bis zum Hahneballen hinauf, aber er verkaufte es darum doch nicht, sondern hoffte, dass bis zum Winter die Kornpreise um das Doppelte steigen würden.
Da lag er einst um die Mittagszeit auf seinem Bett, um von der Morgenarbeit etwas auszuruhen, als langsam an die Türe geklopft wurde. Er rief herein und siehe, vor ihm in Lumpen gehüllt stand eine elende magere Frau und bat um eine Gabe. Es war seine Schwester, die er aber nicht erkannte, so hatte sie sich in den letzten Jahren verändert.
Da er nun glaubte, es sei ein gewöhnliches Bettelweib, so hetzte er in Wut über diese Störung seiner Mittagsruhe seinen großen Hund auf sie, der unter dem Bett lag. Die Frau aber rief ihn nun mit flehender Stimme bei seinem 'Taufnamen und bat ihn, er möge sie, die an der Pest alle ihre Kinder verloren habe, doch nicht von sich stoßen, sondern ihr eine Ruhestätte in seinem Hause gönnen und sie vor dem Hungertode schützen.
Da erwiderte der böse Bruder mürrisch: "Gut denn, ein Plätzchen in meinem Hause sollst du haben, ich weiß aber nicht, ob es nach deinem Geschmack sein wird, und Nahrung sollst du auch haben!" Damit führte er sie auf den Hof und wies auf eine große leer stehende Hundehütte, zog ein Stück Weizenbrot aus der Tasche und reichte es ihr. Die arme Verhungerte griff gierig danach und biss hinein, aber das Brot war so hart, dass die Zähne eines großen Hundes dazu gehörten, um es zu zermalmen. Nach wenigen Augenblicken gab sie es auf und stürzte vor Schwäche zu Boden.
Aber ihr harter Bruder ließ sie unbekümmert liegen und wahrscheinlich wäre sie auf dem Fleck gestorben, hätte sich nicht eine alte Magd ihrer angenommen und hätte sie durch Einflößen einiger Tropfen kräftigen Bieres wieder zu sich gebracht. Diese steckte ihr auch einige Bissen genießbaren Brotes zu und so gewann die arme Frau wieder so viel Kräfte, um zu ihrer Hütte zurück schleichen zu können. Hier sank sie auf ihr elendes Strohlager und betete zu Gott, er möge sie doch von ihren Leiden erlösen. Und Gott erhörte sie, denn sie schloss ihre Augen, um nie wieder aufzuwachen.
Am anderen Tage ist aber in der Stadt Dortmund ein gefährlicher Aufruhr ausgebrochen, der die Reichen und Begüterten in der Stadt bedrohte. Das Volk litt große Not und begann deshalb die Häuser derer zu stürmen und zu plündern, die immer noch im Überfluss schwelgten. Auch auf des reichen Bäckers Haus stürmten die Armen los, man drohte es zu plündern und ihn selbst totzuschlagen.
Der Bäcker hatte bei dem ersten Aufruhrgeschrei sogleich Türen und Fenster verrammelt, er selbst aber flüchtete sich in den festen Keller seines Hauses, wo seine Schätze lagen und der ihm einige Sicherheit gewähren konnte, da er nicht gleich zu finden war. Einen Sack kleiner Brote und einen großen Krug voll Wasser nahm er in aller Eile mit sich. Er hoffte auf diese Weise ohne Mangel zu leiden, mehrere Tage ausharren zu können, bis die Ruhe wieder hergestellt wäre.
Kaum hatte er die eiserne, mit schweren Riegeln versehene Türe hinter sich geschlossen, hörte er, wie das Volk die Türe seines Hauses sprengte, hinein strömte, sich darin zerstreute und alles zusammenschlug. Er hatte sich auf seine Geldsäcke gesetzt und wartete so von Stunde zu Stunde, bis es wieder ruhig werden wollte.
Die Angst ließ ihn den Hunger vergessen; als aber der Morgen anbrach, da verlangte die Natur ihr Recht, hungrig griff er in den Sack, worin die Brote waren, zog eins heraus und wollte hineinbeißen. Aber wehe! es war durch ein Wunder zu Stein geworden und große Blutstropfen hingen wie Schweißperlen daran.
Schaudernd warf er es von sich und ergriff ein zweites Brot, allein auch dieses war verwandelt wie das erste. Er versuchte es mit einem dritten und vierten, immer dasselbe, sie waren alle zu Stein geworden. Da ließ er den Sack fallen und nahm den Wasserkrug zur Hand, er wollte wenigstens seinen Durst löschen. Entsetzlich! das Wasser war zu Blut geworden. Da fielen ihm alle seine Sünden ein, die er sein Lebtage gegen andere Menschen begangen, er fiel auf die Knie und betete und versprach, er wolle bereuen und für die kommenden Tage ein besserer Mensch werden, ein Wohltäter und Vater der Armen sein.
Als er aber nach beendigtem Gebete wieder in den Sack griff und abermals die selben schrecklichen Wunderzeichen fand, da ergriff ihn schwere Verzweiflung, er wollte seinem Leben selbst ein Ende machen und seinen Kopf an den harten Steinwänden des Kellers zerschmettern, aber auch diese Wohltat wurde ihm nicht zu Teil. Nach dem dritten Versuch stürzte er betäubt zu Boden.
Viele Stunden lag er so; endlich erwachte er wieder. So begannen abermals Hunger und Durst ihn aufs Grimmigste zu plagen, aber den Keller wagte er nicht zu verlassen, denn im Hause hörte er das Geschrei des wütenden Pöbels, welcher sein Leben wollte. Inmitten seiner Geldsäcke gab er am Abend des anderen Tages elendiglich seinen Geist unter großen Qualen auf.
Als nach einigen Tagen die Ruhe wieder hergestellt war, wollte die Magd dem Bäcker die gute Nachricht bringen. Als sie aus seinem Versteck im Keller keine Antwort hörte, ließ sie die schwere Tür mit Gewalt aufbrechen. Man fand den Geizhals mit entstellten Zügen auf seinen Geldsäcken liegen. Das Brot aber war hart wie Stein und voll Blutstropfen, der Wasserkrug mit Blut gefüllt. Der Reichtum des geizigen Bäckers fiel, da er keine Erben hatte, an die Stadtkasse.
Deutsche Heimatsage
DER WOLF UND DIE NACHTIGALL ...
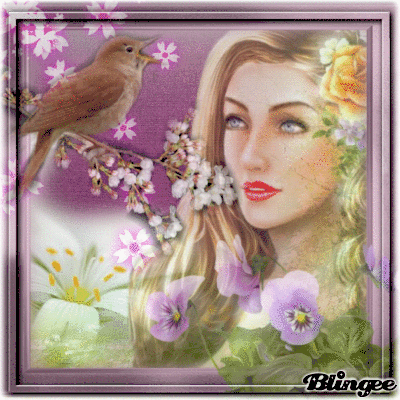
In alten Zeiten, da es alles noch ganz anders war in der Welt als jetzt, lebte ein König in Schottland, der hatte die schönste Königin in allen Landen, von einer so seltenen Schönheit und Lieblichkeit, dass sie weit und breit als die Allerschönste besungen und von Dichtern und Erzählern der schottische Vogel Phönix zugenannt ward.
Diese schöne Königin gebar dem Könige zwei Kindlein, einen Sohn und eine Tochter, und starb dann in ihrer Jugend hin. Der König trauerte viele Jahre um sie und konnte sie nie vergessen, sagte auch, er wolle nimmer wieder heiraten. Aber der Menschen Sinn ist wankelmütig und kann sich auf sich selbst nicht verlassen; denn als viele Tage vergangen und die Kinder schon groß waren, nahm er sich doch wieder eine Frau.
Diese Frau war sehr bös und eine schlimme Stiefmutter gegen die Kinder des Königs. Es waren aber der Prinz und die Prinzessin rechte Spiegel der Huld und Lieblichkeit, und der Hass der Stiefmutter gegen die Kinder kam auch daher, dass die Leute, bei welchen die verstorbene Königin in gutem Andenken stand, immer noch von dieser sprachen, sie aber verschwiegen, und dass sie, wenn sie mit der jungen Prinzessin erschien, gegen diese aufjauchzten und riefen: sie ist gut und schön, wie ihre Mutter war.
Das verdross sie, und sie ergrimmte in sich und sann auf arge Tücke, barg aber ihr böses Herz unter Freundlichkeit. Denn sie durfte es sich vor dem König nicht merken lassen, dass sie den Kindern gram war, und das Volk würde sie gesteinigt und zerrissen haben, wie sie ihnen ein Leides getan hätte.
Die Prinzessin, des Königs Tochter, welche Aurora hieß, war nun fünfzehn Jahre alt geworden und blühte wie eine Rose und war die schönste Prinzessin weit und breit. Und es zogen viele Königssöhne und Fürsten und Grafen her und buhlten um sie und begehrten sie zum Gemahl; sie aber sprach zu ihnen: mir gefällt die fröhliche und ledige Jungfrauschaft besser, als alle Freier, und damit mussten sie wieder hinreisen wo sie hergekommen waren.
Endlich aber kam der Rechte: es war ein Prinz aus Ostenland, ein gar schöner und stattlicher Herr. Diesem verlobte sie sich mit Einwilligung des Königs und ihrer Stiefmutter. Und schon war der Hochzeitkranz gewunden und die Spieler zum Tanze bestellt, und alles Land war in Freude ob der Vermählung der schönen Prinzessin Aurora. Aber die Stiefmutter dachte ganz anders in ihrem Sinn, als sie sich gebärdete, und sprach: Ich will Spielleute bestellen, die sollen zu einem anderen Tanze aufspielen, und die Füße sollen anderswohin tanzen als ins Brautbett.
Denn sie sprach bei sich: Diese verdunkelt mich ganz und wird mich noch mehr verdunkeln, und vor dieser Aurora muss meine Sonne untergehen, zumal wenn sie einen so stattlichen Mann zum Gemahl bekommt und dem Könige ihrem Vater Enkel bringt; denn ich bin unfruchtbar und kinderlos. Auch hängt das Volk ihr an und schreit ihr nach, mich aber kennen sie nicht und wollen sie nicht kennen; und doch bin ich die Königin: ja ich bin die Königin! und bald sollen sie es alle wissen, dass ich es bin und nicht Aurora.
Und sie sann nun auf viele arge Listen Tag und Nacht hin und her, wie sie die Prinzessin und ihren Bruder verderben wollte; aber es wollte ihr keine einzige gelingen: denn sie waren zu gut bewacht und behütet von den Dienern und Dienerinnen, die sie hatten. Diese sahen auf sie wie auf ihren Augapfel und wichen Tag und Nacht nicht von ihnen wegen der Liebe, die sie zu ihrer Mutter, der seligen Königin, trugen.
Als nun keine Zeit mehr übrig und der Hochzeittag schon da war und sie sich nicht mehr zu helfen wusste, gedachte sie der allerbösesten Kunst, die sie wusste, und kam zu den Kindern mit der leidigsten Freundlichkeit und bat sie, einen Augenblick mit ihr in ihren Rosengarten zu kommen, sie wolle ihnen eine wunderschöne Blume zeigen, die eben aufgebrochen sei. Und sie gingen gern mit ihr, denn der Garten war hinter dem Schlosse; auch konnte niemand an etwas Arges denken, denn es war der helle Mittag, und der König und die Prinzen und Prinzessinnen des Landes waren alle in dem großen Schlosssaal versammelt, da gleich die Vermählung geschehen sollte.
Und sie führte die Kinder in die hinterste Ecke des Gartens, wo ihre Blumen standen, unter einen dunklen Taxusbaum, als wollte sie ihnen da etwas Besonderes zeigen. Sie aber murmelte einige leise Worte für sich hin, brach dann einen Zweig von dem Baum, und gab dem Prinzen und der Prinzessin einige Streiche damit auf den Rücken. Und alsbald wurden sie in Tiere verwandelt. der Prinz sprang als ein reißender Wolf über die Mauer und lief in den Wald, und die Prinzessin flog als ein kleiner grauer Vogel, der Nachtigall heißt, auf den Baum, und sang ein trauriges Lied.
Die Königin spielte ihr Spiel so gut, dass auch kein Mensch etwas merkte. Sie lief laut schreiend dem Schlosse zu und sank mit zerrissenen Kleidern und zerzausten Haaren an den Stufen des Saales hin, als sei ihr ein großes Leid geschehen, und der König hieß sie von den Kammerfrauen wegtragen. Es verging wohl eine gute Viertelstunde, ehe sie wieder zu sich kam. Da gebärdete sie sich sehr traurig und weinte und schrie: Ach! du arme Aurora, welchen Brauttag hast du erlebt! ach du unglücklicher Prinz!
So schrie sie einmal über das andere, und erzählte dann, ein Schwarm Räuber sei plötzlich hinten in den Garten gedrungen und habe die beiden Königskinder mit Gewalt von ihrer Seite gerissen und entführt; sie aber haben sie zu Boden geschlagen und halbtot liegen lassen; und sie zeigte eine Beule an der Stirn, die sie sich absichtlich an einem Baum gestoßen hatte. Und alle glaubten ihren Worten, und der König hieß alle seine Herren und Grafen und Ritter und Knappen aufsitzen und den Räubern nachjagen.
Diese durchritten nach allen Seiten den Wald und alle Schluchten und Klippen und Berge rings um das Schloss wohl zwei drei Meilen weit, aber von den Räubern und von dem Prinzen und von der Prinzessin fanden sie auch nicht die geringste Spur. Und der König ruhte nicht und ließ weiter suchen und forschen viele Wochen und Monate, und sandte Boten und Kundschafter aus in alle Länder; aber sie kamen immer vergebens zurück, und mit dem Prinzen und der Prinzessin war es, als ob sie nie gelebt hätten: so ganz waren sie verschollen.
Der alte König aber glaubte, die Räuber hätten sie wegen der kostbaren Juwelen und Edelsteine entführt, die sie am Hochzeitstage trugen, und hätten sie beraubt und dann tot geschlagen und irgendwo eingescharrt, damit man ihnen nie auf die Spur kommen könnte; und er grämte sich so sehr, dass er bald starb. Bei seinem Sterben übergab er, weil er keine Kinder hatte, der Königin das Reich, und bat seine Untertanen, dass sie ihr treu und gehorsam sein mochten, wie sie ihm gewesen waren. Sie taten es auch und erkannten sie als ihre Königin, mehr aus Liebe zu ihm als aus Liebe zu ihr.
So waren vier Jahre verschieden und der König schon das andere Jahr tot, und die Königin fing an mit großer Gewalt über die Länder zu herrschen, und kaufte sich für die Schätze, die der alte König ihr hinterlassen hatte, viele fremde Soldaten, die sie über das Meer kommen ließ und die ihre Krone und ihr Schloss bewachten. Denn sie wusste, dass sie von den Untertanen nicht geliebt war, und sprach: Nun mögen sie aus Furcht tun, was sie aus Liebe nicht tun würden.
So geschah es, dass sie von Tage zu Tage bei jedermann mehr verhasst ward, aber keiner durfte es sich merken lassen, denn auf das leiseste Geflüster gegen die Königin war der Tod gesetzt. Aber die Leute lassen das Wispern und Flüstern darum doch nicht, und weil das Sprichwort wahr ist: Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt endlich an die Sonnen, so hatte es von Anfang an gemunkelt, als die Königskinder verschwunden waren: kein Mensch könne wissen, was der Spaziergang der Königin bedeutet habe. Denn es waren Leute genug, die ihr wegen ihrer scharfen Augen und ihrer unnatürlichen Freundlichkeit böse Künste zutrauten.
Diese Munkelung unter dem Volke dauerte nun immer fort und nahm noch zu; sie aber kümmerte sich darum nicht, und dachte: die werden schon Tiere bleiben, was sie sind, und mir wird keiner die Königskrone nehmen. Aber es begab sich alles ganz anders, als sie gedacht hatte.
Den armen Königskindern ging es indessen doch recht schlecht. Der Prinz war als ein brauner Wolf in den Wald gelaufen, und er musste sich gebärden wie ein Wolf und heulen wie ein Wolf und durch die öden und wüsten Orte laufen bei Tage und bei Nacht, und wie ein Dieb einhergehen; denn auch die wölfische Furcht war in ihn gefahren. Und er musste sich nähren wie die anderen Wölfe von allerlei Raub von Wild und Vögeln, auch musste er in der traurigen Winterzeit zuweilen wohl mit einem Mäuschen vorlieb nehmen und den Bauch einziehen und Zähneklappern und zwischen den harten und kalten Steinen sein Lager nehmen.
Und dies war gewiss keine prinzliche Lebensart, wie er sie vorher geführt hatte, ehe er aus der königlichen Pracht und Herrlichkeit in dieses wilde Elend verstoßen war. Das war aber das Besondere an ihm, dass er allein Tiere angriff und zerriss und nie nach Menschenblut gelüstete. Doch nach einer hätte ihn wohl gelüstet, nach der bösen Frau, die ihn verwandelt hatte; aber diese hütete sich wohl, dahin zu kommen, wo sie den Zähnen dieses Wolfes begegnen konnte.
Man soll aber nicht glauben, dass der Prinz, der nun ein Wolf war, noch menschliche Vernunft hatte; nein es war sehr finster in ihm geworden, und mit dem Bilde des Tieres, in welchem er durch die Wälder laufen musste, hatte er auch nicht viel mehr als tierischen Verstand. Das ist wahr, ein dunkler Trieb trieb ihn oft gegen das Schloss und den Schlossgarten hin, als hätte er dort einen Fang zu holen; doch hatte er keine deutliche Erinnerung der Vergangenheit: wie hätte er es dann auch in der Wolfshaut aushalten sollen?
In den Augenblicken, wo er diesen Trieb fühlte, war er mit einem besondern Grimm behaftet; aber immer, wie er ihnen auf tausend Schritt nahe kam, fuhr ein kalter Schauder in ihn und jagte ihn zurück. Und die Königin hatte dies mit ihrer Hexerei verschuldet, dass sie ihn bis so weit gebannt hatte; denn weiter hatte sie nicht gedurft. Sie aber stellte dem Wolfsprinzen nach dem Leben und ließ viel jagen in dem Forst, der sich um das Schloss herum zog, weil sie dachte, dass er wohl darin sein mochte.
Deswegen ward fast alle Woche zweimal eine große Schalljagd und Klapperjagd auf Wölfe und Füchse angestellt; und damit sie einen fleißigeren Vorwand dazu hätte, hatte die Königin viele niedliche Dammhirsche in diesen Forst ausgesetzt, von welchen unser königlicher Wolf allerdings manchen verzehrte. Aber er rettete sich immer aus aller Gefahr, wie oft die Hunde ihm mit ihren Rachen auch das Haar auf dem Rücken schon zerbliesen und wie oft die Jäger auf ihn schossen.
Er wich dann für den Augenblick abseits, und wenn der Schall sich gesänftet hatte und die Jagdhörner verstummt waren, kam er in das Dickicht zurück, welches dem Schlosse nahe war, und sonnte sich häufig auf Plätzen, wo er als Knabe und Jüngling zuweilen gespielt hatte. Er wusste aber nichts mehr von der Vergangenheit, sondern es war eine verborgene Liebe, die ihn dahin lockte.
Die Prinzessin Aurora hatte als ein kleines Vögelein auf den Baum fliegen müssen und war in eine Nachtigall verwandelt worden. Ihr aber war in ihrem leichten und dünnen Federkleide die Seele nicht so verdunkelt, als dem Prinzen in der Wolfshaut, sondern sie wusste viel mehr von sich und von den Menschen und Dingen; nur sprechen konnte sie nicht. Dafür aber sang sie desto schöner in ihrer Einsamkeit, und oft so wunderschön, dass die Tiere vor Freuden hüpften und sprangen und die Vögel sich alle um sie versammelten und die Bäume dazu rauschten und die Blumen nickten.
Ich glaube, auch die Steine hätten vor Lust getanzt, wenn sie so viel Liebe in sich hätten; aber deren Herz ist zu kalt. Auch die Menschen hätten wohl bald auf den kleinen Vogel gemerkt als auf einen besonderen Vogel und wäre wohl ein Gerede und Gemunkel davon unter den Leuten entstanden, wenn nicht etwas sie abgehalten hätte von dem Walde, dass sie die Nachtigall nie singen hörten. Es verhielt sich damit folgendergestalt:
Wie die Königin dem armen verwandelten Prinzen mit den vielen Schall- und Klapperjagden gern das letzte wölfische Lebenslicht ausgeblasen hätte und wie er dadurch über die ganze Wolfsfamilie großes Unglück brachte, habe ich schon erzählt. Aber auch über die kleinen Vögel ging es schlimm her, und in diesen Tagen der Tyrannei war es ein Unglück, in der Gegend des Schlosses als Amsel, Grasmücke und Nachtigall geboren zu sein.
Die Königin nämlich, nachdem der alte Herr gestorben war und sie die Gewalt allein hatte, gebärdete sich plötzlich, als habe die Krankheit sie befallen, dass sie nicht allein das Geschrei und Gekrächze und Geschnatter unleidlicher Vögel nicht ertragen könne, sondern dass selbst das lieblichste Geklingel und Gezwitscher der lustigen kleinen Singvögelein sie unangenehm bewege.
Und damit sie das allen Menschen glaublich machte, war sie bei solchen Gesängen, deren sich sonst alle Welt zu freuen pflegt, ein paar Mal in Ohnmacht gefallen. Das war aber nur ein Schein, sie wollte eine böse Tat, sie wollte den Tod der kleinen Nachtigall, wenn sie etwa in diesen Hainen und Gärten herumflatterte. Das wusste sie aber wohl, dass das Vögelchen dem Schlosse auf tausend Schritt nicht nahen durfte, denn sie hatte es unter den selben Hexenbann gelegt, als seinen Bruder.
Unter dem Titel dieser Unleidlichkeit und Empfindlichkeit gegen zarte und feine Klänge und Schalle ward denn freilich nicht bloß der kleinen liebenswürdigen Nachtigallprinzessin sondern allen anderen Vögeln nach der Kehle gegriffen; sie waren alle in die Acht und Aberacht getan, sie waren alle für vogelfrei erklärt, und die Förster und Jäger der Königin erhielten den strengsten und gemessensten Befehl, auf alles, was Federn trägt, Jagd zu machen, und auch das Rotkehlchen ja nicht einmal den Zaunkönig zu verschonen, auf welchen ein guter Jäger sonst nie einen Schuss verliert.
Dieser schreckliche Zorn der Königin ward ein Unglück für das ganze befiederte Volk, nicht bloß für die, welche im Freien flogen oder in Forsten und Hainen lebten, sondern auch für die, welche auf Höfen und in Zimmern gehalten werden. In der Hauptstadt und in der Umgegend des königlichen Schlosses blieb auch nichts Gefiedertes leben; denn die Leute meinten sich bei der Königin sehr einzuschmeicheln und ihre Gunst zu gewinnen, wenn sie es ihr nachmachten.
Es war ein Schlachten und Morden der Unschuldigen wie der bethlehemitische Kindermord des Königs Herodes weiland. Wie vielen tausend Kanarienvögeln und Zeisigen und Nachtigallen und Distelfinken, ja selbst wie manchen ostindischen und westindischen Papageien und Kakadus wurden da die Hälse umgedreht! Schreihälsen und Liederkehlen, Schwätzern und Verschwiegenen drohte ein Schicksal, und das sogar war ein Verbrechen, als Gans oder Puter oder Hahn geboren zu sein, und die gemeinen Haushühner fingen an so selten zu werden als chinesische Goldfasane.
Und hätte die Königin noch einige Jahrzehnte so gewütet gegen das Federvölkchen, so wäre es allmählich ausgestorben in dem Königreiche. Das war die Ursache, warum die Vögel nicht allein gemordet wurden sondern auch fast kein Mensch mehr in den Wald spazieren ging, weil es so hätte gedeutet werden können, als wollten sie da Vogelgesang hören. So kam es denn, dass niemand die Wundertöne der kleinen Nachtigall belauschen konnte, als etwa hie und da ein einsamer Jäger.
Der ließ sich aber nichts merken, damit er von der Königin nicht gestraft würde, dass er den Vogel nicht geschossen. Denn das muss man zur Ehre der Weidmänner sagen, dass sie doch meistens ihrer wackeren Natur folgten und selten einen der kleinen Vögel schossen; aber platzen durch den Wald mussten sie, dass es knallte. Und dadurch schon ward es still von Gesängen und auch viele Vöglein zogen weg aus dem unaufhörlichen Getümmel und kamen nimmer wieder.
Die kleine Nachtigall aber, welche Gott behütete, dass sie sich von allen diesen Nachstellungen rettete, konnte den grünen Wald hinter dem Schlosse nicht lassen, wo sie in ihrer Kindheit so viel gespielt und gesprungen hatte, sondern wenn sie auch weg flog, so bald die Jagdhörner anbliesen und es mit Hurra und Wo Wo durch die Büsche toste, kam sie doch immer bald wieder.
Und obgleich ihre Liedlein, als aus einem traurigen Herzen klingend, meistens traurig und kläglich waren, deuchte es ihr doch recht anmutig, so unter den grünen Bäumen und bunten Blumen zu leben und dem Mond und den Sternen etwas Süßes vorzuklingen; und nur wenige Monate war sie unglücklich. Dies war die Zeit, wo der Herbst kam und wo sie mit den anderen Nachtigallen in fremde Länder ziehen musste, bis es wieder Frühling ward.
Das kleine Prinzessinvögelein hielt sich nun meist zu den Bäumen, Angern und Auen, wo sie als Kind gespielt oder als Jungfrau mit Gespielen ihres Alters Kränze gewunden und Reigen aufgeführt hatte, oder wo sie gar in den glücklichsten Tagen ihres Lebens mit dem Geliebten die Einsamkeit gesucht hatte. Am liebsten und am meisten wohnte sie in einer dichten grünen Eiche, die sich über einen rieselnden Bach beugte und oft das süße Geflüster der Liebe in ihren Schatten geborgen hatte.
An dieser Stelle sah sie denn auch oft den Wolf, den ein dunkles Gefühl der Vergangenheit dahin führte; aber sie wusste nicht, dass es ihr armer Bruder war. Doch gewann sie ihn lieb, weil er sich so oft unter ihren Gesängen hinstreckte und lauschte, als verstände er etwas davon; und sie beklagte ihn wohl zuweilen, dass er ein zorniger und harter Wolf sein musste und nicht flattern konnte und fliegen von Zweigen zu Zweigen, wie sie und andere Vögelein.
Und nun muss ich auch noch von einem Manne erzählen, der in dem einsamen Walde zuweilen der Zuhörer der kleinen Nachtigall war. Dieser Mann war der Prinz aus Ostenland, ihr Bräutigam, als sie noch Prinzessin war. Der König, dieweil er noch lebte, hatte diesen Prinzen wegen seiner Tugend und Tapferkeit vor allen Männern geliebt und ihn auf seinem Totenbette der Königin empfohlen als einen Rat und Helfer in allen schlimmen und gefährlichen Dingen, besonders als einen frommen und trefflichen Kriegsmann.
Auch war er nach des Königs Tode bei der Königin geblieben bloß aus Liebe zu dem seligen Herrn. Doch ward er bald inne, dass die Königin ihn hasste, ja dass sie ihm nach dem Leben trachtete, und entwich daher plötzlich von ihrem Hofe und aus ihrem Lande. Sie aber ließ ihm nachsetzen als einem Verräter und Flüchtling und ließ einen Bann ausgehen, wodurch sie ihn für vogelfrei erklärte, dass jeder, wem es beliebte, ihn erschlagen und ihr seinen Kopf bringen mochte, worauf sie einen hohen Preis gesetzt hatte.
Er entwich wieder in das Land seines Vaters, das viele hundert Meilen gegen Osten von dem Schlosse der Königin lag, und wohnte bei ihm. Aber im Herzen hatte er keine Ruhe noch Rast und die Trauer um die verschwundene Prinzessin wollte ihn nie verlassen. Ja das Wunder begab sich mit ihm, dass er alle Jahre einmal heimlich verschwand, ohne dass ein Mensch wusste, wohin.
Er sattelte aber dann sein Ross und rüstete sich in unscheinbarer Rüstung, und ritt plötzlich davon, so dass niemand seinen Pfad kannte. Er musste aber in das Land der Königin reiten, die ihn vogelfrei gemacht hatte, und jenen Wald besuchen, worin die Prinzessin verschwunden war. Dieser gewaltige Trieb kam ihm jedes Jahr kurz vor der Zeit, in welcher die Prinzessin verschwunden war, wo er durch wilde wüste und verborgene Orte traben musste, bis er zu wohlbekannten Stätten gelangte, wo er einst mit seiner Braut gewandelt hatte.
Und da war auch ihm die grüne dunkle Eiche am Bache die Lieblingsstelle. Da brachte er dann vierzehn Nächte in Tränen und Gebeten und Klagen um die Geliebte zu; die Tage aber verbarg er sich in dem entlegeneren Dickicht. Da hat er die kleine Nachtigall oft gesehen und gehört und sich ihres wundersamen und wunderlieblichen und fast übervögelischen Gesanges erquickt. Sie haben aber nichts weiter von einander gewusst.
Doch hatte das Vögelchen immer eine große Sehnsucht im Herzen, wenn der Ritter wieder geritten war, sie wusste aber nicht warum; und auch ihm klang ihr tiefes und schmachtendes Tiu! Tiut! lange nach, wann er wieder in das Land seines Vaters ritt. Es ging ihm aber wie den meisten Menschen, die etwas Geheimes tun oder haben, worüber andere Leute sich viel die Köpfe zerbrechen, dass er um sein eigenes Geheimnis nicht wusste. Denn dass er jedes Jahr einmal heimlich weg ritt, das wusste er wohl; warum er aber reiten musste, das wusste er nicht.
Und es waren manche Tage vergangen seit dem Tode des alten Königs und es ging in das sechste Jahr seit dem Verschwinden der Kinder, und die Königin lebte herrlich und in Freuden, und ließ die Tiere jagen und auf alle Vögel schießen, und war auch gegen ihre Untertanen nicht weniger hart, als gegen das Wild und Gefieder des Waldes.
Sie deuchte sich fast allmächtig und meinte, ihr Glück und ihre Herrschaft könne kein Ende nehmen. Doch hatte sie seit jenem Tage den Wald nicht betreten um das Schloss und den Schlossgarten, sondern eine heimliche Furcht hatte sie davon zurückgehalten. Sie ließ sich aber nicht merken, was es war, und dass eine Hexenangst dahinter steckte.
Nun begab es sich, dass sie einmal ein großes Fest und Gastmahl angestellt hatte, wozu alle Fürsten und Fürstinnen des Reichs und alle Großen des Landes und alle vornehmsten Diener und Dienerinnen geladen waren, und es war den Nachmittag eine große Wolfsjagd beschlossen in dem Forst, und die Fürsten baten sie, dass sie mitgehen möchte. Sie weigerte sich lange unter allerlei Vorwänden, endlich aber ließ sie sich bereden.
Sie setzte sich aber auf einen hohen Wagen und hieß drei ihrer tapfersten Kriegsmänner sich wohl bewaffnet neben sich setzen; zugleich hieß sie viele hundert gewaffnete und gerüstete Reisige vor, neben und hinter dem Wagen reiten, und eine lange Reihe Wagen voll Herren und Frauen folgten ihr nach. Und ihr war der Wolf immer im Herzen, doch dachte sie bei sich: lass den Wolf nur kommen, ja lass hundert Wölfe zugleich kommen, diese tapfere Schar wird ihnen wohl das Garaus machen.
So verblendet Gott auch die Klügsten und Feinsten, wann sie zur Strafe reif sind; denn ihr war geweissagt worden von anderen Meistern ihrer losen Kunst, sie solle sich vor dem sechsten Jahre in Acht nehmen. Daran hatte sie heute nicht gedacht.
Und es war ein schöner heiterer Frühlingstag, und sie fuhren mit Trompeten und Posaunen in den Forst, und die Rosse wieherten und die Rüstungen klirrten und die gezückten Speere und Degen funkelten in der Sonne; die Königin aber funkelte am hellsten, mit ihren prächtigsten Kleidern und all ihrem Juwelenschmuck hoch im Wagen thronend. Und schon schallte ihnen die Jagd entgegen mit Hussa und Hurra und den schmetternden Hörnern der Jäger und den gellenden Stimmen der Hunde.
Und es lief ein Löwe vorüber und ein Eber fuhr durch die Reihen; und sie erschraken nicht sondern hielten und standen ein jeglicher fest auf seinem Stand, und machten die Ungeheuer nieder. Aber nicht lange, und es ergab sich ein Schrecken, das ihnen zu mächtig war. Ein fürchterlicher Wolf fuhr aus dem Dickicht hervor auf einen grünen Anger, und heulte so grässlich, dass Jäger, Hunde und Reiter vor ihm ausrissen.
Der Wolf lief, wie man einen Pfeil vom Bogen schießt, nein er lief nicht sondern flog durch die Männer und Rosse dahin, und keiner dachte daran, dass er Bogen, Spieß und Eisen trug, so schrecklich war des Untiers Ansehen und so wütig bleckte er den funkelnden Rachen auf. Die Königin, die ihn auf ihren Wagen zuspringen sah, schrie Hilfe! Hilfe! die Weiber schrien und fielen in Ohnmacht, viele Männer schrien auch wie die Memmen: Keiner wehrte dem Wolf, er sprang mit Einem langen weiten Sprung auf den hohen Wagen, riss das stolze Weib herunter, und wusch sich Zähne und Rachen in ihrem Blute.
Die anderen waren alle geflohen oder standen und hielten von ferne. Und o Wunder! als sie sich ermannen wollten und das Tier anfallen, sahen sie es nicht mehr, sondern, wo es eben noch gestanden hatte, erhob sich die Gestalt eines schönen und riesigen Jünglings. Die Männer staunten ob dem Zauber, doch zuckten einige die Waffen, als wenn sie ihn als ein zweites Ungetüm jagen und fällen wollten.
Da sprang plötzlich ein Greis vor, der mit im Zuge war, der Kanzler des Reichs, und verbot es ihnen, und rief überlaut: bei meinem grauen Haar, Männer, haltet ein! ihr wisst nicht, auf wen ihr stoßen wollt - und, ehe sie sich besinnen konnten, lag er schon vor dem Jünglinge auf der Erde, und küsste ihm Knie und Hände und rief: Sei uns gegrüßt, du edle Blume eines edlen Vaters, die du wieder aufgegangen bist in deiner Schönheit! und freue dich, o Volk, dein rechter Königssohn ist wieder gekommen, und dies ist jetzt dein König.
Und auf diese Worte liefen viele herzu und erkannten den Prinzen wieder und huldigten ihm als ihrem Herrn, und die übrigen taten desgleichen. Und alle waren zugleich voll Schrecken und Staunen und Freude, und dachten nicht mehr an die zerrissene Königin noch an den Wolf; denn dass er der Wolf gewesen, das wussten sie nicht.
Der junge König aber gebot allen, dass sie ihm nachfolgten und mit ihm in das Schloss seines Vaters zögen; er hieß auch sogleich die Jagd stillen und die Hörner und Trompeten, welche eben noch den Wald und das Wild aufgeschreckt hatten, seinem fröhlichen Einzuge voranblasen. Und als er daheim war und von den Zinnen seiner Väter schaute, da traten ihm die Tränen in die Augen und er weinte beides schmerzlich und fröhlich; denn er gedachte nun alles Jammers wieder und der zu schweren Vergangenheit, wo es wie ein dumpfer und tierischer Traum auf ihm gelegen hatte.
Und nun ward es ihm plötzlich hell, und er konnte es dem Kanzler und den Vornehmsten melden, wie es mit ihm geschehen war und dass er nur durch das Herzblut der alten gräulichen Hexe, die seine Stiefmutter und ihre Königin geheißen, wieder hatte verwandelt werden können. Und das Gerücht von diesem erstaunlichen Wunder ging alsbald in die ganze Stadt und unter alles Volk aus; und sie freuten sich, dass der geliebte Königssohn wiedergekommen und dass die Königin, welche alle hassten, von Wolfszähnen, die sie selbst geschaffen, zerrissen war.
Aber als der Prinz sich nun allmählich wieder gefunden und über sich besonnen hatte, da fiel es ihm schwer auf das Herz, wo die königliche Prinzessin Aurora seine geliebte Schwester wohl sein möchte und ob sie auch noch wohl unter irgendeiner Tierhaut oder Federdecke steckte; denn nun fiel ihm ihr trauriger Hochzeittag ein. Und er fragte und ließ fragen; aber alle schwiegen und keiner konnte von ihr etwas melden. Da ward der Prinz wieder sehr traurig und sorglich, aber Gott wandelte diese Traurigkeit auch bald in Freude.
Denn als dieser Jagd- und Wolfslärm im Walde toste, steckte auch der arme trauernde Prinz aus Ostenland grade in seinem Dickicht, und das kleine liebliche Nachtigallvögelchen hielt sich schweigend unter den grünen Blättern seiner Eiche verborgen. Es fuhr aber ein wunderbares Gefühl durch sein Herzchen, sobald der durstige Wolfszahn seines Bruders das Herzblut der alten Königin geschlürft hatte.
Als nun die Jagd verschollen und der Wald still geworden und die Sonne niedergegangen war, da kam der Prinz aus seiner dunkeln Waldschlucht unter seine grüne Eiche und lehnte sich gar traurig an den Stamm und netzte das Gras mit seinen stummen Tränen, wie er alle Nächte pflag; und ihm deuchte viel wehmütiger um sein Herz zu sein als gewöhnlich.
Das Vögelein in den Zweigen über ihm fing eben an zu singen nach seiner Gewohnheit; und es deuchte ihm auch, dass es gar anders sang als sonst, und viel bedeutsamer und rätselhafter und fast wie mit menschlicher Stimme. Und dem Manne kam ein Grausen an, und fast voll Angst rief er in die Zweige hinauf: Vögelein, Vögelein, sage mir, kannst du sprechen? Und das Nachtigallvögelein antwortete ihm mit Ja, wie Menschen zu antworten pflegen, und es verwunderte sich selbst, dass es sprechen konnte, und fing an vor Freuden darüber zu weinen, und schwieg lange.
Darauf tat es sein Schnäbelchen wieder auf und erzählte dem Manne mit vernehmlicher menschlicher Stimme die ganze Geschichte von seiner Verwandlung und von seines Bruders Verwandlung, und durch welches Wunder er wieder ein Mensch geworden. Denn es war ihr nun alles in Einem Augenblicke klar geworden, als hätte ein Geist es ihr zugeflüstert.
Der Mann aber jauchzte in seiner Seele, als er ihre Rede hörte, und er sann viel in sich hin und her; und das Vögelchen spielte und flog zutraulich um ihn herum; doch wiewohl sie sich und alle Dinge so hell wieder erkannte und wusste, von ihm wusste sie nicht, wer er war. Und er lockte das Vögelchen und schmeichelte und koste ihm schön, und bat, es solle mit ihm kommen, er wolle es in einen Garten setzen, wo ein ewiger Frühling blühe und nie ein Falke rausche noch ein Jäger tose; das sei doch viel lustiger, als so in wilden Hainen umzufliegen und vor dem Winter und vor Jägern und Raubvögeln und Schlingen zu zittern.
Das Vögelein aber wollte davon nichts hören und lobte seine grüne Freiheit und seine grüne Eiche hier und schwätzte und flötete und spielte und flatterte um den Mann herum und hatte sein wenig Acht, denn er gebärdete sich, als sei er in anderen Gedanken.
Aber siehe, welche Gedanken er gehabt hat! Denn ehe das Vögelchen sich dessen versah, hatte der Mann es bei den Füßchen erfasst und lief eilends davon, schwang sich auf sein Ross und flog im sausenden Galopp, als sei ein Sturmwind hinter ihm, einer Herberge zu, die er in der Stadt unweit des Schlosses kannte, und bestellte sich ein einsames Zimmer, worin er sich mit dem Vögelein einsperrte.
Das Vögelein, als es sah, wie er die Schlüssel herauszog und andere Zeichen eines Gefängnisses machte, fing an jämmerlich zu weinen und zu flehen, dass er es fliegen ließe; denn es deuchte ihm gar beklommen und angstvoll in dem verschlossenen Zimmer und es musste an seine grünen Bäume und an die liebliche Freiheit denken. Aber der Mann machte sich aus dem Weinen und Flehen des Vögelchens nichts und wollte es nicht lassen.
Da ward das Vögelein böse und fing an sich zu verwandeln, damit es den Mann erschreckte, dass er Türen und Fenster öffnete und froh wäre, wenn das Vögelein davon flöge. So machte es sich zu Tigern und Löwen, zu Ottern und Schlangen, zu Skorpionen und Taranteln, zuletzt zu einem scheußlichen Lindwurm, der sich um den Mann flocht und mit giftiger Zunge auf ihn fuhr. Aber das alles schreckte ihn nicht sondern er blieb fest auf seinem Sinn, und das Vögelein musste alle seine Arbeit verlieren und wieder ein Vögelein werden.
Und der Mann stand in tiefen Gedanken, denn es fiel ihm etwas ein aus alten Märchen. Und er zog ein Messer aus der Tasche und schnitt sich ein Loch in den kleinen Finger der linken Hand, der immer das lebendigste Herzblut hat. Und es tröpfelte Blut heraus, und er nahm das Blut und bestrich des Vögeleins Köpfchen und Leib damit. Und kaum hatte er das getan, so stand auch das Wunder fertig da.
Das Vögelein ward in der Minute zu der allerschönsten Jungfrau, und der Prinz lag alsbald zu ihren Füßen und küsste ihr züchtig und ehrerbietig die Hände. Die Nachtigall war nun wieder Prinzessin Aurora geworden und erkannte in dem Manne ihren Bräutigam wieder, den Prinzen aus Ostenland. Sie war noch eben so jung und schön, als sie vor sechs Jahren zur Zeit der Verwandlung gewesen. Denn das ist den Verwandlungen eigen, dass die Jahre, die einer darin bleibt, ihn nicht älter machen sondern tausend Jahre gelten da nicht mehr als eine Sekunde.
Man kann denken, wie diese beiden sich gefreut haben; denn wenn zwei verliebte Herzen, die einander treu geblieben, nach langer Zeit wieder zusammenkommen, das ist wohl die größte Freude auf Erden. Doch säumten sie nicht lange sondern ließen dem Könige ansagen, es seien zwei fremde Prinzen aus fernen Landen an seinen Hof gekommen und begehrten fürstliche Herberge.
Und der König trat heraus, dass er sie bewillkommnte, und erkannte seine liebe Schwester Aurora und seinen teuren Freund den Prinzen aus Ostenland, und freute sich über die Maßen; und alles Volk freute sich mit ihm, dass so alles wiedergekommen und das Reich nicht bei Fremden bleibe.
Und nach wenigen Tagen setzte er sich die königliche Krone auf und fing an zu regieren an seines Vaters Statt, seiner Schwester aber gab er eine überaus prächtige Hochzeit mit Tänzen und Festen und Ritterspielen; auch erhielt sie nebst ihrem Prinzen an Land und Leuten eine gar stattliche Abfindung, wovon sie fast wie Könige leben mochten.
Die Prinzessin Aurora aber hatte ihren Bruder um den Wald gebeten, in welchem sie als Vögelein so manchen fröhlichen und auch so manchen traurigen Tag umhergezogen war, und er hatte ihn ihr gern geschenkt. Sie baute sich da selbst ein stolzes königliches Schloss an dem Bache, wo sie so oft gesessen und gesungen hatte, und die grüne und dichte Eiche kam mitten in ihrem Schlossgarten zu stehen und hat noch manches Jahr nach ihr gegrünt, so dass ihre Urenkel noch darunter gespielt und sich beschattet haben.
Sie aber ließ das Gebot ausgehen, es solle der Wald für ewige Zeiten stehen bleiben in seiner natürlichen Herrlichkeit; auch gab sie den kleinen Singvögelein den Frieden und verbot auf das allerstrengste, in diesem heiligen Bezirke Schlingen und Fallen zu stellen und die Kleinen mit irgend einem Gewehr anzugreifen.
Und ihr Bruder hat als ein großer und frommer König regiert, sie aber hat mit ihrem tapferen Gemahl bis in ein schneeweißes Alter in glücklicher Liebe gelebt und viele Kinder und Kindeskinder gesehen, bis sie endlich im Segen Gottes und der Menschen sanft entschlafen ist. Das hat auch gegolten seit ihrer Zeit unter ihren Kindern und Nachkommen, dass der älteste Prinz ihres Hauses immer Rossignol und die älteste Prinzessin immer Philomela getauft wurde.
Sie wollte nämlich eine fromme Erinnerung stiften für alle Zeiten von dem wundersamen Unglück, das ihr widerfahren war, da sie in eine Nachtigall verwandelt worden. Denn diese Worte bedeuten in der Sprache ihres Landes, was zu Deutsch Nachtigall genannt wird, und Rossignol heißt eigentlich Rosenvogel - denn die Nachtigallen singen meist zur Zeit der Rosen - und Philomela Liederfreundin; der deutsche Name Nachtigall heißt aber so viel als Nachtsängerin, und ist wohl der allerfeinste.
Ernst Moritz Arndt
DES TOTENGRÄBERS SOHN ...
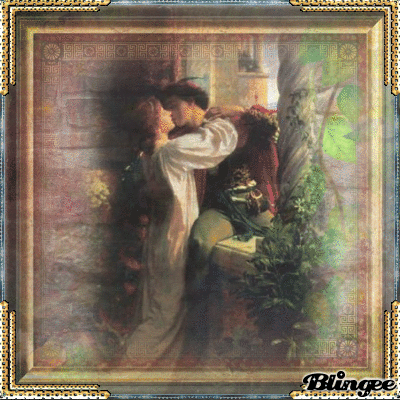
Es war einmal ein armer Kulengräber (Totengräber), der hatte einen einzigen Sohn mit Namen Fritz, und ist da auch ein reicher Bürgermeister gewesen, der hatte eine einzige Tochter, die hieß Karoline. Weil nun die beiden Kinder zusammen in die Schule gingen und täglich beieinander waren, auch gleiches Alter hatten, so wurden sie sich von Herzen gut.
Die Jahre kamen und vergingen, die Kinder wurden groß, aber ihre Liebe blieb die selbe. Das war aber dem Vater des Mädchens gar nicht recht, dass sie sich zu so einem armen Jungen hielt, dessen Vater nur ein Totengräber war. Er machte dem Fritz das Leben sauer, wie und wo er nur konnte, und verbot seiner Tochter zuletzt auf das strengste, mit ihm zu verkehren und zu sprechen, so dass die zwei sich nur zuweilen heimlich sehen konnten.
Da dachte der Fritz endlich: "Ich will nun in die weite Welt gehen, ob ich nicht da mein Glück machen und Geld erwerben kann; so geht es doch nie und nimmer gut." Und als er nun zum letzten Mal zu seiner Karoline ging, ihr Lebewohl zu sagen, fing sie bitterlich zu weinen an und gab ihm einen Ring und sagte, dass er sie doch nicht vergessen möchte, wenn er nun so weit in der Fremde wäre.
"Nie und nimmer will ich dich vergessen", hat er da gesagt; "ich gehe nun nach Spanien, das ist ein weiter, weiter Weg; darum versprich mir, dass du mir sieben Jahre lang treu bleiben willst; bin ich dann nicht zurück, so bin ich tot und komme niemals wieder." Das haben sich die zwei fest versprochen und haben mit Weinen von einander Abschied genommen; der Fritz ist dann fort gewandert auf dem Wege, der nach Spanien geht.
Gegen Abend kam er zu einem Schlosse, drinnen wohnte ein alter Ritter mit seiner Frau, die nahmen ihn freundlich auf und gaben ihm Herberge. Er erzählte ihnen, als sie zu Tische saßen, wie es ihm so traurig ergangen sei, und dass er nun hinwollte nach Spanien, ob er da nicht sein Glück machen könne. Weil er nun so offen und treuherzig war, gewannen ihn der Ritter und seine Frau lieb, und da sie keine Kinder hatten, so behielten sie ihn bei sich als ihren Sohn, gaben ihm gute Kleider und ließen ihn in allem unterrichten was einem Rittersmann zukommt.
Über eine Zeit, so ging die Kunde, der König von Spanien, der schon alt und des Regierens müde sei, hätte eine Krone ausgehängt, wer die in vollem Jagen herunter stäche, der sollte Vizekönig von Spanien sein und des Königs Tochter zur Frau haben. Da bat Fritz seine Pflegeeltern, dass sie ihn möchten nach Spanien an des Königs Hof ziehen lassen, denn das Kronenstechen hätte er doch gar zu gerne mitgemacht.
"Wer weiß, ob es dir nicht glückt", dachte er und bat so lange, bis ihm der Ritter ein Pferd gab und ihn ziehen ließ. So ritt er denn fort auf dem Wege, der nach Spanien geht, und als er dort ankam, da hatten sich schon alle Ritter im Stechen versucht, aber keiner hatte die Krone erlangen können. So war er der letzte an der Reihe, und richtig! es gelang ihm, die Krone herunterzustechen.
Da wurde er zum Vizekönig von Spanien gemacht und sollte des Königs Tochter haben. Es waren aber zu der Zeit gerade die sieben Jahre herum, darum sprach er: "Ehe die Hochzeit ist, will ich noch einmal in meine Heimat zu meinem alten Vater reisen." Des war der König zufrieden. So zog er denn fort in seine Heimat, und als er da ankam, war es Abend; da kehrte er in dem ersten Gasthofe ein, der des Bürgermeisters Hause gerade gegenüber lag.
Dem Bürgermeister sein Haus war aber ganz hell erleuchtet und war Musik darin und wurde getanzt. Da fragte er den Wirt, was denn das zu bedeuten hätte, dass es in dem Hause da auf der anderen Seite so lustig herginge. "Das kommt daher", antwortete der Wirt, "dass unseres Bürgermeisters Tochter heute Hochzeit hält." Da fragte er weiter ob er es als Fremder wohl wagen könnte, auch mal hinüber auf die Hochzeit zu gehen. "Das könnt Ihr nur dreist tun", sagte der Wirt, "so einen feinen, reichen Herrn, wie Ihr seid, wird man da gerne sehen."
So ging er denn auf die Hochzeit; aber von den Leuten, die da waren, kannte ihn keiner wieder und alle freuten sie sich, dass so ein vornehmer Herr ihnen die Ehre antäte, bei ihnen einzusprechen. "Ist es wohl erlaubt", fragte er da, "mit der Braut einen Tanz zu machen?" "Ei ja wohl", sprachen alle, "das wird der Braut eine große Ehre sein." Da ging er hin zu den Musikanten und bestellte seinen Lieblingswalzer, den er sonst mit seiner Karoline immer so gern getanzt hatte, und als er sie nun zum Tanze holte und die Musik den Walzer zu spielen anfing, wurde sie ganz still und dachte bei sich:
"Es ist doch sonderbar, dass dieser fremde Herr mich gerade heute an meinen Fritz erinnern muss, der doch gewiss schon lange tot ist; nun ich seinen Lieblingswalzer spielen höre, wird mir ordentlich das Herz schwer"; aber doch erkannte sie ihn nicht. Als nun der Tanz zu Ende war und der fremde Herr wieder fort gehen wollte, drückte er der Braut ein Papier in die Hand, und als sie das aufmachte, so lag darin der Ring, den sie ihrem Fritz vor sieben Jahren gegeben hatte, als sie von einander Abschied nahmen.
Sowie sie aber den Ring erkannte, wurde sie ganz blass und fiel für tot auf den Boden hin. Da nahm die Hochzeit ein trauriges Ende. Fritz aber ging zu seinem Vater und gab sich ihm zu erkennen und erzählte ihm, dass er nun Vizekönig von Spanien sei; das ist dem alten Manne eine große Freude gewesen.
Den anderen Tag wurde Karoline in ihrem Sarge in das Totengewölbe gebracht, denn sie war nicht wieder zum Leben zurückgekommen. Mittlerweile kam ein Bote von Spanien, der brachte die Nachricht an Fritz, die Königstochter wäre plötzlich gestorben und der König wollte nun die Regierung ganz abtreten; darum solle er doch schnell nach Spanien zurückkommen.
Weil er aber, ehe er fortreiste, seine liebe Karoline doch noch zum letzten Male sehen wollte, so ging er mit seinem Vater, der den Schlüssel zu dem Totengewölbe hatte, in der Nacht dahin; da lag sie still in ihrem Sarge, und als er sich nun weinend über sie beugte, um sie zu küssen, fühlte er mit einem Male, dass sie noch leise Atem holte.
Da brachte er sie mit seinem Vater aus dem kalten Gewölbe ins Haus, und in der Wärme kam sie nach und nach wieder ins Leben zurück; und als sie ihren Fritz erkannte, fielen sie sich beide um den Hals und weinten vor Freude, dass sie sich nun endlich wieder hatten.
Den folgenden Tag musste Fritz wieder fort nach Spanien; seine Karoline ließ er aber bei seinem Vater und sagte ihr, dass sie da heimlich bleiben sollte, bis er wieder käme. Es verging ein Jahr und ein Tag, da kam er zurück und veranstaltete ein großes Gastmahl, dazu ließ er auch den Bürgermeister einladen, und als sie zu Tische saßen sagte er, er wolle ihnen mal ein Gleichnis aufgeben, darüber sollten sie ihm alle ihre Meinung sagen.
"Es war mal ein Gärtner", sprach er da, "der hatte eine wunderschöne Blume; die Blume verwelkte, und der Gärtner riss sie aus und warf sie aus seinem Garten. Nun kam des Wegs ein Mann, der fand die Blume, nahm sie mit und pflanzte sie in seinen Blumengarten, und weil er sie pflegte und wohl begoss, so wurde die Blume wieder frisch und schön wie vorher. Nun sagt! Wem kam die Blume zu? Dem Gärtner, der sie aus seinem Garten warf, oder dem Manne, der sie fand und pflegte, bis sie wieder frisch und grün geworden war?"
Da sagten sie alle, dass dem die Blume gehörte, der sie gefunden und gepflegt hätte. "Nun denn", sagte er, "so will ich euch die Blume zeigen!" und indem so machte er die Tür auf und ließ seine Karoline hereinkommen. "Seht her! dies ist die Blume, die ich fand und pflegte und wieder ins Leben brachte, als sie verwelkt war; nun will ich sie auch behalten, so lange ich lebe."
Da nahm er sie mit in sein Königreich und lebte glücklich mit ihr bis an sein Ende.
Wilhelm Busch
DIE DREI DIEBE ...

Der geneigte Leser wird ermahnt, nicht alles für wahr zu halten, was in dieser Erzählung vorkommt. Doch ist sie in einem schönen Buch beschrieben und zu Vers gebracht.
Der Zundel-Heiner und der Zundel-Frieder trieben von Jungend auf das Handwerk ihres Vaters, der bereits am Auerbacher Galgen mit des Seilers Tochter kopuliert war, nämlich mit dem Strick; und ein Schulkamerad, der rote Dieter, hielt's auch mit, und war der Jüngste.
Doch mordeten sie nicht, und griffen keine Menschen an, sondern visitierten nur bei Nacht in den Hühnerställen, und wenn's Gelegenheit gab, in den Küchen, Kellern und Speichern, allenfalls auch in den Geldtrögen, und auf den Märkten kauften sie immer am wohlfeilsten ein. Wenn's aber nichts zu stehlen gab, so übten sie sich untereinander mit allerlei Aufgaben und Wagstücken, um im Handwerk weiter zu kommen.
Einmal im Wald sieht der Heiner auf einem hohen Baum einen Vogel auf dem Neste sitzen, denkt, er hat Eier, und fragt die anderen: "Wer ist imstand und holt dem Vogel dort oben die Eier aus dem Nest, ohne dass es der Vogel merkt?" Der Frieder, wie eine Katze, klettert hinauf, naht sich dem Nest, bohrt langsam ein Löchlein unten drein, lässt ein Eilein nach dem anderen in die Hand fallen, flickt das Nest wieder zu mit Moos und bringt die Eier.
"Aber wer dem Vogel die Eier wieder unterlegen kann sagte jetzt der Frieder, "ohne dass es der Vogel merkt!" Da klettert der Heiner den Baum hinan, aber der Frieder klettert ihm nach, und während der Heiner dem Vogel langsam die Eier unterschob, ohne dass es der Vogel merkte, zog der Frieder dem Heiner langsam die Hosen ab, ohne dass es der Heiner merkte. Da gab es ein groß Gelächter, und die beiden anderen sagten: "Der Frieder ist der Meister."
Der rote Dieter aber sagte: "Ich sehe schon, mit euch kann ich's nicht zugleich tun, und wenn's einmal zu bösen Häusern geht und der Letze kommt über uns, so ist's mir nimmer Angst für euch, aber für mich." Also ging er fort, wurde wieder ehrlich und lebte mit seiner Frau arbeitsam und häuslich.
Im Spätjahr, als die zwei anderen noch nicht lang auf dem Rossmarkt ein Rösslein gestohlen hatten, besuchten sie einmal den Dieter und fragten ihn, wie es ihm gehe; denn sie hatten gehört, dass er ein Schwein geschlachtet und wollten ein wenig Acht geben, wo es liegt. Es hing in der Kammer an der Wand. Als sie fort waren, sagte der Dieter: "Frau, ich will des Säulein in die Küche tragen und die Mulde drauf decken, sonst ist es morgen nimmer unser."
In der Nacht kommen die Diebe, brechen, so leise sie können, die Mauer durch, aber die Beute war nicht mehr da. Der Dieter merkt etwas, steht auf, und geht um das Haus und sieht nach. Unterdessen schleicht der Heiner um das andere Eck herum ins Haus bis zum Bett, wo die Frau lag, nimmt ihres Mannes Stimme an und sagt: "Frau, die Sau ist nimmer in der Kammer." Die Frau sagt: "Schwätz nicht so einfältig: Hast du sie nicht selber in die Küche unter die Mulde getragen?"
"Ja so", sagte der Heiner, "drum bin ich halber im Schlaf" und ging, holte das Schwein und trug es unbeschrieen fort, wusste in der finsteren Nacht nicht, wo der Bruder ist, dachte, er wird schon kommen an den bestellten Platz im Wald. Und als der Dieter wieder ins Haus kam und nach dem Säulein greifen will, "Frau", rief er, Jetzt haben's die Galgenstricke doch geholt."
Allein, so geschwind gab er nicht gewonnen, sondern setzte den Dieben nach, und als er den Heiner einholte (es war schon weit vom Hause weg), und als er merkte, dass er allein sei, nahm der schnell die Stimme des Frieders an und sagte: "Bruder, lass jetzt mich das Säulein tragen. Du wirst müde sein."
Der Heiner meint, es sei der Bruder, und gibt ihm das Schwein, sagt, er wolle vorausgehen in den Wald und ein Feuer machen. Der Dieter aber kehrte hinter ihm um, sagte für sich selber: "Hab' ich dich wieder, du liebes Säulein?" und trug es heim. Unterdessen irrte, der Frieder in der Nacht herum, bis er im Wald das Feuer sah, und kam und fragte den Bruder: "Hast du die Sau, Heiner?"
Der Heiner sagte: "Hast du sie denn nicht, Frieder?" Da schauten sie einander mit großen Augen an und hätten kein so prasselndes Feuer mit buchenen Spänen gebraucht zum Nachtkochen. Aber desto schöner prasselte jetzt das Feuer daheim in Dieters Küche. Denn das Schwein wurde sogleich nach der Heimkunft verhauen und Kesselfleisch über das Feuer getan. Denn der Dieter sagte: "Frau, ich bin hungrig, und was wir nicht beizeiten essen, holen die Schelme doch."
Als er sich aber in einen Winkel legte und ein wenig schlummerte, und die Frau kehrte mit der eisernen Gabel das Fleisch herum und schaute einmal nach der Seite, weil der Mann im Schlaf so ängstlich seufzte, kam eine zugespitzte Stange langsam durch den Kamin herab, spießte das beste Stück im Kessel an und zog es herauf; und als der Mann im Schlaf immer ängstlicher winselte, und die Frau immer emsiger nach ihm sah, kam die Stange zum zweitenmal und zum drittenmal; und als die Frau den Dieter weckte:
"Mann, jetzt wollen wir anrichten", da war der Kessel leer, und wäre ebenfalls kein so großes Feuer nötig gewesen zum Nachtkochen. Als sie aber beide schon im Begriff waren, hungrig ins Bett zu gehen, und dachten: Will der Henker das Säulein holen, so können wir's ja doch nicht heben, da kamen die Diebe vom Dach herab, durch das Loch der Mauer in die Kammer und aus der Kammer in die Stube und brachten wieder, was sie gemaust hatten.
Jetzt ging ein fröhliches Leben an. Man aß und trank, man scherzte und lachte, als ob man gemerkt hätte, es sei das letzte Mal, und war guter Dinge, bis der Mond im letzten Viertel über das Häuslein weg ging und zum zweitenmal im Dorf die Hähne krähten und von weitem der Hund des Metzgers bellte. Denn die Strickreiter waren auf der Spur, und als die Frau des roten Dieters sagte: "jetzt ist's einmal Zeit ins Bett", kamen die Strickreiter von wegen des gestohlenen Rössleins und holten den Zundel-Heiner und den Zundel-Frieder in den Turm und in das Zuchthaus.
Johann Peter Hebel
DIE KÜNSTLICHE ORGEL ...
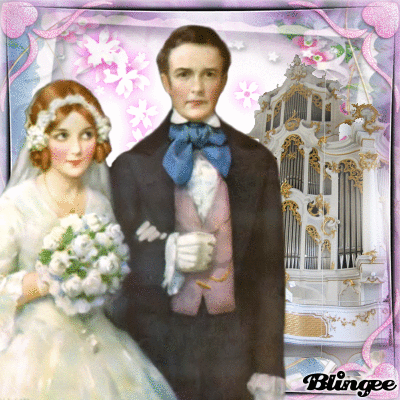
Vor langen, langen Jahren lebte einmal ein sehr geschickter junger Orgelbauer, der hatte schon viele Orgeln gebaut, und die letzte war immer wieder besser als die vorhergehende. Zuletzt machte er eine Orgel, die war so künstlich, dass sie von selbst zu spielen anfing, wenn ein Brautpaar in die Kirche trat, an dem Gott sein Wohlgefallen hatte.
Als er auch diese Orgel vollendet hatte, besah er sich die Mädchen des Landes, wählte sich die Frömmste und Schönste und ließ seine eigene Hochzeit zurichten. Wie er aber mit der Braut über die Kirchschwelle trat und Freunde und Verwandte in langem Zuge folgten, war sein Herz voller Stolzes und Ehrgeizes. Er dachte nicht an seine Braut und nicht an Gott, sondern nur daran, was er für ein geschickter Meister sei, dem niemand es gleichtun könne, und wie alle Leute staunten und ihn bewundern würden, wenn die Orgel von selbst zu spielen begönne.
So trat er mit seiner schönen Braut in die Kirche ein - aber die Orgel blieb stumm. Das nahm sich der Orgelbaumeister sehr zu Herzen, denn er meinte in seinem stolzen Sinne, dass die Schuld nur an der Braut liegen könne und dass sie ihm nicht treu sei. Er sprach den ganzen Tag über kein Wort mit ihr, schnürte dann Nachts heimlich sein Bündel und verließ sie.
Nachdem er viele hundert Meilen weit gewandert war, ließ er sich endlich in einem fremden Land nieder, wo niemand ihn kannte und keiner nach ihm fragte. Dort lebte er still und einsam zehn Jahre lang: da überfiel ihn eine namenlose Angst nach der Heimat und nach der verlassenen Braut. Er musste immer wieder daran denken, wie sie so fromm und schön gewesen sei und wie er sie so böslich verlassen.
Nachdem er vergeblich alles getan, um seine Sehnsucht niederzukämpfen, entschloss er sich, zurückzukehren und sie um Verzeihung zu bitten. Er wanderte Tag und Nacht, dass ihm die Fußsohlen wund wurden, und je mehr er sich der Heimat näherte, desto stärker wurde seine Sehnsucht und desto größer wurde seine Angst, ob sie wohl wieder so gut und freundlich zu ihm sein werde wie in der Zeit, wo sie noch seine Braut war.
Endlich sah er die Türme seiner Vaterstadt von fern in der Sonne blitzen. Da fing er an zu laufen, was er laufen konnte, so dass die Leute hinter ihm her den Kopf schüttelten und sagten: "Entweder ist es ein Narr, oder er hat gestohlen." Wie er aber in das Tor der Stadt eintrat, begegnete ihm ein langer Leichenzug. Hinter dem Sarge her gingen eine Menge Leute, welche weinten.
"Wen begrabt ihr hier, ihr guten Leute, dass ihr so weint?" - "Es ist die schöne Frau des Orgelbaumeisters, die ihr böser Mann verlassen hat. Sie hat uns allen so viel Gutes und Liebes getan, dass wir sie in der Kirche beisetzen wollen." Als er dies hörte, entgegnete er kein Wort, sondern ging still gebeugten Hauptes neben dem Sarg her und half ihn tragen.
Niemand erkannte ihn; weil sie ihn aber fortwährend schluchzen und weinen hörten, störte ihn keiner, denn sie dachten: Das wird wohl auch einer von den vielen armen Leuten sein, denen die Tote bei Lebzeiten Gutes erwiesen hat.
So kam der Zug zur Kirche, und wie die Träger die Kirchschwelle überschritten, fing die Orgel von selbst zu spielen an, so herrlich, wie noch niemand eine Orgel spielen gehört. Sie setzten den Sarg vor dem Altare nieder, und der Orgelbaumeister lehnte sich still an eine Säule daneben und lauschte den Tönen, die immer gewaltiger anschwollen, so gewaltig, dass die Kirche in ihren Grundpfeilern bebte.
Die Augen fielen ihm zu, denn er war sehr müde von der weiten Reise; aber sein Herz war freudig, denn er wusste, dass ihm Gott verziehen habe, und als der letzte Ton der Orgel verklang, fiel er tot auf das steinerne Pflaster nieder. Da hoben die Leute die Leiche auf, und wie sie inne wurden, wer es sei, öffneten sie den Sarg und legten ihn zu seiner Braut. Und wie sie den Sarg wieder schlossen, begann die Orgel noch einmal ganz leise zu tönen. Dann wurde sie still und hat seitdem nie wieder von selbst geklungen.
Richard von Volkmann-Leander
DREI WÜNSCHE ...
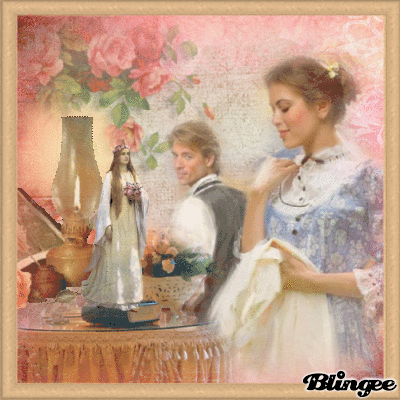
Ein junges Ehepaar lebte recht vergnügt und glücklich beisammen und hatte den einzigen Fehler, der in jeder menschlichen Brust daheim ist: Wenn man es gut hat, hätte man es gerne besser. Aus diesem Fehler entstehen so viele törichte Wünsche, woran es unserem Hans und seiner Liese auch nicht fehlte. Bald wünschten sie des Schulzen Acker, bald des Löwenwirts Geld, bald des Meyers Haus und Hof und Vieh, bald einmal hunderttausend Millionen bayerische Taler kurzweg.
Eines Abends aber, als sie friedlich am Ofen saßen und Nüsse aufklopften und schon ein tiefes Loch in den Stein hineingeklopft hatten, kam durch die Kammertür ein weißes Weiblein herein, nicht mehr als eine Elle lang, aber wunderschön von Gestalt und Angesicht, und die ganze, Stube war voll Rosenduft. Das Licht löschte aus, aber ein Schimmer wie Morgenrot, wenn die Sonne nicht mehr fern ist, strahlte von dem Weiblein aus und überzog alle Wände.
Über so etwas kann man nun doch ein wenig erschrecken, so schön es aussehen mag. Aber unser gutes Ehepaar erholte sich doch bald wieder, als das Fräulein mit wundersüßer, silberreiner Stimme sprach: "ich bin eure Freundin, die Bergfey Anna Fritze, die im kristallenen Schloss mitten in den Bergen wohnt, mit unsichtbarer Hand Gold in den Rheinsand streut und über siebenhundert dienstbare Geister gebietet. Drei Wünsche dürft ihr tun; drei Wünsche sollen erfüllt werden."
Hans drückte den Ellenbogen an den Arm seiner Frau, als ob er sagen wollte: Das lautet nicht übel. Die Frau aber war schon im Begriff, den Mund zu öffnen und etwas von ein paar Dutzend goldgestickten Kappen, seidenen Halstüchern und dergleichen zur Sprache zu bringen, als die Bergfey sie mit aufgehobenem Zeigefinger warnte:
"Acht Tage lang", sagte sie, "habt ihr Zeit. Bedenkt euch wohl und übereilt euch nicht!" Das ist kein Fehler, dachte der Mann und legte seiner Frau die Hand auf den Mund. Das Bergfräulein aber verschwand. Die Lampe brannte wie vorher, und statt des Rosendufts zog wieder wie eine Wolke am Himmel der Öldampf durch die Stube.
So glücklich nun unsere guten Leute in der Hoffnung schon zum voraus waren und keinen Stern mehr am Himmel sahen, sondern lauter Bassgeigen, so waren sie jetzt doch recht übel dran, weil sie vor lauter Wunsch nicht wussten, was sie wünschen wollten, und nicht einmal das Herz hatten, recht daran zu denken oder davon zu sprechen, aus Furcht, es möchte für gewünscht passieren, ehe sie es genug überlegt hätten. "Nun", sagte die Frau, "wir haben ja noch Zeit bis am Freitag."
Des anderen Abends, während die Grundrisse zum Nachtessen in der Pfanne prasselten, standen beide, Mann und Frau, vergnügt an dem Feuer beisammen, sahen zu, wie die kleinen Feuerfünklein an der rußigen Pfanne hin und her züngelten, bald angingen, bald auslöschten, und waren, ohne ein Wort zu reden, vertieft in ihrem künftigen Glück.
Als sie aber die gerösteten Grundbirn aus der Pfanne auf das Plättlein anrichtete und ihr der Geruch lieblich in die Nase stieg: "Wenn wir jetzt nur ein gebratenes Würstlein dazu hätten", sagte sie in aller Unschuld und ohne an etwas anderes zu denken, und - o weh, da war der erste Wunsch getan. Schnell, wie ein Blitz kommt und vergeht, kam es wieder wie Morgenrot und Rosenduft untereinander durch den Kamin herab, und auf den Grundbirn lag die schönste Bratwurst. -
Wie gewünscht, so geschehen. - Wer sollte sich über einen solchen Wunsch und seine Erfüllung nicht ärgern? Welcher Mann über solche Unvorsichtigkeit seiner Frau nicht unwillig werden?
"Wenn dir doch nur die Wurst an der Nase angewachsen wäre", sprach er in der ersten Überraschung, auch in aller Unschuld und ohne an etwas anderes zu denken und wie gewünscht, so geschehen.
Kaum war das letzte Wort gesprochen, da saß die Wurst auf der Nase des guten Weibes fest wie angewachsen im Mutterleib, und hing zu beiden Seiten hinab wie ein Husaren-Schnauzbart.
Nun war die Not der armen Eheleute erst recht groß. Zwei Wünsche waren getan und vorüber, und noch waren sie um keinen Heller und um kein Weizenkorn, sondern nur um eine böse Bratwurst reicher. Noch war ein Wunsch zwar übrig.
Aber was half nun aller Reichtum und alles Glück zu einer solchen Nasenzierrat der Hausfrau? Wollten sie wohl oder übel, so mussten sie die Bergfey bitten, mit unsichtbarer Hand Barbiersdienste zu leisten und Frau Liese wieder von der vermaledeiten Wurst zu befreien. Wie gebeten, so geschehen, und so war der dritte Wunsch auch vorüber und die armen Eheleute sahen einander an, waren der nämliche Hans und die nämliche Liese nachher wie vorher, und die schöne Bergfey kam niemals wieder.
Merke: Wenn dir einmal die Bergfey also kommen sollte, so sei nicht geizig, sondern wünsche Numero eins: Verstand, dass du wissen mögest, was du Numero zwei: wünschen sollst, um glücklich zu werden. Und weil es leicht möglich wäre, dass du alsdann etwas wähltest, was ein törichter Mensch nicht hoch anschlägt, so bitte noch Numero drei: um beständige Zufriedenheit und keine Reue.
Oder so: Alle Gelegenheit, glücklich zu werden, hilft nichts, wer den Verstand nicht hat, sie zu benutzen.
Johann Peter Hebel
EINE KINDERGESCHICHTE ...
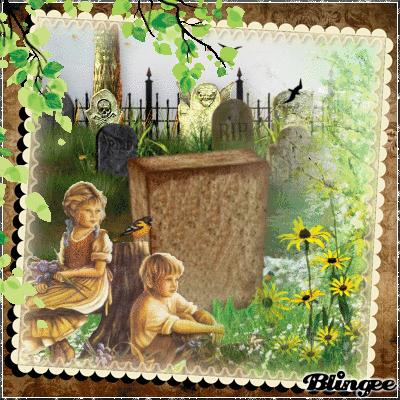
Der Kirchhof, auf dem die zwei kleinen Kinder spielten, von denen ich heute erzählen will, lag hoch oben auf dem grünen Bergeshange. Das Dörfchen, zu dem er gehörte, lag schon hoch genug über dem waldigen Tal, so dass die Wolken es oft verdeckten, wenn man unten auf dem blauen Flusse vorüber fuhr. Doch der Kirchhof lag noch höher über dem Dorf, so dass seine vielen schwarzen Kreuze recht in den blauen Himmel hineinragten.
Es war ziemlich mühsam für die Leute, ihre Verstorbenen aus dem Dorfe nach dem Kirchhof zu tragen, denn der Weg war steil und steinig, bis man zu der grünen Matte kam, auf der der Kirchhof lag; doch sie taten es gern. Denn die Bergbewohner können es nicht im Tal aushalten; da wird es ihnen so dumpf und ängstlich zumut, wie uns in einem tiefen Keller und ihre Toten noch weniger. Hoch oben auf dem Berge müssen sie begraben sein, so dass sie weit hinaus in das Land sehen können und hinunter ins Tal, wo die Schiffe fahren.
Ganz in der Ecke des Kirchhofes war ein verlassenes Grab. Es wuchs nur Gras auf ihm, und in dem Grase ganz versteckt ein paar wilde weiße oder blaue Blümchen, die niemand gepflanzt hatte. Denn in dem Grabe lag ein alter Hagestolz, der weder Weib noch Kind noch sonst irgend jemand hinterlassen hatte, der sich um ihn bekümmerte. Aus fremdem Lande war er gekommen, woher, das wusste keiner.
Er war jeden Morgen auf die Kuppe des Berges gestiegen und hatte dort stundenlang gesessen. Aber bald war er gestorben, und man hatte ihn begraben. Einen Namen hatte er ja sicher gehabt; wie er aber lautete, wusste ebenfalls niemand, nicht einmal der Totengräber. Im Kirchenbuche standen nur drei Kreuze und dahinter "ein alter fremder Hagestolz, gestorben am soundsovielten, im Jahre des Herrn soundso".
Das ist nun freilich sehr wenig; aber die zwei kleinen Kinder des Totengräbers, von denen ich eben erzählen wollte, hatten das alte, verlassene Grab in der Kirchhofsecke ganz besonders gern; denn es war ihnen erlaubt, auf ihm zu spielen und herumzutrampeln, soviel sie Lust hatten, während sie die anderen Gräber nicht anrühren durften. Diese waren alle sehr sorgfältig instand gehalten; das Gras war frisch geschoren und dicht wie Samt, auch blühten allerhand Blumen auf ihnen, die der Totengräber täglich mit großer Sorgfalt begoss, wozu er sich das Wasser mühsam aus dem Dorfbrunnen heraufschleppen musste. Auf vielen lagen auch Kränze und bunte Bänder.
"Trinchen", sagte der kleine Knabe, der vor dem verlassenen Grabe kniete, indem er sich wohlgefällig das Loch besah, welches er in die Seitenwand des Grabes mit seinen kleinen Händen hinein gegraben hatte, "Trinchen, unser Haus ist fertig. Ich habe es mit bunten Steinen ausgepflastert und Blumenblätter darauf gestreut. Ich bin der Vater und du bist die Mutter. Guten Morgen, Mutter, was machen unsere Kinder?"
"Hans", entgegnete die Kleine, "du musst nicht so rasch spielen. Ich habe noch keine Kinder, aber ich werde gleich welche bekommen." Darauf lief sie zwischen den Gräbern und Büschen umher und kam, beide Hände mit Schnecken gefüllt, wieder:
"Höre, Vater, ich habe schon sieben Kinder, sieben wunderschöne Schneckenkinder!"
"Dann wollen wir sie gleich zu Bett bringen, denn es ist schon spät."
Sie pflückten grüne Blätter ab, legten sie in das Loch, die bunten Schneckenhäuser darauf, und deckten jedes wieder mit einem grünen Blatte zu.
"Jetzt sei einmal still, Hänschen", rief das kleine Mädchen, "ich muss meine Kinder einsingen; das muss ich ganz allein machen. Der Vater singt nie mit. Du kannst unterdessen noch auf die Arbeit gehen." Und Hänschen lief fort, und Trinchen sang mit ganz feiner Stimme:
"Schlaft mir all zusammen ein,
Meine sieben Kinderlein
In euren weichen Betten.
Schlummert süß und schlafet aus,
Steckt mir keins die Beinchen 'raus
Unter eurer Decke!"
Aber das eine Blatt begann sich zu bewegen, und eine von den Schnecken steckte unter dem selben ihren Kopf mit den feinen Hörnern hervor. Da tippte die Kleine sie mit dem Finger auf den Kopf und sagte: "Warte, Gustl, du bist immer die Unartigste! Heute früh hast du dich schon nicht wollen kämmen lassen. Willst du gleich wieder ins Bett!" Und sie sang noch einmal:
"Schlummert süß und schlafet aus,
Steckt mir keins die Beinchen 'raus
Unter eurer Decke!
Seid ihr dann geschlafen ein,
Fliegt ein Engel ins Zimmer 'rein,
Besieht sich alle sieben:
Deine Kinder sind alle weiß und rot,
Ein' schönen Gruß vom lieben Gott,
Ob sie auch fromm geblieben?
Meine Kinder sind alle fromm,
Sie woll'n gern in den Himmel komm'n,
Schön' Dank für Milch und Wecken.
Bring wieder einen Gruß nach Haus:
Es stecke auch keins die Beinchen 'raus
Mehr unter seiner Decke."
Als sie ausgesungen hatte, waren die sieben Schnecken wirklich alle eingeschlafen, wenigstens lagen sie alle still, und da Hänschen immer noch nicht zurückkehrte, lief die Kleine noch einmal im Kirchhof umher und suchte neue Schnecken. Sie sammelte eine große Zahl in ihrer Schürze und kehrte mit ihnen zum Grabe zurück. Da saß Hänschen und wartete. "Vater", rief sie ihm entgegen, "ich habe noch hundert Kinder gekriegt!"
"Höre Frau", erwiderte der Kleine, "hundert Kinder sind sehr viel. Wir haben bloß einen Puppenteller und zwei Puppengabeln. Womit sollen die Kinder essen? Hundert Kinder hat auch gar keine Mutter. Es gibt auch nicht hundert Namen. Wie sollen wir unsere Kinder taufen? Trag sie wieder fort!""Nein, Hänschen", sagte das kleine Mädchen, "hundert Kinder sind sehr hübsch. Ich brauche sie alle."
Indes kam die junge Frau des Totengräbers mit zwei großen Butterbroten, denn die Vesperstunde hatte geschlagen. Sie küsste die beiden Kinder, hob sie auf, setzte sie auf das Grab und sagte: "nehmt eure neuen Schürzen hübsch in acht." Da saßen sie nun stumm wie die Spatzen und aßen.
Aber der alte Hagestolz in seinem einsamen Grabe hatte alles vernommen; denn die Toten hören alles sehr genau, was man an ihrem Grabe spricht. Er dachte an die Zeit, wo er noch ein kleiner Knabe gewesen war. Da hatte er auch ein kleines Mädchen gekannt, und sie hatten zusammen gespielt, hatten Häuser gebaut und waren Mann und Frau gewesen. Und dann dachte er an die spätere Zeit, wo er das kleine Mädchen noch einmal gesehen hatte, wie es schon erwachsen war.
Nachher hatte er nie wieder etwas von ihm gehört, denn er war seine eigenen Wege gegangen, und die mussten wohl nicht sehr schön gewesen sein, denn je mehr er daran dachte, und je mehr oben auf seinem Grabe die Kinder schwatzten, um so trauriger wurde er. Er fing an zu weinen und weinte immer mehr. Und als die Totengräberfrau die Kinder auf sein Grab setzte und sie ihm nun gerade auf der Brust saßen, weinte er noch viel mehr. er versuchte seine Arme auszustrecken, denn es war ihm so, als müsse er die Kinder an sein Herz drücken.
Aber es ging nicht; denn auf ihm lagen sechs Fuß Erde, und sechs Fuß Erde wiegen schwer, sehr schwer. Da weinte er noch mehr; und er weinte immer noch, als die Totengräberfrau längst die Kinder geholt und zu Bett gebracht hatte.
Als aber der Totengräber am nächsten Morgen durch den Kirchhof ging, da war aus dem alten verlassenen Grabe eine Quelle entsprungen. Das waren die Tränen, die der alte Hagestolz geweint hatte. Sie rieselte hell aus dem Grabhügel hervor und kam gerade aus dem Loche, wo die beiden Kinder ihr kleines Häuschen hinein gegraben hatten. Da freute sich der Totengräber, denn nun brauchte er das Wasser zum Begießen der Blumen nicht mehr aus dem Dorfe den steilen Weg hinaufzutragen.
Er machte für die Quelle eine ordentliche Leitung und fasste sie mit großen Steinen ein. Von jetzt an begoss er mit dem Wasser der neuen Quelle alle Gräber auf dem Kirchhofe, und die Blumen auf ihnen blühten nun schöner wie je zuvor. Nur das Grab, worin der alte Hagestolz lag, begoss er nicht, denn es war ja ein altes, verlassenes Grab, nach dem niemand fragte. Trotzdem wuchsen aber auf ihm die wilden Bergblumen üppiger wie an jedem anderen Orte, und die beiden Kinder saßen oft an der Quelle, bauten Mühlen und ließen Papierkähnchen auf ihr schwimmen.
Richard von Volkmann-Leander
GOLDENER ...
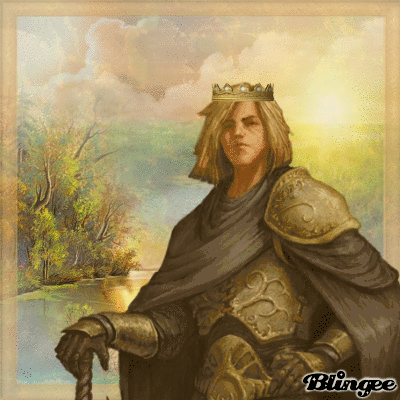
Es sind wohl zweitausend Jahre oder noch länger, da hat in einem dichten Walde ein armer Hirt gelebt, der hatte sich ein bretternes Haus mitten im Walde erbaut, darin wohnte er mit seinem Weib und sechs Kindern; die waren alle Knaben. An dem Hause war ein Ziehbrunnen und ein Gärtlein, und wann der Vater das Vieh hütete, so gingen die Kinder hinaus und brachten ihm zu Mittag oder zu Abend einen kühlen Trunk aus dem Brunnen oder ein Gericht aus dem Gärtlein.
Dem jüngsten der Knaben riefen die Eltern nur: Goldener, denn seine Haare waren wie Gold, und obgleich der jüngste, so war er doch der stärkste von allen und der größte. Sooft die Kinder hinaus gingen, so ging Goldener mit einem Baumzweige voran; anders wollte keines gehen, denn jedes fürchtete sich, zuerst auf ein Abenteuer zu stoßen; ging aber Goldener voran, so folgten sie freudig eins hinter dem anderen nach durch das dunkelste Dickicht, und wenn auch schon der Mond über dem Gebirge stand.
Eines Abends ergötzten sich die Knaben auf dem Rückweg vom Vater mit Spielen im Walde, und hatte sich Goldener vor allen so sehr im Spiele ereifert, dass er so hell aussah, wie das Abendrot. "Lasst uns zurückgehen!" sprach der Älteste, "es scheint dunkel zu werden." - "Seht da, der Mond!" sprach der Zweite.
Da kam es licht zwischen den dunkeln Tannen hervor, und eine Frauengestalt wie der Mond setzte sich auf einen der moosigen Steine, spann mit einer kristallenen Spindel einen lichten Faden in die Nacht hinaus, nickte mit dem Haupte gegen Goldener und sang:
"Der weiße Fink, die goldene Ros',
Die Königskron' im Meeresschoß."
Sie hätte wohl noch weiter gesungen, da brach ihr der Faden, und sie erlosch wie ein Licht. Nun war es ganz Nacht, die Kinder fasste ein Grausen, sie sprangen mit kläglichem Geschrei, das eine dahin, das andere dorthin, über Felsen und Klüfte, und verlor eins das andere.
Wohl viele Tage und Nächte irrte Goldener in dem dicken Wald umher, fand auch weder einen seiner Brüder noch die Hütte seines Vaters, noch sonst die Spur eines Menschen; denn es war der Wald gar dicht verwachsen, ein Berg über den anderen gestellt und eine Kluft unter die andere. Die Braunbeeren, welche überall herumrankten, stillten seinen Hunger und löschten seinen Durst, sonst wär' er gar jämmerlich gestorben.
Endlich am dritten Tage, andere sagen gar erst am sechsten, wurde der Wald hell und immer heller, und da kam er zuletzt hinaus auf eine schöne grüne Wiese. Da war es ihm so leicht um das Herz, und er atmete mit vollen Zügen die freie Luft ein. Auf der selben Wiese waren Garne ausgelegt, denn da wohnte ein Vogelsteller, der fing die Vögel, die aus dem Wald flogen, und trug sie in die Stadt zu Kaufe.
"Solch ein Bursch ist mir gerade vonnöten", dachte der Vogelsteller, als er Goldener erblickte, der auf der grünen Wiese nah an den Garnen stand und in den weiten blauen Himmel hineinsah und sich nicht satt sehen konnte.
Der Vogelsteller wollte sich einen Spaß machen, er zog seine Garne, und husch! war Goldener gefangen und lag unter dem Garne gar erstaunt, denn er wusste nicht, wie das geschehen war. "So fängt man die Vögel, die aus dem Walde kommen", sprach der Vogelsteller laut lachend, "deine roten Federn sind mir eben recht. Du bist wohl ein verschlagener Fuchs; bleibe bei mir, ich lehre dich auch die Vögel fangen."
Goldener war gleich dabei; ihm deuchte unter den Vögeln ein gar lustig Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters wiederzufinden. "Lass erproben, was du gelernt hast", sprach der Vogelsteller nach einigen Tagen zu ihm. Goldener zog die Garne, und bei dem ersten Zuge fing er einen schneeweißen Finken.
"Packe dich mit diesem weißen Finken!" schrie der Vogelsteller, "du hast es mit dem Bösen zu tun!" Und so stieß er ihn gar unsanft von der Wiese, indem er den weißen Finken, den ihm Goldener gereicht hatte, unter vielen Verwünschungen mit den Füßen zertrat. Goldener konnte die Worte des Vogelstellers nicht begreifen; er ging getrost wieder in den Wald zurück und nahm sich noch einmal vor, die Hütte seines Vaters zu suchen.
Er lief Tag und Nacht über Felsensteine und alte, gefallene Baumstämme, fiel auch gar oft über die schwarzen Wurzeln, die aus dem Boden überall hervorragten. Am dritten Tag aber wurde der Wald heller und immer heller, und da kam er endlich hinaus und in einen schönen, lichten Garten, der war voll der lieblichsten Blumen, und weil Goldener so was noch nie gesehen, blieb er voll Verwunderung stehen.
Der Gärtner im Garten bemerkte ihn nicht so bald, denn Goldener stand unter den Sonnenblumen, und seine Haare glänzten im Sonnenschein nicht anders als so eine Blume.
"Ha!" sprach der Gärtner, "solch einen Burschen hab ich gerade vonnöten", und schloss das Tor des Gartens. Goldener ließ es sich gefallen, denn ihm deuchte unter den Blumen ein gar buntes Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters wiederzufinden.
"Fort in den Wald!" sprach der Gärtner eines Morgens zu Goldener, "hol mir einen wilden Rosenstock, damit ich zahme Rosen darauf pflanze!" Goldener ging und kam mit einem Stock der schönsten, goldfarbenen Rosen zurück, die waren auch nicht anders, als hätte sie der geschickteste Goldschmied für die Tafel eines Königs geschmiedet.
"Packe dich mit diesen goldenen Rosen!" schrie der Gärtner, "du hast es mit dem Bösen zu tun!" Und so stieß er ihn gar unsanft aus dem Garten, indem er die goldenen Rosen unter vielen Verwünschungen in die Erde trat. Goldener konnte die Worte des Gärtners nicht begreifen; er ging getrost wieder in den Wald zurück und nahm sich nochmals vor, die Hütte seines Vaters zu suchen.
Er lief Tag und Nacht von Baum zu Baum, von Fels zu Fels. Am dritten Tag endlich wurde der Wald hell und immer heller, und da kam Goldener hinaus und an das blaue Meer, das lag in einer unermesslichen Weite vor ihm. Die Sonne spiegelte sich eben in der kristallhellen Fläche, da war es wie fließendes Gold, darauf schwammen schön geschmückte Schiffe mit langen, fliegenden Wimpeln.
Eine zierliche Fischerbarke stand am Ufer, in die trat Goldener und sah mit Erstaunen in die Helle hinaus. "Ein solcher Bursch ist uns gerade vonnöten", sprachen die Fischer, und husch! stießen sie vom Lande. Goldener ließ es sich gefallen, denn ihm deuchte bei den Wellen ein goldenes Leben, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, seines Vaters Hütte wiederzufinden.
Die Fischer warfen ihre Netze aus und fingen nichts. "Lass sehen, ob du glücklicher bist!" sprach ein alter Fischer mit silbernen Haaren zu Goldener. Mit ungeschickten Händen senkte Goldener das Netz in die Tiefe, zog und fischte eine Krone von hellem Golde.
"Triumph!" rief der alte Fischer und fiel Goldenem zu Füßen, "ich begrüße dich als unseren König! Vor hundert Jahren versenkte der alte König, welcher keinen Erben hatte, sterbend seine Krone im Meer, und so lange, bis irgendeinen Glücklichen das Schicksal bestimmt hätte, die Krone wieder aus der Tiefe zu ziehen, sollte der Thron ohne Nachfolger in Trauer gehüllt bleiben."
"Heil unserem König!" riefen die Fischer und setzten Goldenen die Krone auf. Die Kunde von Goldener und der wiedergefundenen Königskrone erscholl bald von Schiff zu Schiff und über das Meer weit in das Land hinein. Da war die goldene Fläche bald mit bunten Nachen bedeckt und mit Schiffen, die mit Blumen und Laubwerk geziert waren; diese begrüßten alle mit lautem Jubel das Schiff, auf welchem König Goldener stand. Er stand, die helle Krone auf dem Haupte, am Vorderteile des Schiffes und sah ruhig der Sonne zu, wie sie im Meere erlosch.
Justinus Kerner
HEINO IM SUMPF ...
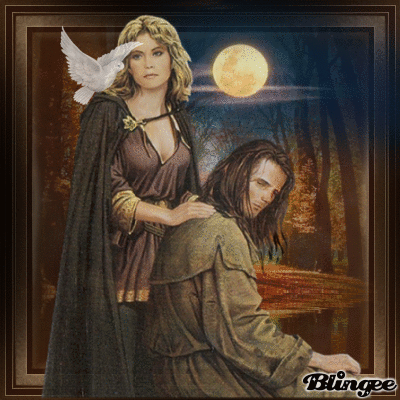
"Unser Sohn ist ein großer Jäger", sagte der alte König. "Er reitet alle Tage mit der Armbrust in den Wald. Aber er bringt nie ein Wild zurück, soviel er auch erlegt; denn er schenkt alles, was er schießt, den armen Leuten. Es ist ein sehr guter Mensch!"
So sagte der alte König zur Königin. Doch die Rehe im Walde dachten etwas ganz anderes. Sie hatten gar keine Furcht vor Heino; denn sie kannten ihn schon lange und wussten, dass er ihnen nichts zuleide tat. Er ritt ja immer nur durch den Wald hindurch bis an das Waldende; und am Waldende stand ein kleines Häuschen, fast ganz zugedeckt von Bäumen und Gesträuch, und Fenster und Haustüre fast ganz zugewachsen von Efeu und Geißblatt. Vor der Tür aber stand Blauäuglein, und wenn sie den Königssohn kommen sah, leuchteten ihre großen blauen Augen vor Freude wie zwei Sterne und beschienen ihr ganzes Gesicht.
Doch Heino brachte immer und immer kein Wild nach Hause und wollte stets allein reiten; und wenn sein Vater mit ihm ritt, traf er nichts. Da merkte der alte König wohl, dass es etwas Besonderes mit dem Jagen sein müsse. Er ließ einen Diener heimlich Heino nachschleichen, und der erzählte ihm alles. Da fuhr es ihm in die Krone, und er ward sehr zornig; denn Heino war sein einziger Sohn, und er gedachte ihn mit der Tochter eines mächtigen Königs zu vermählen.
Er rief daher zwei Jägerknechte, zeigte ihnen einen Klumpen Goldes, so groß wie ein Kopf, und versprach, ihnen denselben zu schenken, wenn sie Blauäuglein umbringen würde. Aber Blauäuglein hatte eine schneeweiße Taube, die saß jeden Tag auf dem höchsten Baume im Walde und sah nach dem Schloss. Wenn Heino zu Pferde stieg, um zu Blauäuglein zu reiten, flog sie schnell voran, schlug mit den Flügeln gegen das Fenster und rief:
"Es rascheln die Zweiglein,
Es kommt was geschritten,
Herzliebstes Blauäuglein,
Es kommt was geritten!"
Dann stellte sich Blauäuglein vor die Haustüre und wartete, bis Heino kam.
Als nun die weiße Taube die beiden Jägerknechte gegen Abend nach dem Walde schleichen sah, ahnte ihr nichts Gutes. Sie flog eilends zum Schloss an Heinos Fenster, schlug gegen die Scheiben, bis er kam und ihr aufmachte, und sagte ihm alles, was sie gesehen hatte. Da stürzte er atemlos in den Wald, und als er bei dem kleinen Häuschen ankam, hatten schon die Jägerknechte Blauäuglein gebunden und ratschlagten, wie sie es töten sollten. Da schlug er ihnen die beiden Häupter ab, trug sie nach Haus und setzte sie seinem Vater vor die Kammer auf die Schwelle.
Der alte König aber konnte die ganze Nacht nicht schlafen, sondern hörte fortwährend ein leises Wimmern und Stöhnen vor seiner Tür. Als der Morgen graute, stand er auf und sah nach, was es wäre. Da standen die beiden Köpfe der Jägerknechte auf der Schwelle, und zwischen beiden lag ein Brief von Heino, in dem stand geschrieben, dass er nichts mehr weder von Vater noch Mutter wissen wolle, und dass er sich jedwede Nacht vor Blauäugleins Haus auf die Schwelle legen würde mit dem nackten Schwert auf dem Schoß. Wer da käme, ihr ein Leid zu tun, dem schlüge er das Haupt ab, wie er es den beiden Jägerknechten getan, und wenn's der König selbst wäre.
Als der alte König dies gelesen, ward er sehr betreten. Er ging zur Königin und erzählte ihr alles. Diese aber schalt ihn aus, dass er Blauäuglein habe wollen umbringen lassen, und sagte: "Du hast alles verdorben! Wer wird nur immer gleich alles totmachen wollen! Ihr Männer seid doch gar zu schlimm, einer wie der andere! Stets heißt es: biegen oder brechen. Da sind von dir heute sechs Hemden aus der Wäsche gekommen, da fehlen wieder an allen sechsen die Hemdkragenbänder. Wo sind sie hin? Abgerissen hast du sie wieder, weil du sie verknotet hast, anstatt sie mit Geduld aufzuknüpfen. Und Heino ist geradeso wie du. Nun soll ich's wieder gutmachen!"
"Schon gut, schon gut", erwiderte der König, der wohl fühlte, dass die Königin recht hatte, "sei nur ruhig und höre auf zu schelten; davon wird's auch nicht besser."
Und die Königin warf sich die Nacht über unaufhörlich im Bette hin und her und überlegte sich, was sie tun wolle. Sobald es hell ward, ging sie auf den Anger und grub ein Kraut heraus, das war giftig und hatte schwarze Beeren. Darauf ging sie in den Wald und pflanzte es gerade an den Weg.
Als sie zurückkam, fragte sie der König, was sie gemacht habe. Da antwortete sie: "Ich habe ihm ein Kraut in den Weg gepflanzt, darauf wächst eine rote Blume; wer sie bricht, muss sein Liebstes vergessen."
Am nächsten Morgen, als Heino durch den Wald ging, stand das Kraut am Wege und hatte eine schöne rote Blume getrieben, die funkelte in der Sonne und duftete so stark, dass ihm fast die Sinne vergingen. Aber obschon es über Nacht stark getaut hatte, so waren doch das Kraut sowohl als die Blume ganz trocken. Da sagte er:
"Was ist das für ein Kraut,
Ein Kraut, worauf es nicht taut?"
Da antwortete die Blume:
"Ein Kraut, das niemand find't,
Als nur ein Königskind!"
Darauf fragte er wieder: "Und wenn ich dich nun bräch', Du Blum' an meinem Weg?" und die Blume erwiderte: "So blüht' ich noch viel schöner, Du stolzer Königssohn!" Da konnte er sich nicht halten und pflückte die Blume; und als er das getan, hatte er sein Liebstes vergessen und ging zu seinen Eltern ins Schloss.
Als ihn seine Mutter kommen sah, hatte er die rote Blume am Wams stecken. Da wusste sie, dass alles gelungen sei, und rief den König. Der ging seinem Sohne entgegen, brachte ihm einen goldenen Helm und eine goldene Rüstung und sprach: "Ich bin alt und schwach; geh in die Welt und sieh zu, wie's draußen aussieht. Wenn du nach zwei Jahren zurückkehrst, will ich dir das Königreich geben."
Darauf wählte sich Heino dreißig Knappen aus, zog mit ihnen von einem Königreich in das andere und besah sich die Herrlichkeit der Welt. Als aber Heino nicht wiederkam, merkte Blauäuglein wohl, dass er sie verlassen habe. Jeden Morgen schickte sie die weiße Taube aus, die musste so lange in der Welt herumfliegen, bis sie Heino gefunden. Und jeden Abend kam die weiße Taube wieder und sagte Blauäuglein, wo Heino wäre und wie es ihm ging:
"Was macht mein lieber Held,
Mein junges Königsblut?"
und die Taube antwortete:
"Er fährt in alle Welt
Und hat gar stolzen Mut!"
"Hat er noch mein vergessen
Und denkt er nimmer mein?"
"Er hat dein noch vergessen,
Beim Trinken und beim Essen,
Bei Regen und Sonnenschein!"
Zwei Jahre waren schon vergangen, da kam die weiße Taube eines Abends auch wieder zurück und hatte einen Blutfleck am Flügel.
Da fragte Blauäuglein:
"Was macht mein lieber Held,
Mein junges Königsblut?"
Da sah sie den Blutfleck am Flügel und wurde sehr traurig. "Ist er tot?" fragte sie.
"Wollte Gott, wollte Gott,
Dass er wäre tot!"
gurrte die Taube.
"Im Irrwischsumpf, da ist er ertrunken,
Im Irrwischsumpf, da ist er versunken.
Wo das Schilfgras wächst,
Da liegt er verhext,
Dass Gott erbarm',
In der Irrwischkönigin weißem Arm!"
Da hieß Blauäuglein die weiße Taube sich auf ihre Schulter setzen, damit sie ihr den Weg wiese, und machte sich auf, Heino zu suchen. Nachdem sie drei Tage gewandert war, kam sie an den Irrwischsumpf, wo Heino verzaubert lag. Sie setzte sich still an den Weg und wartete, bis es Abend wurde.
Als es dunkel ward, bezog sich der Himmel, und die Wolken jagten. Prasselnd schlug der Regen in das Erlengebüsch; und nicht lange, so sah sie fern im Sumpf die ersten blauen Flämmchen aufsteigen. Da schürzte sie sich ihre Röcke, stieg beherzt hinab in das Schilfgras und wanderte vorwärts, unverrückt nach den Irrlichtern schauend.
Es war ein beschwerlicher Weg; denn sie sank bald bis über die Knöchel ein, der Wind peitschte ihr das Haar um die Schultern, dass sie stehen bleiben musste, um es in einen großen Knoten im Nacken zusammenzuschürzen, und der Regen lief ihr über die Wangen. Aber der Sumpf wurde immer tiefer, und die blauen Flämmchen, welche in immer größerer Zahl an allen Orten hervor stiegen, schienen sie äffen zu wollen. Denn wenn es eine Zeitlang den Anschein gehabt, als wenn sie still ständen oder gar ihr entgegen kämen, so dass sie schon hoffte, sie bald zu erreichen, so schwebten sie doch bald wieder bis zur Mitte des Sumpfes zurück oder verlöschten plötzlich, um an einer entfernteren Stelle wieder aufzusteigen.
Sie sank jetzt schon bis fast an die Knie ein und konnte nicht mehr wie zwei oder drei Schritte hintereinander tun, ohne sich auszuruhen. Da hörte das Unwetter auf, die schmale Mondsichel trat zwischen den Wolken heraus, und vor ihr, inmitten einer großen dunklen Lache, erhob sich das verzauberte Schloss der Irrwischkönigin.
Weiße Stufen führten aus dem tot stillen Wasser in eine große, offen stehende Halle, welche von vielen Säulen von blauem und grünen Kristall mit goldenen Knäufen getragen wurde, und in buntem Gewirr tanzten in dieser Halle eine unzählbare Menge von Irrlichtern um ein besonders hell flackerndes, hoch aus ihrer Mitte hervorschwebendes Flämmchen herum.
Da lösten sich plötzlich aus dem Gewühl eine Anzahl Irrlichter ab und bildeten zwei Kreise, die wirbelnd aus der Halle hervorstürzten. Und während der eine von ihnen dicht vor den Stufen des Schlosses stehen blieb, näherte sich der andere rasch, und bald erkannte Blauäuglein zwölf blasse, aber wunderschöne Jungfrauen, welche auf der Stirn goldene Diademe trugen, an denen sich vorn kleine goldene Schalen erhoben, worin die blauen Flämmchen brannten.
In wildem Tanze schwebten sie an Blauäuglein heran und umringten sie; und während aus dem Schlosse eine zauberische Musik erklang, sangen sie:
"In den Reihen,
In den Reihen,
Holde Schwester, Blauäuglein, herein!
In dem Schloss,
In dem Schloss,
Da winkt dir ein süßer Genoss!
Sieh, wie's blinkt!
Wie er winkt,
Wie er grüßt, wie er grüßend dir winkt!
Vergiss, was du liebtest auf Erden,
Der Unseren eine zu werden!"
Aber Blauäuglein sah die Geister mit ihren großen klaren Augen ruhig und unverwandt an und sagte: "Ihr habt keine Macht über mich! Ob ich wieder lebendig aus dem Sumpfe komme, weiß Gott im Himmel allein; wenn ich aber auch sterben muss, so werdet ihr mich doch nicht in eure Gewalt bekommen!"
Da flohen die Jungfrauen nach allen Richtungen tief in den Sumpf zurück. Statt ihrer aber schwebte der zweite Kreis Irrlichter heran, der bis dahin vor den Stufen des Schlosses hin und her getanzt hatte. Das waren zwölf wunderschöne, aber totenblasse Knaben, ebenfalls mit blauen Flämmchen über den Stirnen.
Sie bildeten einen Kreis um Blauäuglein und tanzten langsam um sie her, indem sie abwechselnd ihre weißen Arme hoch über ihre Häupter erhoben und rückwärts nach dem Schlosse zeigten. Und besonders einer von ihnen näherte sich immer wieder Blauäuglein, als wenn er sie umfassen wollte; und wie sie ihn genauer ansah, so war es Heino.
Da zuckte es ihr durchs Herz, als wenn sie ein eiskaltes Schwert durchführe, und sie schrie laut: "Heino, Gott steh dir bei in deiner großen Not!" Kaum hatte sie dies ausgerufen, so fuhr ein heftiger Windstoß über den Sumpf, und die Lichter der Irrwische verloschen.
Die stille Fläche der Lache kräuselte sich, und schwarze Wellen schlugen an den weißen Stufen des Schlosses empor. Dann sank das Schloss lautlos in die Tiefe, und an seiner Stelle standen vier Pfähle von faulem Holz, die Überreste einer alten heidnischen Fischerhütte. Vor Blauäuglein aber, im tiefen Sumpf bis an den Gürtel eingesunken, stand Heino, leibhaftig, wie er gewesen war, aber blass und traurig. Die Haare hingen ihm wirr auf die Stirn, und Helm und Harnisch waren verrostet.
"Bist du es, Blauäuglein?" fragte er wehmütig.
"Ja, Heino, ich bin's."
"Lass mich", erwiderte er, "ich bin ein verlorener Mann!"
Doch sie gab ihm die Hand und sprach ihm Mut ein; und er versuchte einige Schritte vorwärts zu kommen. Dann blieb er stehen und sagte:
"Blauäuglein, ich versinke;
Blauäuglein, ich ertrinke!"
Doch sie hielt ihn nur fester und entgegnete:
"Nein, Heino, du versinkst nicht!
Nein, Heino, du ertrinkst nicht!
Halt dich an mir nur fest,
So wirst du doch erlöst!"
So half sie ihm Schritt für Schritt vorwärts und immer wieder blieb er stehen und sprach:
"Blauäuglein, ich versinke;
Blauäuglein, ich ertrinke!"
Und immer wieder tröstete sie ihn und sagte:
"Nein, Heino, du versinkst nicht!
Nein, Heino, du ertrinkst nicht!
Halt dich an mir nur fest,
So wirst du doch erlöst!"
Mit unsäglicher Mühe waren sie endlich so weit gekommen, dass sie von fern schon das Ende des Sumpfes und die Straße sahen. Da blieb Heino ganz stehen und rief: "Ich kann nicht weiter, Blauäuglein! Geh du allein zurück und grüß mein Mütterchen. Du kommst wohl heraus, denn du sinkst ja nicht tief ein; aber mir geht's fast bis ans Herz." Dabei wandte er sich um und blickte nach der Stätte zurück, wo das Schloss versunken war.
"Sieh dich nicht um!" rief Blauäuglein ängstlich. Aber sie hatte kaum Zeit gehabt, dies auszurufen, als auch schon von der Mitte des Sumpfes ein einzelnes blaues Flämmchen auf beide zugeschwebt kam. Es näherte sich rasch, und die Königin der Irrwische stand vor ihnen.
Sie hatte einen Kranz von weißen Wasserrosen auf dem Haupte, und ihr Diadem war eine goldene Schlange, welche sich leise durch ihr Haar und um ihre Stirn bewegte. Mit ihren glühenden Augen schaute sie Heino an, als wollte sie ihm bis ins Herz sehen. Dann legte sie ihm die Hand auf die Schulter und bat flehend: "Komm zurück, Heino!" Und er stand und sah sie an und schwankte unstet.
Da riss Blauäuglein ihm das Schwert von der Seite und schwang es gegen die Irrwischkönigin. Doch die Irrwischkönigin lächelte und sprach: "Törichtes Kind, was willst du mir tun? Ich bin nicht von Fleisch und Blut." Und sie fasste Heino und zog ihn mit Gewalt an sich, dass ihre schwarzen Locken über sein Gesicht fielen.
Da rief Blauäuglein in ihrer Herzensangst: "Und bist du nicht von Fleisch und Blut, du entsetzliches Weib, so ist es doch dieser hier, den ich aus deinen Händen erretten will!" Und sie zückte das Schwert noch einmal mit aller Kraft, und wie die Irrwischkönigin noch einen Versuch machte, Heino, dessen rechte Hand sie erfasst hatte, mit sich fortzureißen, rief sie:
"Heino, es tut nicht weh!" und schlug ihm mit einem Schlage den Arm dicht am Handgelenk ab.
Da verlosch auch die Flamme auf dem Haupte der Königin, und sie selber zerrann wie ein Nebelbild; die weiße Taube aber, die bisher auf der Schulter von Blauäuglein gesessen, flog auf die Schulter Heinos.
"Nun bist du erlöst, Heino!" rief Blauäuglein, als sie dies sah. "Komm, es ist nicht mehr weit zur Straße; nimm deine letzten Kräfte zusammen. Sieh, du sinkst gar nicht mehr tief ein." Und sie gingen weiter, aber immer noch blieb Heino oft stehen und sprach: "Blauäuglein, mein Arm brennt sehr!"
Doch sie erwiderte: "Heino, mich schmerzt es noch mehr!" Aber das letzte Stück musste sie ihn fast tragen, und als er den letzten Schritt aus dem Sumpfe getan, sank er todmüde auf die Straße nieder und schlief ein. Da nahm sie ihren Schleier und verband ihm den Arm, so dass er aufhörte zu bluten.
Als sie sah, dass er still und ruhig schlief, zog sie sich den Ring, den er ihr geschenkt, vom Finger, steckte ihm den selben an die Hand und machte sich auf den Heimweg. Sobald sie angekommen war, ging sie zum alten König und sagte zu ihm, indem sie ihn freudig mit ihren großen blauen Augen anblickte: "Ich habe Euren Sohn erlöst; er wird bald zu Euch zurückkehren. Behüt Euch Gott, mich seht Ihr nimmer wieder."
Da zog sie der alte König an sein Herz und sprach: "Blauäuglein, meine Tochter, du kannst eine Krone tragen so stolz wie ein Königskind! Wenn du ihm verzeihen willst und einen Einarmigen zum Manne nehmen, so sollst du seine Königin sein dein Leben lang."
Als er dies gesagt, öffnete er die Türe, und herein trat Heino und schloss Blauäuglein in seine Arme. Da war große Freude im ganzen Land, und alle Leute wollten das schöne fromme Mädchen sehen, welches den Königssohn errettet hatte.
Als sie jedoch vor dem Altare standen und die Ringe wechseln sollten, vergaß Heino, dass ihm die rechte Hand fehlte, und er streckte dem Priester den Stumpf hin. Da geschah ein Wunder; denn als der Priester den Stumpf berührte, wuchs aus ihm eine neue Hand hervor, wie eine weiße Blume aus einem braunen Ast. Aber um das Handgelenk lief ein feiner roter Streif, schmal wie ein Faden, herum. Den behielt er sein ganzes Leben.
Richard von Volkmann-Leander
KANNITVERSTAN ...

Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen so gut als in Amsterdam, Betrachtungen über den Unbestand aller irdischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufrieden zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herumfliegen.
Aber auf dem seltsamsten Umweg kam ein deutscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrtum zur Wahrheit und zu ihrer Erkenntnis. Denn als er in diese große und reiche Handelsstadt, voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, fiel ihm sogleich ein großes und schönes Haus in die Augen, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Tuttlingen bis nach Amsterdam noch keines erlebt hatte.
Lange betrachtete er mit Verwunderung dies kostbare Gebäude, die sechs Kamine auf dem Dach, die schönen Gesimse und die hohen Fenster, größer als an des Vaters Haus daheim die Tür. Endlich konnte er sich nicht entbrechen, einen Vorübergehenden anzureden. "Guter Freund", redete er ihn an, "könnt Ihr mir nicht sagen, wie der Herr heißt, dem dieses wunderschöne Haus gehört mit den Fenstern voll Tulipanen, Sternenblumen und Levkojen?" -
Der Mann aber, der vermutlich etwas Wichtigeres zu tun hatte und zum Unglück gerade soviel von der deutschen Sprache verstand als der Fragende von der holländischen, nämlich nichts, sagte kurz und schnauzig: "Kannitverstan" und schnurrte vorüber. Dies war nun ein holländisches Wort, oder drei, wenn man's recht betrachtet, und heißt auf deutsch soviel als: Ich kann Euch nicht verstehen.
Aber der gute Fremdling glaubte, es sei der Name des Mannes, nach dem er gefragt hatte. Das muss ein grundreicher Mann sein, der Herr Kannitverstan, dachte er, und ging weiter. Gass' aus, Gass' ein, kam er endlich an den Meerbusen, der da heißt: Het Ey, oder auf deutsch: das Ypsilon.
Da stand nun Schiff an Schiff und Mastbaum an Mastbaum, und er wusste anfänglich nicht, wie er es mit seinen zwei einzigen Augen durchfechten werde, alle diese Merkwürdigkeiten genug zu sehen und zu betrachten, bis endlich ein großes Schiff seine Aufmerksamkeit an sich zog, das vor kurzem aus Ostindien angelangt war und jetzt eben ausgeladen wurde.
Schon standen ganze Reihen von Kisten und Ballen auf- und nebeneinander am Lande. Noch immer wurden mehrere herausgewälzt, und Fässer voll Zucker und Kaffee, voll Reis und Pfeffer, und einigem Mausdreck darunter. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, der eben eine Kiste auf der Achsel heraus trug, wie der glückliche Mann heiße, dem das Meer alle diese Waren an das Land bringe.
"Kannitverstan" war die Antwort. Da dachte er: Haha, schaut's da heraus? Kein Wunder, wenn das Meer solche Reichtümer an das Land schwemmt, der hat gut solche Häuser in die Weit stellen und solcherlei Tulipanen vor die Fenster in vergoldete Scherben. Jetzt ging er wieder zurück und stellte eine recht traurige Betrachtung bei sich selbst an, was er für ein armer Teufel sei unter soviel reichen Leuten in der Weit.
Aber als er eben dachte: Wenn ich's doch nur auch einmal so gut bekäme, wie dieser Herr Kannitverstan es hat, da kam er um eine Ecke und erblickte einen großen Leichenzug.
Vier schwarz vermummte Pferde zogen einen ebenfalls schwarz überzogenen Leichenwagen langsam und traurig, als ob sie wüssten, dass sie einen Toten in seine Ruhe führten. Ein langer Zug von Freunden und Bekannten des Verstorbenen folgte nach, Paar und Paar, verhüllt, in schwarze Mäntel und stumm. In der Ferne läutete ein einsames Glöcklein.
Jetzt ergriff unseren Fremdling ein wehmütiges Gefühl, das an keinem guten Menschen vorübergeht, wenn er eine Leiche sieht, und blieb mit dem Hut in den Händen andächtig stehen, bis alles vorüber war. Doch machte er sich an den letzten vom Zug, der eben in der Stille ausrechnete, was er an seiner Baumwolle gewinnen könnte, wenn der Zentner um zehn Gulden aufschlüge, ergriff ihn sachte am Mantel und bat ihn treuherzig um Verzeihung.
"Das muss wohl auch ein guter Freund von Euch gewesen sein", sagte er, "dem das Glöcklein läutete, dass Ihr so betrübt und nachdenklich mitgeht." "Kannitverstan" war die Antwort. Da fielen unserem guten Tuttlinger ein paar große Tränen aus den Augen, und es ward ihm auf einmal schwer und wieder leicht ums Herz.
"Armer Kannitverstan", rief er aus, "was hast du nun von allem deinem Reichtum? Was ich einst von meiner Armut auch bekomme: ein Totenkleid und ein Leintuch, und von all deinen schönen Blumen vielleicht einen Rosmarin auf die kalte Brust, oder eine Raute." Mit diesen Gedanken begleitete er die Leiche, als wenn er dazu gehörte, bis ans Grab, sah den vermeinten Herrn Kannitverstan hinabsenken in seine Ruhestätte, und ward von der holländischen Leichenpredigt, von der er kein Wort verstand, mehr gerührt als von mancher deutschen, auf die er nicht Acht gab.
Endlich ging er leichten Herzens mit den anderen wieder fort, verzehrte in einer Herberge, wo man deutsch verstand, mit gutem Appetit ein Stück Limburger Käse, und wenn es ihm wieder einmal schwer fallen wollte, dass so viele Leute in der Welt so reich seien und er so arm, so dachte er nur an den Herrn Kannitverstan in Amsterdam, an sein großes Haus, an sein reiches Schiff und an sein enges Grab.
Johann Peter Hebel
LIBERTAS UND IHRE FREIER ...
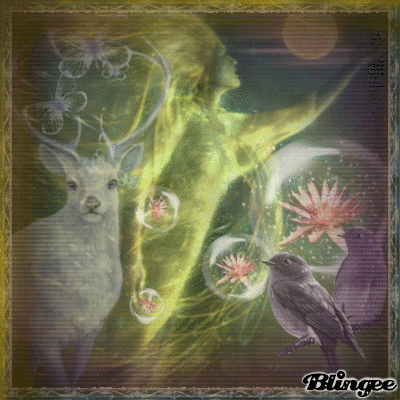
Es war einmal ein Schloss in Deutschland mit dicken Pfeilern, Bogentor und Türmchen, von denen Wind und Regen schon manchen Schnörkel abgebissen hatten. Das Schloss lag mitten im Walde und war sehr verrufen in der ganzen Gegend, denn man wusste nicht, wer eigentlich darin wohnte. Jemand konnte es nicht sein, sonst hätte man ihn doch manchmal am Fenster erblicken müssen; und niemand auch nicht, denn in dem Schlosse hörte man bei Tag und Nacht beständig ein entsetzliches Rumoren, Seufzen, Stöhnen und Zischen, als würde drin die Welt von neuem erschaffen; ja des Nachts fuhr bald da, bald dort ein Feuerschein aus einem der langen Schornsteine oder Fenster heraus, als ob gequälte Geister plötzlich ihre lechzenden Zungen ausstreckten.
Über dem Schlossportal aber befand sich eine überaus künstliche Uhr, die mit großem Geknarre Stunden, Minuten und Sekunden genau angab, aber aus Versehen rückwärts fortrückte und daher jetzt beinahe schon um fünfzig Jahre zu spät ging; und jede Stunde spielte sie einen sinnigen Verein gebildeter Arien zur Veredlung des Menschengeschlechts, zum Beispiel:
"In diesen heil'gen Hallen
Kennt man die Rache nicht -
Und Ruhe ist vor allen
Die erste Bürgerpflicht"
Die benachbarten Hirten, Jäger und andere gemeinen Leute aber waren das schon gewöhnt und fragten nicht viel darnach, denn sie wussten ohnedem von der Sonne schon besser, was es an der Zeit war, und sangen unbekümmert ihre eigenen Lieder. Wer aber recht genau aufpasste, der konnte wirklich zuweilen zur Nachtzeit oder in der schwülen Mittagsstille den Schlossherrn aus dem großen Uhrportal hervortreten und auf den einsamen Kiesgängen des Ziergartens lustwandeln sehen; einen hagern, etwas schiefbeinigen Herrn mit gebogener Nase und langem Schlafrock, der war von oben bis unten mit allerlei Hieroglyphen und Zaubersprüchen verblümt und punktiert und hatte unten einige Zimbeln am Saume, die aber immer gedämpft waren, um ihn nicht im Nachdenken zu stören. Das war aber niemand anders als der Baron Pinkus, der große Nekromant, und die Sache verhielt sich folgendermaßen:
Vor geraumer Zeit und bevor er noch Baron war, hatte der Staatsbürger Pinkus auf dem Trödelmarkte in Berlin den ganzen Nachlass des seligen Nicolai (der damals gerade altmodisch geworden, weil soeben die Romantik aufgekommen war) für ein Lumpengeld erstanden und machte in Ideen. Er war ein anschlägiger Kopf und setzte die Ware ab, wo sie noch rar war. So war er denn eines Tages an das abgelegene Schloss eines gewissen Reichsgrafen gekommen.
Der Graf saß gerade in freudenreichem Schalle an der Mittagstafel mit seinem Stallmeister, Hofmarschall und dem anderen Hofgesind. Da riss es plötzlich so stark an der Hausglocke, dass die Kanarienvögel, Papageien und Pfauen vor Schreck zusammen schrieen und die Puthähne im Hofe zornig zu kollern anfingen.
Der Graf rief: "Wer ist da draußen vor dem Tore?" Der Page rief: "Was wollen Sie, mein Herr?" - "Menschenwohl, Jesuiten wittern und Toleranzen." - Der Page kam: "Dem Menschen ist nicht wohl, er will einen Bitteren oder Pomeranzen." -
"Das verdenk' ich ihm nicht", entgegnete der Graf, "aber geh und frag' noch einmal genauer, wer er sei." - Der Page ging: "Ihr Charakter, mein Herr?" - "Kosmopolit!" - Der Page kam: "Großhofpolyp." -
Das Brockhausische Konversationslexikon war damals noch nicht erfunden, um darin nachschlagen zu können, es entstand daher ein allgemeines Schütteln des Kopfes, und der Graf war sehr neugierig, die neue Hofcharge kennen zu lernen. So wurde nun Pinkus eingelassen und trat mit stolzer Männerwürde in den Saal, und nachdem die notwendigen Bewillkommnungskomplimente zu beiderseitiger Zufriedenheit glücklich ausgewechselt waren, begann er sogleich eine wohlstilisierte Rede von der langen Nacht, womit die schlauen Jesuiten das Land überzogen, kam dann auf den großen Nicolai, wie derselbe, da in dem Stichdunkel alle mit den Köpfen aneinander rannten, in edler Verzweiflung seinen unsterblichen Zopf ergriff, ihn an seiner Studierlampe anzündete und mit dieser Fackel das Volk der Tugendusen, die bloß von Moral leben, siegreich bis mitten in die Ultramontanei führte. -
Hier nahm der Hofmarschall verzweiflungsvoll eine Prise, und verschiedene Kavaliere gähnten heimlich durch die Nase. Aber Pinkus achtete nicht darauf, sondern fing nun an, den besagten Nicolaischen Zopf ausführlich in seine einzelnen philosophischen Bestandteile zu entwickeln.
Das ist ja nicht auszuhalten!" rief der Oberstallmeister mit schwacher, kläglicher Stimme, die anderen stießen schon schlummernd mit ihren Frisuren gegeneinander, dass der Puder stob, die Pfauen draußen hatten längst resigniert die Köpfe unter die Flügel gesteckt, im Vorzimmer schnarchte die umgefallene Dienerschaft fürchterlich auf Stühlen und Bänken.
Es half alles nichts, der unaufhaltsame Pinkus zog immer neue, lange, vergilbte Papierstreifen aus dem erstandenen Nachlass, rollte sie auf und murmelte fort und immerfort von Aufklärung, Intelligenz und Menschenbeglückung. -
"Sapperment!" schrie endlich der Graf voll Wut und wollte aufspringen, aber er konnte nicht mehr, sondern versank mit dem ganzen Hofstaat in einen unauslöschlichen Zauberschlaf, aus dem sie alle bis heute noch nicht wieder erwacht sind.
"Man muss nur haben Verstand!" rief da der böse Nekromant und rieb sich vergnügt die Hände, legte sie aber nicht müßig in den Schoß, denn durch die offenen Türen, da niemand mehr da war sie zuzumachen, kam der Wind daher gepfiffen und griff unverschämt nach seinen Papieren; aus der großen Kristallflasche, die der Hofmarschall beim Einschlafen umgeworfen, war ihm das Wasser in die Schnallenschuhe gestürzt, und die Kerze, woran sie ihre Pfeifen anzuzünden pflegten, flackerte unordentlich und wollte durchaus die seidene Gardine anstecken.
Pinkus aber hatte sie alle schon lange auf dem Korn und eine gründliche Verachtung vor der Luft, dem landstreicherischen Windbeutel, sowie vor dem Wasser, das keine Balken hat und immer nur von Stein zu Stein springen, glitzern, schlängeln und die unnützen Vergissmeinnichts küssen möchte, und vor dem Feuer, das nichts tut, als vertun und verzehren.
Er trat daher entrüstet in den Garten hinaus, zivilisierte ohne Verzug jene ungeschlachten Elemente durch seine weitschweifigen Zaubersprüche, die keine Kreatur lange aushält, und stellte sie dann in dem verstorbenen Schlosse an. In demselben Schlosse aber legte er sofort eine Gedankendampffabrik an, die ihre Artikel zu Benlowskys Zeiten bis nach Kamtschatka absetzte und eben den außerordentlichen Lärm machte, den sich die dummen Leute in der Umgegend nicht zu deuten wussten. So war also der Staatsbürger Pinkus ein überaus reicher Mann und Baron geworden und befand, dass alles gut war.
Seitdem waren viele Jahre vergangen, da gewahrte man in einer schönen Nacht dort in der Gegend ein seltsames Zittern und Blinkern in der Luft, als würde am Himmel ganz was Absonderliches vorbereitet. Die Vögel erwachten darüber und reckten und dehnten noch verschlafen ihre Flügel, da sahen sie droben auch den Adler schon wach und fragten erstaunt:
"Was gibt's, dass vom Horste
An der zackigen Kluft
Der Adler schon steigt
Und hängt überm Forste
In der stillen Luft,
Wenn alles noch schweigt?"
Der Adler aber vernahm es und rief hinab:
"Ich hörte in Träumen
Ein Rauschen gehn,
Sah die Gipfel sich säumen
Von allen Höhn -
Ist's ein Brand, ist's die Sonne,
Ich weiß es nicht,
Aber ein Schauer voll Wonne
Durch die Wälder bricht."
Jetzt schüttelten die Vögel geschwind den Tau von den bunten Wämsen und hüpften und kletterten nun selber in ihrem grünen Hause bis in die allerhöchsten Wipfel hinaus, da konnten sie weit ins Land hinaussehen, und sangen:
"Sind das Blitze, sind das Sterne?
Nein, der Aar hat recht gesehn,
Denn schon leuchtet's aus der Ferne,
Dass die Augen übergehn.
Und in diesen Morgenblitzen
Eine hohe Frau zu Ross,
Als wär' mit den Felsenspitzen
Das Gebirge dort ihr Schloss.
Geht ein Klingen in den Lüften,
Aus der Tiefe rauscht der Fluss,
Quellen kommen aus den Schlüften,
Bringen ihr der Höhen Gruß.
Und die grauen Schatten sinken,
Wie sie durch die Dämmrung bricht,
Und die Kreaturen trinken
Dürstend alle wieder Licht.
Ja, sie ist's, die wir da schauen,
Unsre Königin im Tal!
O Libertas! schöne Fraue,
Grüß' dich Gott vieltausendmal!"
"Habt Dank, meine lustigen Kameraden!" rief da eine wunderliebliche Stimme, die wie ein Glöcklein durch die Einsamkeit klang, und die Lerche stieg sogleich kerzengerade in die Höh' und jubilierte: "Die Libertas ist da, die Libertas ist da!" - es wollt's niemand glauben.
Sie war's aber wirklich, die soeben zwischen dem Gesträuche auf den Schlossberg heraustrat. Sie ließ ihr Rösslein frei neben sich weiden und schüttelte die langen, wallenden Locken aus der Stirn; die Bäume und Sträucher hatten sie ganz mit funkelndem Tau bedeckt, dass sie fast wie eine Kriegsgöttin in goldner Rüstung anzusehen war.
Hinter ihr aber, wo sie geritten, zog sich's wie eine leuchtende Furt durchs Land, denn sie war über Nacht gekommen, der Mond hatte prächtig geschienen und die Wälder seltsam dazu gerauscht, in den Tälern aber schlief noch alles, nur die Hunde bellten erschrocken in den fernen Dörfern, und die Glocken auf den Türmen schlugen von selbst an, wo sie vorüber zog.
"Ich wollte doch auch wieder einmal meine Heimat besuchen", sagte sie jetzt, "die schönen Wälder, wo ich aufgewachsen. Da ist viel abgeholzt seitdem, das wächst sobald nicht wieder nach auf den kahlen Bergen." Nun erblickte sie erst das geheimnisvolle Schloss und den Ziergarten. "Aber wo bin ich denn hier hingeraten?" fragte sie erstaunt.
Es schwieg alles; was wussten die Vögel von dem Baron Pinkus! Es war ihr alles so fremd, sie konnte sich gar nicht zurechtfinden. "Das ist die Burg nicht mehr, wo sonst meine liebsten Gesellen gewohnt. Mein Gott! wo sind die alten Linden hin, unter denen wir damals so oft zusammengesessen?" - Darüber wurde sie auf einmal ganz ernsthaft, trat an den Abhang und sprach laut in die Tiefe hinaus:
"Die gebunden da lauern,
Sprengt Riegel und Gruft,
Du ahnend Schauern
Der Felsenkluft,
Unsichtbar Ringen
In der stillen Luft,
Du träumend Singen
Im Morgenduft!
Brecht auf! schon ruft
Der webende blaue
Frühling durchs Tal."
Und die Vögel jubelten wieder:
"O Libertas, schöne Fraue,
Grüß dich Gott vieltausendmal!"
Da ging erst ein seltsames Knistern und Flüstern durch die Buchsbäume und Spaliere, fast grauenhaft, wie wenn sie heimlich miteinander reden wollten in der großen Einsamkeit, drauf kam von den Waldbergen auf einmal ein Rauschen immerfort wachsend über den ganzen Garten, es war, als stiege über die Hecken und Gitter von allen Seiten verwildernd der Wald herein, die Fontäne fing wie eine Fee mit kristallenen Gewändern zu tanzen an, und Krokus, Tulipanen, Königskerzen und Kaiserkronen kicherten lustig untereinander; im Schloss aber entstand zu gleicher Zeit ein entsetzliches Krachen und Tosen, dass alle Türen und Fenster aufsprangen.
Da kam plötzlich Pinkus, ganz verstört und zerzaust, aus dem Haupttore mit solcher Vehemenz daher geflogen, dass die Schöße seines punktierten Schlafrocks weit hinter ihm drein rauschten. Er wollte vernünftig reden, aber der Frühlingssturm hatte ihn mit erfasst, er musste zu seinem großen Ärger in lauter Versen sprechen und schrie ingrimmig:
"Bin ich selber von Sinnen?
Im Schlosse drinnen
Ein Brausen, Rumoren,
Alles verloren!
Die Wasser, die Winde,
Das Feuer, das blinde,
Die ich besprochen,
Wild ausgebrochen,
Die rasen und blasen
Aus feurigen Nasen
Mit glühenden Blicken
Brechen alles in Stücken!"
Hier stutzte er auf einmal, er hatte die Libertas erblickt, da schoss ihm plötzlich das Blatt. Er kannte sie zwar nicht von Person, aber der schlaue Magier wusste nun sogleich, wer die ganze Verwirrung angerichtet. Ohne Verzug schritt er daher auf sie los und forderte ihren Pass. Sie betrachtete ihn von oben bis unten, er sah vom Schreck so windschief und verschoben aus; sie musste ihm hellauf ins Gesicht lachen.
Da wurde er erst recht wild und rief die bewaffnete Macht heraus, die sich nun von allen Seiten mit großer Anstrengung mobil machte, denn der Friedensfuß, auf dem sie solange gestanden, war ihr soeben etwas eingeschlafen. Libertas stand unterdessen wie in Gedanken und wusste gar nicht, was die närrischen Leute eigentlich wollten. Doch sie sollte es nur zu bald erfahren.
Pinkus befahl, die gefährliche Landstreicherin im Namen der Gesittung zu verhaften. Sie ward eiligst wie ein Wickelkind mit Stricken umwunden und ihr, in gerechter Vorsicht, darüber noch die Zwangsjacke angelegt. Da hätte man sehen sollen, wie bei dieser Arbeit manchem würdigen Krieger eine Träne in den gewichsten Schnurrbart herabperlte; aber der Patriotismus war groß, und Stockprügel tun weh. So wurde Libertas unter vielem Lärm in das mit dem Schlosse verbundene Arbeitshaus abgeführt.
Pinkus aber, nachdem er sich von der Alteration einigermaßen wieder erholt hatte, schrieb sogleich ein großes Renaissancefest aus, das in einem feierlichen Aufzuge aus dem chinesischen Lusthause nach dem Schloss bestand und wohl einer würdigeren Feder wert wäre. Da sah man nämlich zuerst zwölf weiß gekleidete Mädchen, eine hinter der anderen vorschreitend, in den chinesischen Saal hereinschweben, sie trugen auf ihren Achseln eine wunderliche Festgabe, die wie eine lange Wurst oder wie ein gräulicher Wurm aussah.
Damit traten sie in einer Reihe vor Pinkus, stellten sich auf das eine Bein und streckten das andere anmutsvoll in die Luft, während eine jede die rechte Hand auf ihr Herz legte, mit der linken aber das langschweifige Weihopfer hoch in die Höhe hob und alle lieblich dazu sangen:
"Wir bringen dir der Treue Zopf
Von eigner Locken Seide,
Lang' trag ihn dein erhabner Kopf
Zu deines Landes Freude,
Kopf, Zopf und Lockenseide!"
Es war wirklich ein ungeheurer Zopf, den sie eiligst aus ihren eigenen Locken zusammen gewunden hatten. Der gerührte Pinkus riss sich sofort den Haarbeutel vom Haupt, verehrte ihn unter angemessenen Worten den Jungfrauen, um ihn als teures Andenken in dem Prüfungssaale ihrer Pensionsanstalt aufzuhängen, und ließ sich dann den patriotischen Zopf im Genick befestigen, was sich sehr feierlich ausnahm, denn er schleppte ihn hinten etwas nach, so dass ihm jeder drei Schritt vom Leibe bleiben musste, um nicht unversehens darauf zu treten.
Jetzt aber begann der Zug durch den Garten. Voran schritten, wie eine Schar schneeweißer Gänse, die glücklichen Jungfrauen mit dem Haarbeutel auf sammetnem Kissen, ihnen folgte der Haushofmeister, an dessen Allongeperücke in der feuchten Abendluft die Locken aufgegangen waren und wie ein Fürstenmantel fast bis an die Fersen herab fielen, endlich kam Pinkus selbst, dem der Kammerdiener den Zipfel des Opferzopfes ehrerbietig nachtrug.
Auch der Ziergarten, der seit Libertas gebunden war, hatte unterdes seine vorige würdige Haltung wiedergewonnen, und wo Pinkus vorüber schritt, präsentierte der marmorne Herkules mit seiner Keule, der geigende Apollo salutierte mit dem Fiedelbogen, und die Tritonen in den steinernen Becken bliesen auf ihren Muscheln aus Leibeskräften: Heil dir im Siegerkranz!
Die Geschichte machte damals großes Aufsehn in Deutschland. Die Schwalbe schoss ängstlich hin und her und schwatzte, und schrie von allen Dächern und Zäunen: "Weh, weh, Frau Libertas ist gefangen!" Die Lerche stieg sogleich wieder kerzengerade in die Höh' und meldete es dem Adler, die Nachtigall schluchzte und konnte sich gar nicht erholen, selbst der Uhu seufzte einige Male tief auf; die Rohrdommel aber trommelte sofort Alarm, und der Storch marschierte im Paradeschritt durch alle Wiesen und Felder und klapperte unablässig zum Appell.
Bald wurde es auch weiter im Walde lebendig; der Hase duckte sich im Kohl und mochte von der ganzen Sache nichts wissen, der Fuchs wollte erst abwarten, welche Wendung sie nehmen würde; der biedere Bär dagegen ging schnaubend um und wurde immer brummiger, und die Hirsche rannten verzweiflungsvoll mit ihren Geweihen gegen die dicksten Eichen oder fochten krachend miteinander, um sich in den Waffen zu üben.
Da kam zur selben Stunde der Doktor Magog daher gewandert, der seinen Verleger nicht finden konnte und daher soeben in großer Verlegenheit war. Der hörte mit Verwunderung das ungewöhnliche Geschrei der Vögel; durch einen entflogenen Star, der reden gelernt, erfuhr er alles, was geschehen, und wollte aus der Haut fahren über diese Nachricht.
"Ha!" rief er, und dabei fuhr ihm wirklich der Ellbogen aus dem Ärmel. Aber sein Entschluss war sogleich gefasst: er wandte sich eiligst seitwärts nach dem Walde hin. Da erblickte ihn ein Köhler von fern und rief ihm zu, wohin er ginge. - "Zum Urwald", erwiderte Magog. - "Seid Ihr toll?" schrie der Köhler wieder herüber:
"Kehrt um auf der Stelle,
Dort steht ein Haus,
Da brennt die Hölle
Zum Schornstein heraus,
Und auf der Schwelle
Tanzt der Teufel Kehraus."
"Lasst ihn tanzen!" entgegnete Magog und schritt stolz weiter. Der fromme Köhler sah ihm nach, bis er im Walde verschwunden war. "So gnade ihm Gott", sagte er dann und schlug ein Kreuz. Magog aber räsonierte noch lange innerlich: "Abergläubisches Volk, das im Mittelalter und in der Religion stecken geblieben! Darum wächst auch der Wald hier so dumm ins Blaue hinein, dass man keinen vernünftigen Fortschritt machen kann."
So war er eine Weile durch das Dickicht vorgedrungen, als er unverhofft eine dünne Gestalt sehr eilfertig auf sich zukommen sah. Es war eine lange, hagere alte Dame in ganz verschossenem altmodischem Hofstaat, das graue Haar in lauter Papilloten gedreht, wie ein gespickter Totenkopf, die hatte unter jedem Arm eine große Pappschachtel, hielt mit der einen Hand ein zerrissenes Parasol über sich und stützte sich mit der anderen auf einen Haubenstock, - "Ist das der rechte Weg zum Urwald?" fragte Magog. -
"Gewiss, leider, mein Herr", erwiderte die Dame, sich feierlich verneigend. "Ja", setzte sie darin mit außerordentlicher Geschwindigkeit in einem Striche fortredend hinzu - "ja, diese bäuerische ungesittete Nachbarschaft macht sich von Tag zu Tag breiter, besonders seit einigen Tagen, man sagt, die famose Libertas sei wieder einmal in der Luft, es ist nicht mehr auszuhalten in dieser gemeinen Atmosphäre, keine Gottesfurcht mehr vor alten Familien, aber ich habe es meinem hochseligen Herrn Neveu immer vorausgesagt, das war auch so ein herablassender Volksfreund, wie sie es nennen, ja das eine Mal embrassierte er sich gar mit dem Pöbel, da haben sie ihn jämmerlich erdrückt, und nun gar wir Jungfrauen sind beständigen Attacken ausgesetzt, und so sehe ich mich soeben bemüßigt zu emigrieren; o Sie glauben gar nicht, mein Herr, was so eine arme Waise von Distinktion sich zerärgern muss in der gegenwärtigen Abwesenheit aller Tugenden von Stande!"
Hier kam sie vor großem Eifer ins Singen und machte plötzlich einen langen, feinen Triller wie eine verdorbene Spieluhr, bis sie sich endlich ganz verhustete. Magog, der ihr voll Erstaunen zugehört, brach in ein schallendes Gelächter aus. Darüber geriet die Dame in solchen Zorn, dass sie verächtlich und ohne Abschied zu nehmen eiligst weiter emigrierte. -
"Ohne Zweifel die Urtante, da kann ich nicht mehr weit haben", dachte Magog und schritt getrost wieder vorwärts. Bald aber verlor sich der Fußsteig vor seinen Füßen, der Forst wurde immer wilder und dichter, von fern nur sah er eine seltsame Rauchsäule über die Wipfel aufsteigen; da gedachte er der Warnung des Köhlers und des wüsten Hauses, aus dem die Hölle brennen sollte. Aber ein rauchender Schornstein war ihm von jeher ein anziehender Anblick, und so klomm er mühsam eine Anhöhe hinan, um das ersehnte Haus zu entdecken.
Doch zu seinem Schrecken bemerkte er, dass es ringsum bereits zu dunkeln anfing. Jetzt begann es auch unten am Boden schon sich geheimnisvoll zu rühren, Eidechsen raschelten durch das trockene Laub, die Fledermäuse durchkreuzten mit leisem Flug die Dämmerung, aus den feuchten Wiesen krochen und wanden sich überall träg ringelnd lange Nebelstreifen und hingen sich an die Tannenäste wie Trauerflöre, und als Magog endlich droben ins Freie trat, stieg die kühle stille Nacht über die Wälder herauf und bedeckte alles mit Mondschein.
Auch die Rauchsäule konnte er nicht mehr bemerken, es war, als hätte die fromme Nacht die Hölle ausgelöscht. Da beschloss er, hier oben den Morgen abzuwarten, streckte sich auf das weiche Moos hin, schob sein mit Manuskripten voll gepfropftes Reisebündel unter den Kopf, betrachtete dann noch eine Zeitlang die zerrissenen Wolken, die über ihm dahin jagten und manchmal wie Drachen nach dem Monde zu schnappen schienen, und war endlich vor großer Müdigkeit fest eingeschlafen.
So mochte er eine geraume Zeit geruht haben, da meinte er mitten durch den Schlummer ein Geflüster zu vernehmen und dazwischen ein seltsames Geräusch, wie wenn ein Messer auf den Steinen gewetzt würde. Die Stimmen kamen immer näher und näher. "Er schläft", sagte die eine, "jetzt ist's die rechte Zeit." -
"Ein schlechter Braten", entgegnete eine andere tiefe Stimme, "er ist sehr mager, hab' seinen Futtersack untersucht, den er unterm Kopfe hat, er lebt bloß von Papier." - Nun schien es dem Magog, als hörte er auch die emigrierte Tante leise und eifrig dazwischenreden in verschiedenen unbekannten Sprachen, die anderen antworteten ebenso, die Wipfel rauschten verworren drein, auf einmal schlug sie wieder ihren schrillenden Triller.
Da sprang Magog ganz entsetzt auf - es war ein heiserer Hahn, der fern im Tale krähte. Verstört blickte er um sich, der Morgen blitzte zu seinem Erstaunen schon über die Wälder, er wusste nicht, ob ihm das alles nur geträumt oder sich wirklich ereignet hatte.
Jetzt sah er auch die Rauchsäule von gestern wieder empor wirbeln, er hielt es für einen unverhofften Feuer speienden Berg. Als er indes näher kam, erkannte er, dass es nur eine ungeheure Lehmhütte war, in welcher wahrscheinlich das Frühstück gekocht wurde. In diesen tröstlichen Gedanken ging er also unaufhaltsam darauf los.
Auf einmal aber blieb er ganz erschrocken stehen. Denn auf dem Rasenplatze vor der Hütte war ein Riesenweib wahrhaftig soeben damit beschäftigt, ein großes Schlachtmesser zu wetzen. Sie schien ihn nicht zu bemerken oder weiter nicht zu beachten, weil er so klein war, und in dem selben Augenblick brachen auch mehrere Riesenkinder mit großem Geschrei aus der Hütte und zankten und würgten und rauften untereinander, dass die Haare davon flogen.
Über diesem Lärme aber erhob sich plötzlich eine wunderbare, baumlange Gestalt und gähnte, dass ihr die Morgensonne bis tief in den Schlund hinein schien. Der Mann war gräulich anzusehen, ungewaschen und ungekämmt, wie ein zerzaustes Strohnest, und hatte eine ungeheure Wildschur an, die war aus lauter Lappen und Fetzen von Fuchsbalg, wilden Schweinshäuten und Bärenfellen zusammengeflickt. -
"Herr Rüpel?!" rief da Magog in freudigem Erstaunen. - "Wer ruft mich?" erwiderte der Riese noch halb im Schlafe und sah den Fremden verwundert an. - "Sie eben hab' ich aufgesucht", entgegnete Magog, "eine höchst wichtige Angelegenheit." - Aber Rüpel hatte gerade mit der Kindererziehung zu tun. "Hetzoh!" schrie er den Jungens zu, die noch immerfort rauften, "du da wirst dich doch nicht unterkriegen lassen, frisch drauf!" Dann streckte er unversehens sein langes Bein vor, da stürzten und kollerten die Verbissenen plötzlich verworren übereinander, während die Riesenmutter voller Zorn ihren Kehrbesen mitten in den Knäuel warf. Darüber kamen alle in ein so herzhaftes Lachen, dass der Wald zitterte.
Da nun Magog die Familie in so guter Laune sah, fasste er sich ein Herz und rückte sogleich mit seinem eigentlichen Plane heraus. "Herr Rüpel", sagte er, "ich bin ein Biedermann und kenne kein Hofieren und keinen Hof, als den Hühnerhof meiner Mutter, aber das muss ich Ihnen rund heraussagen: Ihre Macht und Gesinnungstüchtigkeit ist durch ganz Europa ebenso berühmt als geschätzt und ebenso geschätzt als gefürchtet. Darum wende ich mich vertrauensvoll an Ihr großes Herz und rufe: Wehe und abermals wehe! die Libertas ist geknechtet! - wollen wir das dulden?" -
"Libertas? wer ist die Person?" fragte Rüpel. - "Libertas?" erwiderte Magog, "Libertas ist die Schutzpatronin aller Urwälder, die Patronin dieses langweiligen - wollte sagen: altheiligen Waldes?" "I bewahre", fiel ihm hier die Riesin ins Wort, "unsere Grundherrschaft ist das gnädige Fräulein Sibylla da draußen." - "Was? die mit den Papilloten und großen Haubenschachteln?" rief Magog, den dieser unerwartete Einwurf ganz aus dem Konzept gebracht hatte. Aber er fasste sich bald wieder.
"Grundherrschaft!" fuhr er fort, "schützt die Grille Krokodile, der Frosch das Rhinozeros, der Weißfisch den Haifisch? - Wer die Macht hat, ist der Herr, und Ihr habt die Macht, wenn die Libertas regiert, und habt die Macht nicht, wenn die Libertas gefangen ist, und die Libertas ist gefangen - ich frage also nochmals, wollen wir das dulden?"
Hier aber wurde er, da er eben im besten Zuge war, durch einen seltsamen Auftritt unterbrochen. Ein Reiher kam nämlich pfeilschnell daher geschossen, setzte sich gerade auf seinen zerknitterten Kalabreser, drehte ein paar Mal mit dem dünnen Halse, verneigte sich dann feierlich vor der Gesellschaft und sagte: "Sie lassen alle ihren Respekt vermelden und es tut ihnen sehr leid, aber sie können heut und morgen nichts bringen, wir haben alle außerordentlich Wichtiges zu tun; schönen guten Morgen!" Und damit sich abermals höflich verneigend, schwang er sich wieder in die Lüfte. -
"Guten Morgen, Herr Fischer", erwiderte Rüpel, ihm ganz verblüfft und mit einer verzweifelten Resignation nachschauend. Jetzt sah man auf einmal auch einen ungeheuren Schwarm wilder Gänse über den Wald fortziehen, einen alten gewiegten Gänserich voran, alle die Hälse wie Lanzen weit vorgestreckt und in einem spitzen Keile dahinstürmend, als wollten sie den Himmel durchbrechen, und dabei machten sie ein so entsetzliches kriegerisches Geschreie, dass man sein eigenes Wort nicht hören konnte.
Währenddes aber hatte der eine Riesenknabe sich mit dem Ohre auf den Boden gelegt und sagte: "Draußen im Grunde hör' ich ein groß' Getrampel, man kann die Tritte deutlich unterscheiden: Hirsche, Auerochsen, Bären, Damhirsche, Rehe, zieht alles wild durcheinander den großen See entlang." -
"Die Tollköpfe!" rief die Riesenmutter aus, "da haben sie gewiss wieder Verdruss gehabt mit dem gnädigen Fräulein und haben unseren guten Wald in Verruf getan und wandern aus; denn das Fräulein ist ihnen immer spinnefeind gewesen und ließ sie mit Hunden hetzen und schinden und braten obendrein."
"Nein, nein, die alte Spinne ist ja selber ausgewandert, ich bin ihr gestern begegnet", sagte Magog voll Verwunderung, "aber warum nehmen Sie sich denn die Sache so sehr zu Herzen, teuerste Frau von Rüpel?"
"Wie sollt' ich nicht!" erwiderte die Riesin, "ach wir armen Waldleute müssen uns gar kümmerlich durchhelfen mit der großen Familie. Sehen Sie, lieber Herr, ich und mein Mann arbeiten hier für die vornehmen Tiere: Hirsche, Rehe und anderes Hochwild um Tagelohn, den wir von ihnen in Naturalien beziehen. Des Abends spricht mancher Edelhirsch bei uns ein, wenn er nachts auf die Freite gehen will, da muss ihm mein Mann die Pelzstiefelchen putzen, dafür erhalten wir denn die Felle der verunglückten Kameraden und die abgeworfenen Geweihe in die Wirtschaft.
Alle Morgen aber kommen die Bären und lassen sich ihre Pelze ausklopfen und bringen uns große Honigfladen, oder ein paar wilde Schweine lassen sich ihre Hauer schleifen und werfen uns zum Dank einen fetten Frischling auf die Schwelle, denn die Zeiten sind schlecht, da kommt es ihnen auf ein Kind mehr oder weniger nicht an. Ich aber flechte Nester für die Adler, Habichte und Auerhühner, und die lassen uns dann im Vorüberfliegen einen Hasen oder ein Zicklein herunterfallen oder legen uns nachts einige Schock Eier vor die Tür, wenn sie eben nicht Lust haben, alle auszubrüten.
Und nun - ach das große Unglück! jetzt haben wir unsere Kundschaft verloren und stehen ganz verlassen in der Welt, o! o!" - und hier fing sie jämmerlich zu heulen an, und der Riese, der sich lange gehalten, stimmte plötzlich furchtbar mit ein.
Da trat Magog mannhaft mitten unter sie. "Das soll bald anders werden!" rief er; "kennt ihr das Schloss des Baron Pinkus?" Der Riese entgegnete, er habe es wohl von fern gesehen, wenn er manchmal zur Unterhaltung bis all den Rand des Waldes gegangen, um die Köhler und andere kleine Leute zu schrecken. -
"Nun gut", fuhr Magog fort, "dort eben sitzt die Libertas gefangen. Seht, mich hat auch die Welt nur auf elende Lorbeeren gebettet, dass ich mir an dem stacheligen Zeug schon den ganzen Ärmel am Ellbogen durchgelegen; darum habe ich ein Herz für das arme Riesenvolk. Die Libertas ist eine reiche Partie, wir müssen sie befreien! Dabei kann es vielleicht einige Püffe setzen, was frag'ich darnach! Ihr habt ja ein dickes Fell, alles für meine leidenden Brüder! Mit einem Wort: Ihr befreit sie und ich heirate sie dann und Ihr seid auf dem Schlosse Portier und Schloßwart und Haushofmeister, eh' man die Hand umdreht. Topp, schlagt ein - aber nicht zu stark, wenn ich bitten darf."
Darüber war Rüpel ganz wild geworden und schritt, ohne ein Wort zu sagen, so eilig in die Hütte, dass Magog nur mühsam und mit vorgehaltenen Händen tappend folgen konnte. Denn sie stiegen über viele ungeschickte Felsenstufen in eine große Höhle hinab, über welcher der Berg, den Magog für die Hütte gehalten, nur das Dach und den Schornstein bildete.
Im Hintergrunde der Höhle hing ein Kessel über dem Feuer, ein zahmer Uhu mit großen funkelnden Augen saß in einem Felsenspalt daneben und fachte mit seinen Flügeln die Flamme an und schnappte manchmal nach den Fledermäusen, die geblendet nach dem Feuer flogen.
Die Flamme warf ein ungewisses Licht über die rauen und wunderlichen Steingestalten umher, die bei den flackernden Widerscheinen sich heimlich zu bewegen schienen, und mächtige Baumwurzeln drängten sich überall wie Schlangen aus den Wänden, in der Tiefe aber hörte malt ein Picken und Hämmern und unterirdische Wasser verborgen gehen, und dazwischen rauschte der Wald immerfort durch die offene Tür herein. Rüpel aber rumorte eifrig in der Höhle herum, er schien allerlei zusammenzusuchen. Auf einmal wandte er sich zu Magog: "Und damit Punktum, ich gehe mit auf die Befreiung!"
Da nun die Riesin merkte, wo das alles eigentlich hinauswollte, wurde sie plötzlich ganz empfindlich und nannte ihren Mann einen alten Bummler und den Magog eitlen verlaufenen Schnappsackspringer, der nur gekommen, das häusliche Familienglück zu stören. Vergebens hielt ihr Magog den Patriotismus und den gebieterischen Gang der neuen Weltgeschichte entgegen.
Sie behauptete, sie hätten schon hier im Hause Geschichten genug und nicht nötig, noch neue zu machen, und die ganze Geschichte ging die Welt gar nichts an! So entspann sich unversehens ein bedenklicher Streit. Rüpel fluchte, die Riesin zankte, die Kinder schrieen, und draußen war von dem Lärm das Echo aus dem Morgenschlummer erwacht und schimpfte immerfort mit drein, man wusste nicht, ob auf Rüpel, auf Magog oder auf die Riesin.
Da hob sich auf einmal im Boden ein Stein dicht neben Magog, der erschrocken die Beine einzog, denn er meinte, es wollte ihn ein Riesenmaulwurf in die Zehen beißen. Es war aber nur eine heimliche Falltür, und aus dieser fuhr mit halbem Leibe ein winziges Kerlchen mit altem Gesicht und spitzer Mütze zornig empor:
"Was macht ihr heute hier oben wieder für ein gräuliches Spektakel", sagte er mit seiner dünnen Stimme, "wenn ihr nicht manierlich seid, kündigen wir euch die Miete auf!" Dabei tat es einen glühenden Blick aus der Tiefe herauf, und Magog konnte durch die Öffnung weit hinabschauen.
Da sah er unzählige kleine Wichte, jedes eine Grubenlampe auf dem Kopf, in goldenen Eimern wundersam singend auf und nieder schweben, und ganz unten blitzte und funkelte es bei den vielen irrenden Lichtern von Diamanten, Kristallen und Saphiren wie ein prächtiger Garten. -
"Um Gottes willen", rief die Riesin ihm leise und ängstlich zu, "schaut nicht so hin, man wird wahnsinnig, wenn man lange da hinuntersieht; das sind unsere Hausherren, die Zwerge und Grubenleute, die unter uns wohnen und uns diese Dachkammer für ein Billiges überlassen haben."
Aber Rüpel, dem noch der vorige Zank in den Gliedern steckte, hatte schon mit dem Fuße nach dem Zwerglein gestoßen und hätte es sicherlich zertreten, wenn es nicht fix wieder untergeduckt und den Stein hinter sich zugeklappt hätte.
Sodann ergriff Rüpel rasch seinen knotigen Wanderstab, warf einen Sack über die Schultern und stand in seinen Pelzhäuten wie eine Kürschnerbude reisefertig in der Tür. Da hätte man nun die feierliche Abschiedszene sehen sollen, die wohl geeignet war, ein fühlendes Herz mit den sanftesten Regungen zu erfüllen!
Die Riesin hing mit aufgelöstem Haar am Halse des geliebten Mannes und schluchzte außerordentlich: auch von seinem gerechten Schmerze zeugte eine ungeheure Träne im Auge, die lieben Kleinen umklammerten kindlich lallend die Knie ihres verehrten Erzeugers, da hörte man nichts, als die süßen Namen: Papa und teurer Gatte und treue Lebensgefährtin! Aber Rüpel zerdrückte die Träne und riss sich los wie ein Mann.
"Weib, du sollst von mir hören!" rief er und schritt majestätisch in den Wald hinein, und Magog versäumte nicht, ihm auf das allereilfertigste nachzufolgen, denn hinter ihnen hörte er noch immer die Stimme der verwaisten Familienmutter und konnte nicht recht unterscheiden, ob sie noch immer weinte oder etwa von neuem schimpfte.
Endlich war alles verhallt, man vernahm nur noch den Tritt der einsamen Wanderer. Magog bemerkte mit vieler Genugtuung den langen Fortschritt seines Reisekumpans, und da er seinen Rücken recht betrachtete, freute er sich dieser breitesten Grundlage und lud ihm auch noch sein eigenes Ränzel mit auf, das freilich nicht sonderlich schwer war. Durch die Wildnis aber wehte ihnen ein kräftiger Waldhauch entgegen, da wurden beide ganz lustig. Rüpel erzählte, wie er eigentlich von dem berühmten deutschen Bärenhäuter abstamme. Magog aber stimmte sein Lieblingslied an:
"Von des Volkes unverjährbaren Rechten
Und der Tyrannen Attentaten,
Die die Völker verdummen und knechten,
Fürsten und Pfaffen und Bureaukraten."
"Und Bier und Braten!" fiel hier Rüpel jubelnd mit ein. - "Haben Sie etwas mit?" wandte sich Magog rasch herum. Rüpel schüttelte mit dem Kopfe. - "Ha, also nur immer vorwärts, vorwärts!" ermutigte Magog.
Über dem Singen und den vergnügten Gesprächen aber hatte Rüpel unvermerkt den rechten Weg verloren. Vergebens bestieg er nun jeden Berg, dem sie begegneten, um sich wieder zurechtzufinden; man sah nichts als Himmel und Wald, der wie ein grünes Meer im frischen Winde Wellen schlug, so weit die Blicke reichten. Und fragen konnten sie auch niemand. Denn der Lärm, den sie unterwegs machten, war groß, und wo sie etwa ein einsamer Hirt oder Jäger hörte und des erschrecklichen Riesen ansichtig wurde, entfloh er sogleich oder verbarg sich im dicksten Gebüsch, bis sie vorüber waren. So irrten sie den ganzen Tag umher.
Des Abends, da sie schon sehr hungrig waren, kamen sie endlich an eine anmutige Anhöhe, an der unten ein Fluss vorüberging. Jenseits des Flusses aber lag ein weiter wüster Platz, rings vorn finstern Walde eingeschlossen, und auf dem Platze lagen einzelne Felsblöcke zerstreut, wie Trümmer einer verfallenen Stadt, was sehr einsam anzusehen war. Auf dieser Höhe machte Rüpel plötzlich Halt und ließ den Magog seitwärts zwischen das Gebüsch treten und sich dort ganz still verhalten.
Er selbst aber setzte sich mitten auf die Höhe, zog sein haariges Wams, gleich einer Nebelkappe, aus der nur seine großen Augen hervorfunkelten, bis über den Kopf herauf, kniff aus den Fellen ein paar seltsame Ohren darüber und breitete mit beiden Armen den Pelzmantel aus wie zwei Flügel, so dass er wie eine ungeheure Nachteule aussah. Es dauerte auch nicht lange, so kamen von allen Seiten die schreckhaften Vögel, wilde Auerhühner, Birkhähne und Fasanen mit großem Geschrei herbei und stießen und hackten auf das Ungetüm; und als der Schwarm am dicksten, schlug er rasch beide Pelzflügel über ihnen zusammen und schob alles in seine weitläufigen Manteltaschen. -
"Das hab' ich von meinem Urgroßvater Kauzenweitel gelernt", rief er sehr zufrieden aufstehend zu Magog hinüber. Dann ging er zu dem Fluss hinab und streckte sich unter dem hohen Schilfe platt auf den Leib am Ufer hin. Magog meinte, er sei durstig und wolle den Fluss austrinken; aber Rüpel ließ bloß seinen verworrenen Bart ins Wasser gleiten, den hielten die klügsten Hechte und die breitmauligsten Karpfen für spielendes Gewürm, und so oft sie danach schnappten, schnappte Rüpel auch nach ihnen und hatte gar bald mehrere Mund voll auserlesene Fische aufs Trockne gebracht.
Darauf kehrte er wieder zu Magog zurück, holte aus seinem Reisesack einen Feldkessel, Bratspieß, Messer und Gabeln hervor und schlug sich mit der Faust auf beide Augen, dass es Funken gab. Daran zündete er ein großes Feuer an und fing sogleich mit vielem Eifer zu kochen und zu braten an; und eh' es noch dunkel wurde, saßen beide Wanderer um die lustige Flamme gelagert und schmausten in freudereichem Schalle.
Unterdes war die Nacht herangekommen, in dem Feuer neben ihnen flackerte nur noch manchmal ein blaues Flämmchen auf; sie richteten sich daher in dem trocknen Laube, so gut es gehen wollte, zur Ruhe ein und waren auch beide sehr bald eingeschlafen. Es mochte aber noch lange nicht Mitternacht sein, als Magog wie in seiner ersten Reisenacht, wieder ein seltsames Rauschen und Murmeln vernahm, das bald schwächer, bald wieder lauter wurde, fast wie das verworrene Brausen einer fernen Stadt.
Er richtete sich mit halbem Leibe auf, aber diesmal war es kein bloßer Traum. Denn obgleich der Mond zwischen vorüberjagendem Gewölk den wüsten Platz jenseits des Flusses nur flüchtig beleuchtete, so konnte er doch zu seinem Erstaunen deutlich bemerken, dass der Platz jetzt ganz belebt war.
In einem weiten Halbkreise am Waldrande drüben lagen nämlich, dicht Kopf an Kopf gereiht, zahllose Auerochsen, zunächst hinter ihnen standen Rehe und Damhirsche, über diese hinweg starrte dann ein ganzer Wald von Hirschgeweihen, und weiterhin noch bis tief in die Schatten des Waldes schien es verworren zu wimmeln und zu drängen, denn sooft ein Mondstrahl das Dunkel streifte, sah man da und dort den Kopf eines Einhorns oder bärtigen Elens sich abenteuerlich hervorstrecken, und zwischen ihren Beinen Marder, Iltis und andere geringe Tiere geschäftig hin und her schlüpfen.
Selbst die Bäume, die den Platz von der einen Seite umschlossen, waren von allerlei großen und kleinen Vögeln bedeckt, dass sie aussahen wie Weinstöcke im Herbst, und man nicht wusste, was Blatt oder Vogel war, rings um den Platz aber machten Störche ernsthaft die Runde und hoben die langen Schnäbel gegen den Wind, ob etwa von fern ein Feind nahe.
"Aha, das sind gewiss die Tiere, die der Riesenknabe schon heute früh in der Ferne hat marschieren gehört", dachte Magog und wollte, als er sich vom ersten Erstaunen ein wenig erholt, geschwind den Rüpel wecken und rüttelte und schüttelte ihn mit großer Anstrengung aus Leibeskräften. Der tat aber nach der guten Mahlzeit einen schweren Schlaf, er hob bloß den Kopf in die Höh' und glotzte ihn an, ohne etwas zu sehen, dann wälzte er sich auf die andere Seite und schnarchte so schrecklich weiter, dass von dem Atem die nächsten Bäume sich auf und nieder bogen.
Nun schaute Magog still und unverwandt nach dem Platze hinüber, denn er war sehr neugierig, was die Tiere in dieser Einsamkeit eigentlich vor hätten. Da sah er, wie ein Auerochs plötzlich aus der vorderen Reihe brach, mit einem gewaltigen Satze auf einen der umherliegenden Steinblöcke sprang und, nachdem er mit seinem zottigen Haupte sich dreimal vor der Versammlung verneigt, sofort eine donnernde Rede begann.
Dabei brüllte er mitten im Sprechen oft plötzlich furchtbar auf, scharrte mit dem einen Vorderfuß, ringelte wütend den Schweif in die Luft und schüttelte die Mähne, dass man beim Mondschein seine rotglühenden Augen rollen sah. Magog konnte nichts davon verstehen, aber die Rede musste sehr hinreißend sein, denn als er endlich von dem Steine wieder zu seinen Kameraden zurücksprang, ging ein freudiges Brüllen, Schnurren und Scharren durch die ganze Versammlung, und alle Hirsche schlugen mutig mit ihren Geweihen zusammen.
Darauf hatte ein Bär das Wort erhalten. Auch dieser kletterte bedächtig auf einen der Steine herauf, stellte sich auf die Hinterbeine und streckte während seiner Ansprache bald das eine, bald das andere Vorderbein weit vor sich aus, dann legte er die eine Tatze an sein Herz - er konnte vor Rührung nicht weiter und musste abtreten.
Jetzt ließ sich unerwartet aus irgendeinem dunklen Winkel ein Uhu auf dem Steine nieder. Das wollten die anderen Vögel durchaus nicht leiden, ja ein kecker Nußhäher schoss plötzlich hervor und hackte nach ihm, aber die wachhabenden Störche stellten klappernd sogleich die Ruhe wieder her. Nun schüttelte der Uhu seine Federn auf, dass er aussah wie eine Allongeperücke, klappte zum Gruß dreimal mit dem Schnabel, setzte eine Brille auf und fing aus einem Blatte, das er mit der einen Klaue vor sich hielt, zu lesen an.
Er schien alles sehr weitläufig und gründlich auseinanderzusetzen, denn die ganze Gesellschaft hörte dem gelehrten Redner so aufmerksam zu, dass man dazwischen das Wiederkäuen der Ochsen vernehmen konnte; nur die ungeduldigen Vögel in den Bäumen, die nun einmal ärgerlich geworden, störten leider zuweilen die feierliche Stille durch plötzliches ungebührliches Schreien und Raufen.
Unterdes aber ging die Vorlesung ohne Komma und ohne Punktum in einem Tone immer fort und fort, wie murmelnde Bäche und spinnende Kater, und Magog wusste nicht, wie lange die Rede gedauert, denn ehe sie noch ihr Ende erreicht hatte, war er über dem einförmigen Gemurmel, so sehr er sich auch dagegen sträubte, unaufhaltsam eingeschlummert.
Er hätte auch wahrscheinlich bis in den Tag hinein geschlafen, wenn ihn nicht mitten in der Nacht Rüpel auf einmal durch unablässiges Rufen geweckt hätte. Sein erster Blick fiel auf den geheimnisvollen Platz drüben, der war aber, als wäre eben nichts geschehen, wieder so still und einsam wie gestern. Rüpel aber verzehrte bereits mit großem Appetit die Überbleibsel vom gestrigen Mahle und hatte auch ein gut Stück davon für Magog zurückgelegt.
Da dieser ihm nun erzählte, was er in der Nacht jenseits des Flusses gesehen, gab Rüpel wenig darauf und meinte, das sei ohne Zweifel eine geheime Verschwörung, da kümmere er sich nicht darum, wenn er nur sein Auskommen habe. Mit dem Auskommen aber stehe es heute gerade sehr schlimm. Er habe nämlich jetzt erst an den Gestirnen die rechte Richtung erkannt, sie seien ganz auf den Holzweg geraten und hätten noch weit zu gehen. In dieser Richtung gebe es jedoch keinen Fluss, um darin zu fischen, und mit dem vom seligen Kauzenweitel ererbten Kunststück sei es auch nichts, weil die verschworenen Vögel heut alle nicht zu Hause seien. Sie mussten daher eilen, um womöglich noch in der Nacht ihr Ziel zu erreichen.
So geschah es also, dass sie noch zur selben Stunde, nachdem sie sich gehörig gestärkt hatten, ihren Befreiungszug unverdrossen wieder fortsetzten. War aber schon der Anfang dieser Nacht schön gewesen, so war sie jetzt noch viel tausendmal schöner. Die Sterne blinkten durch das dunkle Laub, als ob die Bäume silberne Blüten trügen, und der Mond ging wie ein Einsiedler über die stillen Wälder und spielte melancholisch mit der schlummernden Erde, indem er bald einen Felsen beleuchtete, bald einen einsamen Grund in tiefen Schatten versenkte und Berg und Wald und Tal verworren durcheinander stellte, dass alles fremd und wunderbar aussah.
Auf einmal blieb Rüpel stehen, denn ein seltsam schweifendes Licht streifte die Spitzen des Gebüsches vor ihnen. Sie bogen die Zweige vorsichtig auseinander und erblickten nun mehrere schöne schlanke Mädchengestalten in leuchtenden Gewändern, die sich bei den Händen angefasst hatten und dort einen Ringeltanz hielten. Ihre langen blonden Haare flogen in der leisen Luft, dass es wie ein Schleier von Mondschein um sie her wehte, und doch sahen sie aus wie Kinder und berührten mit den zierlichen Füßchen kaum den Boden, und wo sie ihn berührten, schimmerte das Gras von goldnem Glanze. Dabei sangen sie überaus lieblich:
"Luft'ge Kreise, lichte Gleise
Von Gesang und Mondenschein
Ziehn wir leise dir zur Reise,
Kehre bei uns Elfen ein!"
Das ließen sich die Reisenden nicht zweimal sagen und eilten sehr erfreut über die große Höflichkeit aus ihrem Versteck hervor. Kaum waren sie indes auf den freien Platz herausgekommen, so war plötzlich die ganze Erscheinung lautlos verschwunden, und sie schwankten auf einem mit trügerischem Rasen bedeckten Moorgrund, in welchem Rüpel sogleich bis über die Knie versank. Dabei glaubten sie hier und da heimlich lachen zu hören, konnten jedoch durchaus niemand mehr entdecken.
Rüpel aber, um sich zu helfen, griff wütend um sich, erwischte den Magog, der soeben schon wieder aufs Trockne sprang, beim Rockzipfel und riss ihm einen Schoß seines alten Frackes glatt weg, worüber der Doktor höchst entrüstet wurde und beide in einen sehr unangenehmen und lauten Wortwechsel gerieten.
Nachdem sie sich endlich herausgearbeitet und an dem Moose möglichst wieder gesäubert hatten, sagte Rüpel: "Ja, in dieser Gegend ist's nicht recht geheuer, hier nahebei muss auch der stille See liegen mit dem versunkenen Schlosse; man kann, wenn's windstill ist, tief im Grunde noch die Türme sehen, und manchmal in schönen Sommernächten taucht es herauf, bis die ersten Hähne krähen."
Und in der Tat, der unheimliche Spuk wollte gar nicht aufhören, je weiter sie in der verrufenen Gegend fort schritten. Irrlichter hüpften überall über den Weg vor ihnen und spielten und wandten sich untereinander wie junge Kätzchen; dann fuhren sie neckend nach Rüpels Bart, setzten sich auf Magogs Hut oder haschten von hinten nach ihm, als wollten sie ihm den noch übrig gebliebenen Frackschoß abreißen. Rüpel sagte: "Die närrischen Dinger werden mir noch meine Wildschur anzünden", und suchte immerfort eines zu greifen, und da es jedes Mal misslang, brach er endlich in ein so herzhaftes Lachen aus, dass es weit durch den Wald schallte und die Irrlichter erschrocken nach allen Seiten auseinander fuhren.
"Hab' ich's nicht gesagt?!" rief dann Rüpel, indem er plötzlich ganz erschrocken still stand und mit dem Finger in die Nacht hinauswies. Magog wandte sich rasch herum und erblickte in der Waldeinsamkeit einen großen klaren See, und mitten in dem See ein schneeweißes Schloss mit goldnen Zinnen, das sich wie ein schlummernder Schwan im Wasser spiegelte, und rings um das Schloss herum schien ein Garten mit Myrten, Palmen und anderen wunderbaren Bäumen gleichfalls zu schlummern, so still war es dort.
Jetzt aber erhoben sich auf einmal einige Elfen, die unter den Palmen geschlafen hatten, dann immer mehrere, und gleich darauf sah man sie alle wie Johanniswürmchen geschäftig hin und her irren, als würde dort ein großes Fest vorbereitet. Dabei streiften sie im Vorüberschweben mit ihren Fingerspitzen Bäume, Blumen und Sträucher, die von der flüchtigen Berührung allmählich in hundert farbigem Glanze, wie lauter Bergkristalle, Rubinen, Smaragden und Saphire zu leuchten anfingen, und wenn die Luft durch den Garten ging, gab es einen wunderbaren Klang, als ob der Mondschein selber sänge. -
"Das ist ihr Traumschloss", flüsterte Rüpel dem Magog zu und wandte kein Auge von der prächtigen Illumination. Magog aber warf stolz den Kopf zurück. "Einfältiges Waldesrauschen, alberne Kobolde, Mondenschein und klingende Blumen", sagte er mit außerordentlicher Verachtung, "nichts als Romantik und eitel Märchen, wie sie müßige Ammen sonst den Kindern erzählten. Aber der Menschengeist ist seitdem mündig geworden. Vorwärts! die Weltgeschichte wartet draußen auf uns." Mit diesen Worten drängte er den kindlichen Riesen fort zu verdoppelter Eile und ruhte nicht, bis der Blumengesang und der schimmernde Garten hinter ihnen verklungen und versunken.
Das war aber nun einmal eine wahre Hexennacht, denn sie mochten kaum noch eine Stunde lang gegangen sein, so hörten sie schon wieder ein seltsames Geräusch vor sich, ein Schwanken und Knistern in den Zweigen und Hufklang dazwischen, immer näher und näher, wie wenn jemand rasch und heimlich durch das Dickicht bräche. Und es war auch wirklich ein flüchtiger Zug, der gerade auf sie zukam.
Voran eilten viele Irrlichter in lustigen Sprüngen, um unter den Eichenschatten den Weg zu zeigen, dann folgte ein Hirsch, und auf dem Hirsche saß eine sehr schöne Dame, von ihren Locken, wie von einem goldnen Mantel, durch den die Sterne schienen, rings umwallt und einen Kranz ums Haupt, der in grüngoldnem Feuer funkelte. Als sie die beiden Wandrer gewahrte, stutzte sie, und auf einen Wink von ihr hielten Hirsch und Irrlichter plötzlich an.
Rüpel verneigte sich, so tief er's vermochte, und wagte kaum verstohlen aufzublinzeln, während die Irrwische, die keinen Augenblick ruhig bleiben konnten, sich schon wieder mit Magogs verwitwetem Rockschoß zu schaffen machten. "Was sucht ihr hier?" fragte die Reiterin, die Fremden mit einem strengen und durchdringenden Blick betrachtend. -
"Die Libertas", entgegnete Magog stolz. Da lachte die Dame und winkte wieder, und wieder eilten die Irrlichter voran und flog der Hirsch mit seiner schönen Herrin über den Rasen fort - sie schienen nach dem Traumschlosse hinzuziehen.
Jetzt erst richtete sich Rüpel mühsam aus seiner Devotion wieder auf; "gewiss Ihre Majestät die Elfenkönigin", rief er, dem Zuge noch lange nachsehend. "Das wäre mir eine schöne Königin", erwiderte Magog, "ihr Diadem war nicht einmal echt, nichts als leuchtende Johanniswürmchen."
Der Morgen fing endlich an zu dämmern, in der Ferne krähte schon ein Hahn; da bog Rüpel bald da, bald dort die Wipfel auseinander und spähte unruhig nach allen Seiten umher. "Jetzt hab' ich's!" rief er auf einmal, "dort ist das Schloss des Baron Pinkus." -
"Das trifft sich ja vortrefflich", entgegnete Magog, "es scheint noch alles zu schlafen droben, wir müssen das Schloss überrumpeln. Der Star hat mir alles ausführlich beschrieben; dort in dem Eckturm sitzt die Libertas gefangen. Sie, lieber Herr Rüpel, haben gerade die gehörige Leibeslänge, Sie langen also ohne weiteres in das Turmfenster hinein und heben die Gefangene in meine Arme.
Ja, jetzt gilt's: Entführung, Hochzeit, Tod oder Haushofmeister!" Nun aber hatte er seine Not mit dem Riesen, der nicht so leise auftreten konnte, wie es die Wichtigkeit des entscheidenden Augenblicks erheischte und überdies bald Eicheln knackte, bald wieder einen Ast abbrach, um sich die Zähne zu stochern. Jetzt glaubten sie in dem Schloßhofe einen Hund anschlagen zu hören.
"Um des Himmels willen", flüsterte Magog seinem Gefährten zu, "nur still jetzt, sachte, sachte!" - So zogen sie sich vorsichtig am Rande des Waldes hin, als ob sie ein Eulennest beschleichen wollten.
Da sahen sie zu ihrer nicht geringen Verwunderung auf einmal einen glänzenden Punkt sich wie eine Sternschnuppe übers Feld bewegen. Es kam immer näher, und bald konnten sie deutlich unterscheiden, dass es eine Frauengestalt und die Sternschnuppe eine glimmende Zigarre war, die sie im Munde hielt.
Sie kam, wie es schien, in großer Angst vom Schlosse gerade auf sie daher geflogen; eine prächtige Amazone mit Schärpe, Reitgerte und klingenden Sporen, ein zierliches Reisebündel unter dem Arm. Jetzt stand sie atemlos dicht vor Magog, den sie beinahe umgerannt hätte. -
"Mein Ideal!" rief sie da plötzlich aus, und "Libertas!" schallte es aus Magogs entzücktem Munde herüber. Sie hatten einander im Augenblick erkannt, ein geheimnisvoller Zug gleichgestimmter Seelen riss Herz an Herz, und in einer langen stummen Umarmung ging ihnen die Welt unter und die Ewigkeit auf. -
Unterdes war auch Rüpel neugierig zwischen den Bäumen hervorgetreten, da erschrak die Dame sehr und sah ihn scheu von der Seite an. Rüpel aber, dem ihr neckisches Wesen gefiel, wurde auf einmal sehr galant, wollte ihr seine Bärenhaut unterbreiten und sie in seinem Futtersack durch den Wald tragen, ja er versuchte sogar in seiner Lustigkeit auf dem Rasen eine Menuett auszuführen, die er einst die alte Urtante hatte tanzen gesehen.
Nun wurde auch die Dame wieder ganz vertraulich und erzählte, wie sie es auf dem barbarischen Schlosse nicht länger habe aushalten können; dann geriet sie immer mehr in sichtbare Begeisterung und sprach von Tyrannenblut, von Glaubens-, Rede-, Preß- und allen erdenklichen Freiheiten. Da hielt sich Magog nicht länger, reckte zum Treuschwur den Arm hoch zu den Göttern empor, reichte ihr darauf die Rechte und verlobte sich sogleich mit ihr, und Rüpel schrie in einem fort Vivat! dazu.
Über diesem Freudengeschrei aber entstand nach und nach ein bedenkliches Rumoren im Schlosse. Die Verliebten draußen merkten es gar nicht, wie erst einzelne Wachen verdächtig über das stille Feld fast bis zum Walde streiften und dann eiligst wieder zum Schloss zurückkehrten.
Auf einmal aber tat sich das Schloßtor auf, und die ganze bewaffnete Macht schritt mit dem Feldgeschrei: "Die Libertas ist entwischt!" todesmutig daraus hervor. Dazwischen konnte man deutlich die Stimme des Baron Pinkus unterscheiden, der entrüstet gegen das Dasein von Riesen und dergleichen abergläubischen Nachtspuk, wovon die Streifwachen gefabelt, im Namen der Aufklärung protestierte.
Jetzt aber erblickten sie den Rüpel, den sie anfangs für einen knorrigen Baumstamm angesehen hatten, und hielten plötzlich an. Niemand wagte sich zu regen, es war so still, dass man fast die Gedanken hören konnte; überall nichts als ein irres Flüstern mit den Augen, todbleiche Gesichter und fliegende Röte dazwischen, kurz, alle Symptome einer allgemeinen Verschwindsucht.
Bei Pinkus endlich kam sie zum Ausbruch. Erst ganz leise mit langen langen Schritten, den Kopf noch immer zurückgewendet, dann unaufhaltsam in immer weiteren Sprüngen, dass ihm der Opferzopf hoch in der Luft nach flog, stürzte er nach dem Schlosse und die bewaffnete Macht in wildester Flucht ihm nach.
Rüpel hatte eben nur noch Zeit genug, den behänden Pinkus mit ein paar gewaltigen Sätzen am Zipfel seines Zopfes zu erfassen, aber er behielt den Zopf allein in der Hand, und damit hieb er wütend rechts und links und trieb sie alle vor sich her; ja, er wäre ohne Zweifel mit ihnen zugleich in das Schloss gedrungen, wenn er nicht in der Hitze des Gefechtes an den Schwibbogen des Tores mit solcher Vehemenz mit dem Kopfe angerannt wäre, dass er unversehens rücklings zu Boden fiel, was den empfindlich Geschlagenen notdürftigen Vorsprung gewährte, sich in das Schloss zu salvieren und, ehe Rüpel sich wieder aufraffte, die eisernen Torflügel dicht vor ihm krachend zuzuwerfen.
Nun wandte sich Rüpel sehr vergnügt um, mit Magog weiteren Kriegsrat zu pflegen. Aber wie erstaunte er, als er niemand hinter sich erblickte. Vergebens ging und rief er am Rande des Waldes auf und nieder, die beiden Liebenden waren spurlos verschwunden. Die Libertas mag sich wohl vor dem Schlachtlärme etwas tiefer in den Wald zurückgezogen haben, dachte er; er hoffte noch immer, sie wieder zu finden und ging und rief von neuem immer weiter fort, worüber er aber mit dem Echo, das ihm lauter unvernünftige Antworten gab, in einen ebenso heftigen als fruchtlosen Wortwechsel geriet.
Und so hatte er denn von der ganzen großen Unternehmung nichts als ein paar neue Löcher in seiner alten Wildschur gewonnen und schritt endlich voller Zorn und so eilfertig wieder in den Urwald zurück, dass wir ihm unmöglich weiter nachgehen können.
Wie aber war die Libertas so unverhofft aus ihrem Turme entkommen?
Wir haben schon früher gesehen, dass seit ihrer Gefangenschaft im Pinkusschen Schlosse und Garten die gute alte Zeit wieder repariert und neu vergoldet worden, wo sie durch ihre impertinente Einmischung etwa gelitten hatte. Alles schämte sich pflichtschuldigst der augenblicklichen Verführung und Verwilderung; in der schillernden Mittagsschwüle plätscherten die Wasserkünste wieder wie blödsinnig immerfort in endloser Einförmigkeit; die Statuen sahen die Buchsbäurne, die Buchsbäume die Statuen an, und die Sonne vertrieb sich die Zeit damit, auf den Marmorplatten vor dem Schlosse glitzernde Schnörkel und Ringe zu machen; es war zum Sterben langweilig.
Libertas hatte daher schon lange nachgedacht, wie sie sich befreien könnte, und sann und sann, bis endlich die Nacht der ganzen Industrie im Schloss das Handwerk gelegt und draußen die Welt ungestört wieder aufatmete. Auch der Schwan auf dem Wallgraben unter dem Turm war nun eingeschlummert, und drüben standen die Wälder im Mondschein.
Da trat Libertas an das offene Fenster und sprach:
"Wie rauscht so sacht
Durch alle Wipfel
Die stille Nacht,
Hat Tal und Gipfel
Zur Ruh' gebracht.
Nur in den Bäumen
Die Nachtigall wacht
Und singt, was sie träumen
In der stillen Pracht."
Die Nachtigall aber antwortete aus dem Fliederbusche unten:
"In der stillen Pracht,
In allen frischen Büschen, Bäumen flüstert's in Träumen
Die ganze Nacht,
Denn über den mondbeglänzten Ländern
Mit langen weißen Gewändern
Ziehen die schlanken
Wolkenfrauen, wie geheime Gedanken,
Senden von den Felsenwänden herab die behänden
Frühlingsgesellen: die hellen Waldquellen,
Um's unten zu bestellen
An die duftigen Tiefen,
Die tun, als ob sie schliefen,
Und wiegen und neigen in verstelltem Schweigen
Sich doch so eigen mit Ähren und Zweigen,
Erzählen's den Winden,
Die durch die blühenden Linden,
Vorüber an den grasenden Rehen
Säuselnd über die Seen gehen,
dass die Nixen verschlafen auftauchen
Und fragen,
Was sie so lieblich hauchen?
Ich weiß es wohl, dürft' ich nur alles, alles sagen."
Hier kam plötzlich ein Storch aus dem Gesträuch und klapperte zornig nach dem Fliederbusche hin, und die Nachtigall schwieg auf einmal. - "Was hat nur der Storch mit der Nachtigall zu so später Zeit? er ruht doch sonst auch gern bei Nacht", sagte Libertas zu sich selbst und wusste gar nicht, was sie davon denken sollte.
Aber die Nachtigall wusste es recht gut, und dass sie in der Nähe des Schlosses nicht so viel ausplaudern sollte; denn unter den freien Tieren des Waldes war in jener großen nächtlichen Versammlung, die Magog auf seiner Wanderschaft von ferne mit angesehen hatte, eine geheime Verschwörung gemacht worden und sollte eben in der heutigen Nacht zum Ausbruch kommen.
Schon am vorigen Abend war es den Landleuten, die vor Schlafengehen noch ihre Saaten in Augenschein nahmen, sehr aufgefallen, wie da über der Au im Tale, wo die glänzenden Sommerfäden an den Gräsern hingen, so viele Schwalben emsig hin und her schweiften und mit ihren Schnäblein die Fäden aufrafften, soviel eine jede im Fluge erhaschen konnte, dass sie, als sie damit durch die Luft flogen, wie in langen silbernen Schleiern dahin zogen.
Dieses feine Gespinst aber breiteten die Schwalben sodann auf einer einsamen Waldwiese im Mondschein aus; da kamen hurtig unzählige kleine Spinnen, die schon darauf gewartet, rote, braune und grüne, und drehten die Fäden fleißig zusammen und woben, damit es besser aussähe, auch etwas Mondschein darein, während die Johannisfünkchen ihnen dabei leuchteten und die Heimchen dazu sangen.
Kaum aber hatten sie die letzten Maschen geknüpft, so säuselte es leicht durch die Stille, von allen Seiten kamen Bienen, die heute Schlaf und Honig vergaßen, dicke Päckchen an ihren Füßen, die streckten und streiften mit dem Wachse das ganze Gespinst gar kunstreich zu einer langen Strickleiter.
Unterdes sah man bei dem klaren Mondlicht bald da, bald dort am Waldessaume ein Reh mit den klugen Augen hervorgucken und schnell wieder im Dickicht verschwinden, denn das wachsame Wild machte die Runde, um sogleich zu warnen, wenn etwa Verrat drohte.
Der getreue Storch aber, der vorher die Nachtigall wegen ihrer Plauderhaftigkeit ausgescholten, stand die ganze Zeit hindurch, nur ein paar Mal wider Willen einnickend, unbeweglich auf einem Beine bei den Spinnen und Bienen, um auf ihr Werk aufzupassen und ohne Nachsicht jeden wegzuschnappen, der sich bei der Arbeit saumselig zeigte.
Und als die Leiter fertig war, prüfte er sie bedächtig, hing sie dann an den Ast des nächsten Baumes und stieg selbst daran hinauf, um so zu versuchen, ob sie fest genug, wobei er sich aber so ungeschickt und seltsam anstellte, dass die kleinen behänden Kreaturen ringsumher einige Mal heimlich kichern mussten und die Heimchen neckend: "Storch, Storch, Steiner, hast so lange Beiner!" zu ihm hinüber riefen, worüber er jedes Mal sehr böse wurde und mit seinem langen Schnabel nach ihnen hackte.
Als er nun aber sah, dass alles gut war, nahm er das eine Ende der luftigen Leiter in den Schnabel, flog damit zu dem Fenster der Libertas hinan und schlang es fest um das Fensterkreuz. Zu gleicher Zeit schlug die Wachtel gellend in dem nahen Kornfelde; das war das verabredete Zeichen. Da erwachten alle Waldvögel draußen, die ohnedies nicht fest geschlafen vor Freude und Erwartung und weil die Nachtigall die ganze Nacht so laut geschmettert hatte. Die flogen nun alle nach dem Turmfenster droben, pickten an die Scheiben und sangen ganz leise:
"Frau Libertas, komm heraus!
Denn der liebe Gott hat lange
Draußen unser grünes Haus
Schon geschmückt dir zum Empfange,
Hat zur Nacht die stillen Tale
Rings mit Mondenschein bedeckt,
Und in seinem Himmelssaale
Alle Lichter angesteckt.
Horch, das rauscht so kühl herauf,
Frau Libertas, wache auf!"
Aber Libertas, die an dem heimlichen Treiben draußen längst alles gemerkt, hatte schon ihr Bündel geschnürt und betrat, die treuen Vögel freundlich grüßend, die Strickleiter, und wie sie so in die Nacht hinab stieg, boten ihr die kleinen Birken, die aus den Mauerritzen des alten Turmes wuchsen, überall helfend die grünen Hände, und von unten wehte ihr der Duft der Wälder und Wiesen erfrischend entgegen.
Als sie aber an den breiten Wallgraben kam, war schon der Schwan am Ufer und schwellte stolz seine Flügel wie zwei schneeweiße Segel. Da setzte sich Libertas dazwischen, und er glitt mit ihr hinüber und betrachtete voll Entzücken ihr schönes Bild, das auf dem Spiegel des Weihers neben ihm dahinschwebte.
Unterdes aber hatte der Kettenhund im Hofe schon lange die Ohren gespitzt und weckte jetzt laut bellend seinen Nachbar, den boshaften Puter, der hätte bald alles verraten, er kollerte so heftig, dass er ganz rot und blau am Kragen wurde vor Zorn und Hoffahrt, darüber wachten auch die Gänse im Stalle auf und schrieen Zeter und abermals Zeter, denn sie hatten die rechte Witterung von den heimlichen Umtrieben im Turme und fürchteten alle, wenn die Libertas entwischte, aus dem guten Futter zu kommen und zu den anderen gemeinen Vögeln in die Freiheit gesetzt zu werden.
Aber ihr Lärm und Ärger kam zu spät, Libertas war schon jenseits des Wallgrabens. Drüben aber stand ein Hirsch am Waldessaume und neigte die Knie und sein Geweih vor ihr bis auf den Rasen. Da schwang sie sich rasch hinauf, und fort ging es durch Nacht und Wald, und der Storch mit den andern Vögeln, um ihr das Geleit zu geben, stürzte sich hintendrein vom Turme in die Luft, in stillen Kreisen über den mondbeglänzten Gärten, Wäldern und Seen schwebend.
Die im Schlosse merkten es erst bei Tagesanbruch, wo sie, wie wir gesehen, zu ihrem Unglück auf ihre Verfolgung ausrückten. Nur die Hirten, die an den Bergeshängen bei ihren Herden wachten, hörten erstaunt den Gesang in den Lüften und die geheimnisvolle Flucht im Waldesgrund an den einsamen Weilern vorüberziehen. Und das war eben die schöne Frauengestalt auf dem Hirsch, die in derselben Nacht Rüpel und Magog auf ihrer Wanderschaft im Urwald gesehen, ohne die Libertas zu erkennen, auf deren Befreiung sie so schlau und vorsichtig ausgezogen.
Die Amazone aber, die sie gerettet hatten, war niemand anders als die Pinkussche Silberwäscherin Marzebille, ein herzhaftes Frauenzimmer, die schon früher als Marketenderin mit den Aufklärungstruppen durch dick und dünn mit fortgeschritten und nirgends fehlte, wo es was Neues gab. Die hatte nun seit der Libertas Erscheinung eine inkurable Begeisterung erlitten und sich daher an jenem denkwürdigen Morgen kurz resolviert, aus dem Schloßdienst in die Freiheit zu entlaufen.
Der Doktor Magog aber war damals vor dem unverhofften Schlachtgetümmel am Schlosse so heftig erschrocken, dass er mit seiner glücklich emanzipierten Braut, die hier alle Schliche und Wege kannte, unaufhaltsam sogleich quer durch Deutschland und übers Meer bis nach Amerika entfloh, wo er wahrscheinlich die Marzebille noch heut für die Libertas hält.
Da konnte sie den Rüpel freilich nicht mehr herrufen. Und das schadet auch nichts, denn Magog hatte schon während der feierlichen Verlobung hin und her gesonnen, auf welche Weise er den Riesen, da er ihn nun nicht mehr brauchte, wieder loswerden könnte; er dachte gar nicht daran, einen so ungeschlachten Gesellen zu seinem Haushofmeister zu machen, dessen große Familie ihm wohl bald Haus und Hof verzehrt hätte.
Dafür haben ihn, gleichwie die Menschen Vogelscheuchen aufzurichten pflegen, die dankbaren Vögel in Erwägung seiner vor dem Schlosse bewiesenen Bravour als Hüter des Urwaldes angestellt, mit der einzigen Verpflichtung, von Zeit zu Zeit mit den schrecklichsten Tierfellen, Mähnen und Auerochsenhörnern sich am Rande des Waldes zu zeigen. Dort also hat der Biedermann endlich sein sicheres Brot.
Die emigrierte Urtante ist gänzlich verschollen. Von der Libertas dagegen sagt man, dass sie einstweilen bei den Elfen im Traumschlosse wohne, das aber seitdem niemand wieder aufgefunden hat.
Joseph Freiherr von Eichendorff
RICHILDE ...
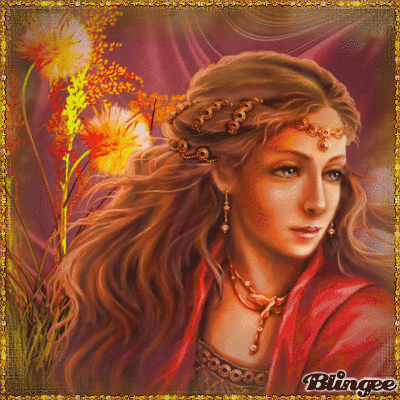
Gunderich der Pfaffenfreund, Graf von Brabant, lebte um die Zeit der Kreuzzüge mit so exemplarischer Frömmigkeit, dass er den Namen des Heiligen so gut verdient hätte, als Kaiser Heinrich der Hinker; seine Hofburg sah einem Kloster ähnlich, man hörte da keine Sporen klirren, keine Rosse wiehern, keine Waffen rauschen, aber die Litaneien andächtiger Mönche und das Geklingel der Silberglocken tönten ohne Unterlass durch die Hallen seines Palastes.
Der Graf versäumte keine Messe, wohnte fleißig den Prozessionen bei und trug eine geweihte Wachskerze, wallfahrte auch an alle heilige Örter, wo Ablass erteilt wurde, auf drei Tagereisen weit rings um sein Hoflager. Dadurch erhielt er die Politur seines Gewissens so rein und unbefleckt, dass auch kein sündlicher Hauch daran haften konnte; dennoch wohnte bei dieser großen Gewissensruhe keine Zufriedenheit in seinem Herzen, denn er lebte in kinderloser Ehe und besaß gleichwohl große Schätze und Renten. Diese Unfruchtbarkeit nahm er für eine Strafe des Himmels an, weil, wie er sagte, seine Gemahlin zuviel eitelen Weltsinn habe.
Die Gräfin grämte sich innerlich über diesen frommen Wahn. Obgleich die Andächtelei eben nicht ihre Passion war, so wusste sie doch nicht eigentlich, wodurch sie das Strafgericht der Unfruchtbarkeit verdient haben sollte, denn die Fruchtbarkeit ist ja nicht eben eine Prämie der weiblichen Tugend. Indessen verabsäumte sie nichts, den Himmel, wenn die Vermutung ihres Gemahls allenfalls Grund haben sollte, durch Fasten und Kasteien zu versöhnen, aber diese Bußübungen wollten nicht anschlagen, und ihre Taille wurde bei dem strengen Regime nur immer schlanker.
Zufälligerweise traf sich's, dass Albertus Magnus, als er auf Befehl Gregor des Zehnten von Köln aufs Konzilium nach Lyon zog, seinen Weg durch Brabant nahm, und beim Grafen einsprach, dessen Gastfreigebigkeit gegen die Klerisei keine Grenzen hatte. Er empfing seinen Gast nach Standesgebühr und Würden, ließ sich auch von ihm eine Messe lesen, für die er hundert Goldstücke zahlte, die Gräfin wollte ihrem Gemahl an Freigebigkeit nicht nachstehen, darum ließ sie sich gleichfalls eine Messe lesen und zahlte dafür hundert Goldgulden, nicht minder begehrte sie an den ehrwürdigen Dominikaner, dass er sie Beichten hören möchte, wo sie ihm das Anliegen wegen ihrer Unfruchtbarkeit offenbarte und getröstet von ihm hinweg ging.
Er untersagte der betrübten Beichttochter alle Pönitenz und ferneres Kasteien, schrieb ihrem Herrn und ihr eine reichlichere Diät vor und verhieß mit prophetischem Geiste, dass sie, eh er noch vom Konzilium zurückkehrte, mit Leibesfrucht würde gesegnet sein. Die Prophezeiung traf ein: bei der Wiederkehr von Lyon fand Albertus in den Armen der erfreuten Gräfin ein zartes Fräulein, der holden Mutter Ebenbild, welche allen Heiligen dankte, dass ihre Schmach nun von ihr genommen war.
Vater Gunderich hätte zwar einen männlichen Erben lieber ankommen sehen, aber weil das kleine Geschöpf so niedlich und freundlich war und ihm so unschuldsvoll entgegenlachte, trug er's oft auf den Armen und hatte große Freude daran. Weil nun der Graf in den Gedanken stund, der fromme Albertus habe ihm diesen Ehesegen vom Himmel erbeten, so erdrückte er ihn schier mit Wohltaten, und bei seinem Abzug verehrte er ihm ein prächtiges Messgewand, wie der Erzbischof von Toledo keins in seiner geistlichen Garderobe haben mag.
Die Gräfin bat um Albens Benediktion für ihr Töchterlein, und er erteilte solche mit einer Inbrunst und Teilnehmung, dass die Lästerchronik des Hofs dadurch Anlass nahm, allerlei zu munkeln, was die Genealogisten über die Abkunft des Fräuleins hätte irreführen können; doch Vater Gunderich nahm keine Notiz von dem Gerede und ließ alles gutmütig beim gleichen bewenden.
Albertus Magnus war ein sonderbarer Mann, der bei seinen Zeitgenossen in zweideutigem Rufe stund. Einige hielten ihn für einen Heiligen, als irgendeiner im Kalender zu finden ist, andre schrien ihn für einen Schwarzkünstler und Teufelsbanner aus, noch andre sprachen, er sei keins von beiden, sondern ein hochgelehrter Philosophus, der die Natur beschlichen und ihr alle Geheimnisse abgewonnen habe. Er verrichtet' auch wunderbare Dinge, darob männiglich erstaunte; denn als Kaiser Friedrich der Zweite begehrte, seine Künste zu schauen, lud er ihn im Eismonat zu Köln am Rhein auf ein Frühstück in den Klostergarten ein und gab ihm ein Schauspiel, das seinesgleichen nicht hatte.
Hyazinthen und Tulpen stunden da im schönsten Flor, einige Obstbäume blühten, andre trugen reife Früchte, die Nachtigallen ließen sich nebst der Grasmücke im Gebüsche hören, und die fröhlichen Stechschwalben schwirrten hoch in der Luft um den Klosterturm. Wie der Kaiser das alles genug bewundert hatte, führte er ihn nebst seinen Höflingen an ein Traubengeländer, gab jedem Gast ein Messer in die Hand, sich eine reife Traube abzuschneiden, doch gebot er's nicht eher zu tun, bis er's ansagen würde; aber plötzlich nahm er die künstliche Täuschung hinweg, da ergab sich, dass jeder Gast seine eigne Nase erfasst und das Messer angesetzt hatte, sie abzuschneiden, welcher Schwank Friedrichen so zu lachen machte, dass er den kaiserlichen Bauch halten musste.
Wenn das mit rechten Dingen zuging, so war's traun ein Stück, welches weder der postische Professor Pinetti, noch Philadelphia der Jud dem Tausendkünstler Albertus nachzutun vermochten.
Nachdem der ehrwürdige Dominikaner der kleinen Richilde die geistliche Benediktion erteilt hatte und nun von hinnen ziehen wollte, begehrte die Gräfin noch ein Andenken für ihr Töchterlein, eine Reliquie, ein Agnus Dei, ein Amulett oder einen Segen fürs Fräsch und Herzgespann. Albertus schlug sich vor die Stirn und sprach: "Ihr erinnert wohl, edle Frau, schier hätte ich es aus der Acht gelassen, Euer Fräulein mit einer Gabe zu bedenken; aber lasst mich allein und sagt mir genau an, zu welcher Stunde das Fräulein zuerst die vier Wände beschrien hat." Darauf verschloss er sich neun Tage lang in eine einsame Klause und laboriert' fleißig, dass er ein Kunststück zuwege brächte, dabei sich die kleine Richilde seiner erinnern möchte.
Wie der Kunstmeister das Werk vollendet hatte und merkte, dass es wohl gediehen sei, bracht er's insgeheim zur Gräfin, sagte ihr an alle Tugend und Wirkung seines Machwerks, gab ihr Bescheid und Unterricht, wie's zu gebrauchen sei und wie sie die Tochter, wenn sie heranwuchs, von Nutz und Brauch des Werks belehren sollte, nahm freundlichen Abschied und ritt davon.
Die Gräfin, hocherfreut über die Gabe, nahm die magische Heimlichkeit und verbarg sie in der Schublade, wo sie ihre Kleinodien verwahrte. Gunderich der Pfaffenfreund lebte noch einige Jahre in weltentflohner Abgeschiedenheit in seiner Burg, stiftete viel Klöster und Kapellen und legte dennoch einen großen Teil seiner Renten zum Brautschatz des lieben Töchterleins bei, denn das Lehn war einem Agnaten verschrieben. Wie er spürte, dass es mit ihm bald zu Ende gehen würde, ließ er sich ein Mönchskleid anlegen und verschied darin mit den hoffnungsvollsten Ansprüchen auf das Recht der Maskenfreiheit im ewigen Leben.
Die Gräfin wählte ein Nonnenkloster zum Witwenaufenthalt und wendete ihre ganze Tätigkeit auf die Erziehung ihrer Tochter, welche sie, sobald sie volljährig sein würde, selbst in die große Welt einführen wollte. Ehe sie das bewerkstelligen konnte, wurde sie vom Tode übereilt, eben zu der Zeit, da das Fräulein mit dem fünfzehnten Jahre ihres Lebens im Blütenmond der weiblichen Schönheitsepoche eintrat.
Die gute Mutter sträubte sich anfangs mit einigem Unwillen gegen die ungelegene Trennung von der schönen Richilde, in der sie noch einmal aufzuleben gedachte; doch als sie vermerkte, dass ihr Stündlein vorhanden sei, unterwarf sie sich standhaft dem Gesetz des alten Bundes und schickte sich zur Heimfahrt. Sie rief ihre Tochter beiseite, hieß ihr die milden Zährlein trocknen und redete zum Valet also:
"Ich verlasse Euch, geliebte Richilde, zu einer Zeit, wo Euch der mütterliche Beistand am nötigsten tut; aber kümmert Euch nicht, der Verlust einer guten Mutter soll Euch durch einen treuen Freund und Ratgeber ersetzt werden, der, wenn Ihr weise und klug seid. Eure Schritte leiten wird, dass Ihr nie irre geht. Dort in der Schublade, die meine Juwelen aufbewahrt, befindet sich ein natürlich Geheimnis, welches Ihr nach meinem Ableben in Empfang nehmen sollt. Ein hocherfahrner Philosophus, genannt Albertus Magnus, der an der Freude über Eure Geburt großen Anteil nahm, hat solches unter einer gewissen Konstellation verfertigt und mir anvertraut, Euch den Gebrauch desselben zu lehren.
Dieses Kunstwerk ist ein metallischer Spiegel, in einen Rahmen von gediegenem Golde gefasst. Er hat für die, welche hineinschauen, alle Eigenschaften eines gemeinen Spiegels, die Gestalten getreu zurückzugeben, die er empfängt. Aber für Euch ist ihm außer diesem Gebrauch noch die Gabe verliehen, alles, warum Ihr ihn befragt, in deutlichen, redenden Bildern darzustellen, sobald Ihr den Spruch aussprecht, welchen Euch dieses Gedankentäflein, dass Ihr hier empfangt, nachweisen wird. Hütet Euch, ihn nie aus Vorwitz und Neugier zu konsultieren oder ihm unbesonnen das zukünftige Schicksal Eures Lebens abzufragen.
Betrachtet diesen wunderbaren Spiegel als einen achtungswerten Freund, den man mit nichtswürdigen Fragen zu ermüden sich scheut; an dem man aber in den wichtigsten Angelegenheiten des Lebens immer einen treuen Ratgeber findet. Darum seid weise und vorsichtig beim Gebrauch und wandelt auf den Wegen der Tugend, damit der blanke Spiegel nicht, durch den vergifteten Hauch des Lasters angeweht, vor Eurem Angesicht erblinde."
Nachdem die sterbende Mutter diesen Schwanengesang vollendet hatte, umfasste sie die jammernde Richilde, empfing den heiligen Chrisam, kämpfte flugs ihren Todeskampf und verschied.
Das Fräulein empfand tief in ihrem Herzen den Verlust der zärtlichen Mutter, hüllte sich in Trauerkleider und verweinte eins der schönsten Lebensjahre zwischen den Mauren der klösterlichen Klausur in Gesellschaft der ehrwürdigen Domina und der frommen Klosterschwestern, ohne einmal den zeitlichen Nachlass ihrer Mutter nachzusehen oder in den geheimnisvollen Spiegel zu schauen. Die Zeit milderte nach und nach diese kindlichen Schmerzensgefühle, der Tränenquell versiegte, und wie das Herz des Fräuleins durch Leidensergießung keine Beschäftigung mehr fand, fühlte sie in der einsamen Zelle das Ungemächliche der Langenweile.
Sie besuchte oft das Sprachgemach, fand unvermerkt Geschmack, mit den Tanten und Vettern der Nonnen zu kosen, und die letztern waren so eifrig, den frommen Cousinen aufzuwarten, dass sie sich scharenweise ans Gitter drängten, wenn die schöne Richilde im Sprachzimmer war. Es fanden sich viel stattliche Ritter ein, die der ungeschleierten Kostgängerin viel Schönes sagten, und in diesen Schmeicheleien lag das erste Samenkorn der Eitelkeit, welches hier auf kein unfruchtbar Land fiel, sondern bald Wurzel schlug und aufkeimte.
Fräulein Richilde bedachte, dass es draußen im Freien besser sei als in dem Käfig hinter dem eisernen Gitter, sie verließ das Kloster, richtete ihre Hofstatt zu, nahm wohlstandshalber eine Aja zur Ehrenhüterin an und trat mit Glanz in die große Welt ein. Der Ruf ihrer Schönheit und Sittsamkeit breitete sich aus gegen die vier Winde des Himmels. Viele Prinzen und Grafen kamen von fernen Landen, ihr den Hof zu machen. Der Tagus, die Seine, der Po, die Themse, und der Vater Rhein schickten ihre Heldensöhne nach Brabant, der schönen Richilde zu huldigen.
Ihr Palast schien ein Feenschloss zu sein; die Fremden genossen da der besten Aufnahme und unterließen nicht, die Höflichkeiten der reizenden Besitzerin mit den feinsten Schmeicheleien zu erwidern. Es verging kein Tag, wo nicht die Hofstechbahn mit einigen wohlgerüsteten Rittern besetzt war, die durch ihre Wappenkönige auf den Märkten und an den Eckhäusern der Stadt die Herausforderung verkünden ließen: wer die Gräfin von Brabant nicht für die schönste Dame ihrer Zeitgenossenschaft erkenne oder das Gegenteil zu behaupten sich erdreiste, solle sich in den Schranken des Turnierplatzes einfinden und mit den Waffen seine Behauptung gegen die Paladins der schönen Richilde erhärten.
Gemeiniglich meldete sich niemand oder, wenn man ja an einem Hoffeste gern stechen wollte und einige Ritter sich bereden ließen, die Ausforderung anzunehmen und der Dame ihres Herzens den Preis der Schönheit zuzueignen, so geschah das nur zum Schein; die Delikatesse der Ritter erlaubte ihnen nie, den Champion der Gräfin aus dem Sattel zu heben; sie brachen ihre Lanzen, erkannten sich überwunden und gestanden der jungen Gräfin den Preis der Schönheit zu, welches Opfer sie mit jungfräulicher Sittsamkeit anzunehmen pflegte.
Bisher war es ihr noch nicht eingefallen, den magischen Spiegel zu konsultieren, sie brauchte ihn nur als einen gemeinen Spiegel, um ihren Kopfputz dadurch zu prüfen, ob die Jungfrauen sie zu ihrem Vorteil aufgesetzt hätten. Keine Frage hatte sie sich noch nicht erlaubt, entweder weil ihr zurzeit noch kein kritischer Umstand vorgekommen war, der eines Ratgebers bedurft hätte, oder weil sie zu scheu war und befürchtete, ihre Frage könnte vorwitzig und unbesonnen sein, und der blanke Spiegel dürfe darüber erblinden.
Unterdessen machte die Stimme der Schmeichelei ihre Eitelkeit immer mehr rege und erzeugte in ihrem Herzen den Wunsch, das in der Tat zu sein, was das Gerüchte ihr tagtäglich laut in die Ohren gellte; denn sie besaß die so seltene Penetration der Großen, in die Sprache ihrer Höflinge ein gerechtes Misstrauen zu setzen. Einem aufblühenden Mädchen, wes Standes und Würden sie sei, ist die Frage über ihre Wohl- oder Missgestalt ein so wichtiges Problem, als einem orthodoxen Kirchenlehrer die Frage über die vier letzten Dinge. Daher war eben nicht zu verwundern, dass die schöne Richilde Lehr und Unterricht begehrte über eine Materie, die ihrer Wissbegierde so interessant war; und von wem konnte sie hierüber sicherere und ungezweifeltere Auskunft erwarten, als von ihrem unbestechlichen Freunde, dem Spiegel?
Nach einiger Überlegung fand sie die Anfrage so gerecht und billig, dass sie kein Bedenken trug, solche an die Behörde gelangen zu lassen. Sie verschloss sich eines Tages in ihr Gemach, trat vor den magischen Spiegel und hob ihren Spruch an:
Spiegel blink,
Spiegel blank,
Goldner Spiegel an der Wand,
Zeig mir an die schönste Dirn
in Brabant.
Behänd zog sie den seidenen Vorhang auf, blickte hinein und sah darinnen mit großer Zufriedenheit ihre eigne Gestalt, welche ihr der Spiegel unbefragt schon gar oft gezeigt hatte. Darüber war sie hocherfreut in ihrer Seele, ihre Wangen färbten sich höher, und die Augen funkelten vor Vergnügen, aber ihr Herz wurde stolz und hoffärtig wie das Herz der Königin Vasthi.
Die Lobsprüche über ihre Wohlgestalt, die sie vorher mit Bescheidenheit und sanftem Erröten angenommen hatte, begehrte sie nun als einen rechtmäßigen Tribut. Auf alle Jungfrauen des Landes sah sie mit Stolz und Verachtung herab, und wenn von ausländischen Fürstentöchtern die Rede war und irgendeine ihrer Schönheit wegen gepriesen wurde, fuhrs ihr durchs Herz, sie verzog den Mund und bekam Vapeurs. Die Höflinge, die bald die Schwachheit ihrer Gebieterin wahrnahmen, schmeichelten und heuchelten ihr aufs unverschämteste und medisierten über die ganze weibliche Welt, dass sie außer ihrer Herrschaft keiner Dame für einen Deut Ehre ließen, wenn sie im Rufe der Schönheit war. Selbst die berühmten Schönheiten der Vorwelt, die doch seit vielen hundert Jahren verblüht waren, wurden nicht verschont, und sie mussten sich auf das schärfste kritisieren lassen.
Die schöne Judith war zu plump und vierschrötig, wenigstens nach dem Malerkostüm, das ihr von undenklichen Zeiten her die robuste Gestalt eines Schlächterweibes attribuiert, wenn sie den krausbärtigen Kapitän Holofernes entgurgelt; die schöne Esther war ihnen zu rachsüchtig, weil sie die zehn hübschen Jungen des Exminister Hamans, die doch nichts verschuldet hatten, henken ließ; von der schönen Helena hieß es, sie sei ein artiger Rotkopf gewesen und habe aller Vermutung nach Sommersprossen gehabt; an der Königin Kleopatra wurde der kleine Mund gelobt, aber die wulstig aufgeworfenen Lippen und die hoch stehenden ägyptischen Ohren, die Professor Blumbach noch vor kurzem an den Mumien bemerkt haben will, getadelt; die Königin Thalestris musste bei aller Gelegenheit wegen der nach amazonischer Gewohnheit zerstörten rechten Brust herhalten, und ihre schiefe Taille, welche sich bei diesem wesentlichen Schönheitsmangel nicht verhehlen ließ, wollte kein Höfling goutieren, weil der künstliche Panzer der ausgepolsterten Schnürbrüste, die so manchen weiblichen Mangel bedecken, damals noch nicht erfunden war.
Die schöne Richilde galt an ihrem Hofe für das einzige und höchste Ideal der weiblichen Schönheit, und weil sie laut Zeugnis des magischen Spiegels in der Tat die schönste Dame in Brabant war und überdem großen Reichtum besaß nebst vielen Städten und Schlössern, so gebrach es ihr nicht an illüstern Ehewerbern; sie zählte deren mehr als weiland Dame Penelope und wusste sie so fein und trüglich mit süßer Hoffnung hinzuhalten, als nachher die Königin Elisabeth.
Alle Wünsche, die sich die Töchter Teuts in unseren Tagen zu erträumen pflegen, bewundert, fetiert, angebetet zu sein, in der Reihe ihrer Gespielen hervorzustechen und über alle andre wegzuglänzen, wie der liebliche Mond unter den kleinen Sternen, einen Nimbus von Bewunderern und Anbetern um sich zu haben, die bereit sind, für ihre Dame nach alter Sitte auf der Stechbahn das Leben aufzuopfern und auf ihr Geheiß auf Abenteuer auszuziehen und Riesen und Zwerge für sie einzuhaschen, oder nach heutigem Brauch zu weinen, zu girren, zu winseln, trübsinnig in den Mond zu schauen, zu rasen, vor Liebeswut Gift zu fressen, sich den Hals abzustürzen, ins Wasser zu rennen, sich aufzuhängen, die Gurgel abzuschneiden, oder ehrsamer eine Kugel sich durchs Hirn zu jagen: alle diese Träume schwindelnder Mädchen wurden bei der Gräfin Richilde realisiert.
Ihre Reize hatten schon manchem jungen Rittersmann das Leben gekostet, und bei manchem unglücklichen Prinzen hing das Hochgefühl geheimer Liebesqual nur noch zwischen Haut und Knochen. Die grausame Schöne weidete sich insgeheim an den Opfern, die sie ihrer Eitelkeit täglich schlachtete, und die Martern dieser Unglücklichen ergötzten sie mehr als die sanften Gefühle der beglückenden Liebe.
Ihr Herz hatte bisher nur leichte Eindrücke einer überhingehenden Leidenschaft empfunden; sie wusste eigentlich selbst nicht, wem es angehörte, es stund jedem seufzenden Dämon offen, aber nach der Regel des Gastrechts gemeiniglich nicht länger als drei Tage. Wenn ein neuer Ankömmling davon Besitz nahm, so wurde der zeitige Inhaber kaltsinnig dimittieret. Der Graf von Artois, der von Flandern, von Brabant, von Hennegau, der von Namur, von Geldern, von Gröningen, kurz alle siebenzehn niederländische Grafen, mit Ausnahme einiger, die bereits vermählt oder schon Greise waren, buhlten um das Herz der schönen Richilde und begehrten sie zur Gemahlin.
Die weise Aja fand, dass es mit der Koketterie ihrer jungen Herrschaft nicht lange Bestand haben könne; ihr guter Ruf schien sich zu mindern, und es war zu befürchten, dass die plantierten Freier ihre Schmach an der schönen Spröden rächen möchten. Sie tat ihr deshalb wohlmeinenden Vorhalt und nötigte ihr das Versprechen ab, binnen drei Tagen sich einen Gemahl zu wählen. Über diesen Entschluss, der öffentlich bei Hofe bekannt gemacht wurde, erfreuten sich alle Brautwerber höchlich, jeder Kompetent hoffte, das Los der Liebe werde ihn treffen. Sie vereinigten sich, die Wahl, sie begünstige, wen sie wolle, gutzuheißen und mit gesamter Hand solche aufrecht zu erhalten.
Die strenge Aja hätte mit ihrer wohlgemeinten Zudringlichkeit indessen nichts weiter gefruchtet, als der schönen Richilde drei schlaflose Nächte zu machen, ohne dass das Fräulein, da der dritte Morgen herandämmerte, mit ihrer Wahl weitergekommen war als in der ersten Stunde. Sie hatte binnen der dreitägigen Frist unzählige Mal ihre Freierliste durchgemustert, geprüft, verglichen, gesondert, gewählt, verworfen, von neuem gewählt, von neuem verworfen und zehnmal gewählt und zehnmal verworfen; und durch alles Dichten und Denken war nichts erhalten als ein bleicher Teint und ein Paar matte, getrübte Augen.
In Herzensangelegenheiten ist der Verstand immer ein armseliger Schwätzer, der mit seinem kalten Räsonnement das Herz so wenig erwärmt, als ein ungeheizter Kamin ein Gemach. Des Fräuleins Herz nahm keinen Teil an den Beratschlagungen und verweigerte seinen Assent zu allen Motionen des Sprechers im Oberhause des Kopfes, darum konnte auch keine Wahl zu Recht bestehen. Mit großer Aufmerksamkeit wog sie Geburt, Verdienst, Reichtum und Ehre ihrer Eheprätendenten; aber keine dieser rühmlichen Eigenschaften interessierten sie, und ihr Herz schwieg.
Sobald sie indessen die Wohlgestalt der Freier mit in Anschlag brachte, gab's darin einen sanften Anklang. Die menschliche Natur hat sich seit dem halben Jahrtausend, welches von dem Zeitalter der schönen Richilde bis auf uns verflossen ist, nicht um ein Haarbreit geändert. Gebt einem Mädchen aus dem achtzehnten oder aus dem dreizehnten Jahrhundert einen weisen, verständigen, tugendhaften Mann, mit einem Worte einen Sokrates zum Ehewerber, und stellt neben ihn einen schönen Mann, einen Adonis, Ganymed oder Endymion und lasst ihr die Wahl, ihr könnt hundert gegen eins wetten, dass sie an dem ersten kaltsinnig vorbeigeht und einen von den letzten wählt.
Gerade so die schöne Richilde! Unter ihren Ehewerbern fanden sich verschiedene wohlgestaltete Männer; es kam darauf an, den schönsten daraus zu wählen. Die Zeit war über diesen Konsultationen verlaufen, der Hof versammelte sich in Gala, die Grafen und edlen Ritter kamen schon im vollen Ornat angeschritten, die Entscheidung ihres Schicksals mit Herzpochen erwartend. Das Fräulein befand sich in keiner geringen Verlegenheit; ihr Herz weigerte sich, ungeachtet der Zudringlichkeiten des Verstandes, zu entscheiden. Ein Weg musste gleichwohl ins Holz gehen.
Sie sprang hastig von ihrem Sofa auf, trat vor den Spiegel, solchen also ratfragend:
Spiegel blink,
Spiegel blank,
Goldner Spiegel an der Wand,
Zeig mir an den schönsten Mann
in Brabant
Es war also hier nicht die Frage von dem besten, das ist von dem tugendhaftesten, dem treuesten und zärtlichsten Manne, sondern von dem schönsten. Der Spiegel antwortete, wie er gefragt worden war; als sich der seidene Vorhang hob, präsentierte sich gar anschaulich auf der wassergleichen Oberfläche ein stattlicher Ritter in vollem Harnisch, doch ungehelmt, schön wie der jugendliche Adonis, da er der holden Cythere das Herz stahl. Sein Haar wallte in geflammten, kastanienfarbnen Locken die Scheitel herab, die schmalen und dichten Augenbrauen ahmten die Gestalt des Regenbogens nach, aus seinem Feuerauge blitzte Kühnheit und Heldenmut, die männlich braune, mit Rot fingierte Wange glühte von Wärme und Gesundheit; die sanft sich erhebende Oberlippe des Purpurmundes schien einem gefühlvollen Kuss entgegen zu streben, und die volle Wade strotzte von Rüstigkeit und Manneskraft.
Sobald das Fräulein den herrlichen Ritter erblickte, wachten auf einmal in ihrer Seele die noch schlafenden Gefühle der Liebe auf, sie trank aus seinen Augen Wonne und Entzücken und tat das feierliche Gelübde, keinem anderen Mann als diesem ihre Hand zu geben. Nur nahm sie groß Wunder, dass die Gestalt des schönen Ritters ihr ganz unbekannt und fremde war; sie hatte ihn nie an ihrem Hofe gesehen, obgleich nicht leicht ein junger Kavalier in Brabant sein mochte, der solchen nicht besucht hatte. Sie beschaute deshalb die Merkzeichen seiner Rüstung und die Livrei derselben genau, stund eine Stunde lang vor dem Spiegel und verwendete kein Auge von der interessanten Gesichtsform, welche sie darin erblickte, jeder Zug, die ganze Attitüde und die kleinste Eigenheit, die sie wahrnahm, ging in ihre Seele über.
Unterdessen wurde es laut im Vorgemache, die Aja und das Frauenzimmer harrten, dass ihre Herrschart hervortreten sollte; das Fräulein ließ endlich mit Unwillen den Vorhang fallen, öffnete die Tür und, wie sie die Aja erblickte, umarmte sie die ehrwürdige Dame und sprach mit liebreicher Gebärde: "Ich hab ihn gefunden, den Mann meines Herzens, freut euch mit mir, ihr Lieben: der schönste Mann in Brabant ist mein! Der heilige Bischof Medardus, mein Schutzpatron, ist mir diese Nacht im Traum erschienen, hat diesen Gemahl, vom Himmel auserkoren, mir zugeführt und im Beisein der heiligen Jungfrau und vieler himmlischen Zeugen mir angetraut."
Diese fromme Lüge erfand die schlaue Richilde aus dem Stegreif, denn das Geheimnis des magischen Spiegels wollte sie nicht offenbaren, und außer ihr war's keinem Sterblichen kund. Die Hofmeisterin, hocherfreut über den Entschluss ihrer jungen Herrschaft, fragte mit Begier, wer der glückliche Prinz sei, vom Himmel erkoren, die schöne Braut heimzuführen. Alle edlen Frauen des Hofes spitzten das Ohr und rieten in Gedanken gar scharfsinnig bald auf den, bald auf jenen wackeren Ritter, meinten all, sie hätten's getroffen und raunten eine der anderen den Namen des vermeinten Ehekandidaten etwas vorlaut ins Ohr.
Aber die schöne Richilde, nachdem sie ihre Lebensgeister etwas gesammelt hatte, tat ihren Mund auf und sprach: "Meinen Sponsen namentlich euch anzuzeigen oder zu sagen, wo er hause, steht nicht in meiner Macht; er ist nicht unter den Fürsten und Edlen meines Hofes, hab ihn auch nie mit Augen gesehen, aber seine Gestalt schwebt meiner Seele vor, und wenn er kommt, mich heimzuführen, werde ich ihn nicht verkennen."
Über diese Rede wunderten sich die weise Aja und alle Damen nicht wenig, vermeinten, das Fräulein habe diesen Fund erdacht, der abgenötigten Wahl eines Gemahls auszuweichen; aber sie beharrte bei ihrer Erklärung standhaft, keinen anderen Sponsen sich aufdringen zu lassen, als den ihr der fromme Bischof Medardus im Traum angetraut habe. Die Ritter hatten bei dieser Kontroverse lange im Vorgemach geharrt und wurden nun eingelassen, ihre Sentenz zu vernehmen.
Die schöne Richilde trat auf, hielt einen herrlichen Sermon mit vieler Würde und Anstand und beschloss mit dieser Apostrophe: "Vermeinet nicht, edle Herren, dass ich mit trügerischen Worten zu euch rede, ich will euch Anzeige tun von der Gestalt und den Merkzeichen der Waffen des unbekannten Ritters, ob jemand sei, der mir Bericht gebe, wer er sei und wo er zu finden ist." Hierauf beschrieb sie die Gestalt desselben vom Kopf zum Fuß und fügte noch hinzu:
"Sein Harnisch ist gülden, lasurblau verschmelzt, auf dem Schilde schreitet ein schwarzer Löwe in silbernem, mit roten Herzen bestreutem Felde, und die Livrei seiner Feldbinde und des Wehrgehänges ist die Farbe der Morgenröte, Pfirsichblüte und Orangengelb." Als sie nun schwieg, nahm der Graf von Brabant, des Landes Erbe, das Wort und sprach: "Wir sind nicht hier, geliebte Base, mit Euch zu rechten; Ihr habt freie Macht und Willkür, zu tun, was Euch gefällt. Uns genügt. Eure Meinung zu wissen, dass Ihr uns ehrlich verabschiedet und nicht weiter mit trüglicher Hoffnung täuschen möget, dafür gebührt Euch billig Dank.
Was aber den ehrenfesten Ritter anbelangt, den Ihr im Traum gesehen habt und von welchem Ihr wähnt, dass er vom Himmel Euch zum ehelichen Gemahl beschieden sei, so mag ich Euch nicht verhalten, dass mir derselbe wohlbekannt und mein Lehnsmann ist; denn nach Eurer Beschreibung und den Merkzeichen seiner Livrei kann das kein andrer sein als Graf Gombald von Löwen; doch der ist bereits beweibt und kann nicht der Eure werden."
Bei diesen Worten entfärbte sich die Gräfin, dass sie dachte umzusinken. Sie hatte nicht vermutet, dass ihr der Spiegel den Streich spielen und einen Mann darstellen würde, dessen gesetzmäßiger Liebe sie nicht teilhaftig werden konnte, auch hatte sie keinen Arg, dass der schönste Mann in Brabant andere Fesseln als die ihrigen tragen könnte. Bei so bewandten Umständen kam der heilige Medardus ziemlich ins Gedränge, dass er mit seinen geistlichen Pflegetöchtern solch Possenspiel treibe und sie in verbotener Liebesglut entbrennen lasse.
Dennoch wollte die Gräfin ihren Schutzpatron bei Ehren erhalten und behauptete, ihr Traumgesicht könne vielleicht eine verborgene Deutung haben, wenigstens schien es anzuzeigen, dass sie sich vor der Hand in keine Ehetractaten einlassen sollte. Die Freier zogen also insgesamt davon, der eine da hinaus, der andre dort hinaus, und der Hof der Gräfin war auf einmal einsam und verödet.
Das hundertzüngige Gerücht breitete indessen die seltsame Novelle von dem wunderbaren Traum auf allen Heerstraßen aus, und sie kam auch dem Grafen Gombald warm zu Ohren. Dieser Graf war ein Sohn Theobalds, Bruderherz genannt, weil er seinem jüngeren Bruder Botho mit so treuer Liebe zugetan war, dass er mit ihm in beständiger Eintracht lebte und den Nachgeborenen an allen Prärogativen der Erstgeburt Anteil nehmen ließ. Beide Brüder wohnten in einem Schlosse beisammen, ihre Gemahlinnen liebten sich gleichfalls als Schwestern, und weil der ältere Bruder nur einen Sohn, der jüngere nur eine Tochter hatte, gedachten die Eltern, das Band der Freundschaft auch auf die Kinder auszudehnen und verlobten sie in der Wiege.
Das junge Paar wurde beisammen auf erzogen, und als der Tod die Erbverbrüderung von Seiten der Eltern frühzeitig trennte, verklausulierten sie ihren letzten Willen dergestalt, dass den Kindern keine andre Wahl übrig blieb, als sich zu heiraten. Seit drei Jahren waren sie bereits vermählt und lebten nach dem Beispiel ihrer friedlichen Eltern in einer glücklichen Ehe, als Graf Gombald den wunderbaren Traum der schönen Richilde vernahm. Der Ruf, der alle Dinge vergrößert, setzte noch hinzu, sie sei so heftig in ihn verliebt, dass sie das Gelübde getan habe, ins Kloster zu gehen, weil sie seiner Liebe nicht teilhaftig werden könne.
Graf Gombald hatte bisher im Schoß einer friedlichen Familie und in den Armen einer liebenswerten Gattin nur die stillen Freuden der häuslichen Glückseligkeit gekannt, es war noch kein Funken in den Zunder seiner Leidenschaften gefallen, sie zu entflammen; aber plötzlich erwachten in seinem Herzen mächtige Begierden, Ruhe und Zufriedenheit schwand daraus hinweg, es gebar törichte Wünsche, nährte sich insgeheim mit der schandbaren Hoffnung, dass der Tod das Ehebündnis vielleicht trennen und ihm seine Freiheit wiedergeben werde. Kurz, das Ideal der schönen Richilde verdarb das Herz eines sonst guten und tugendhaften Mannes und macht' es aller Laster fähig.
Wo er ging und stund, schwebte ihm das Bild der Gräfin von Brabant vor, es schmeichelte seinem Stolz, der einzige Mann zu sein, der die spröde Schöne überwunden habe, und die erhitzte Phantasie malte ihm den Besitz derselben mit so bunten Farben ab, dass seine Gemahlin dabei ganz in Schatten zu stehen kam; alle Liebe und Zuneigung verlosch gegen sie, und er wünschte nur ihrer los zu sein.
Sie bemerkte bald den Kaltsinn ihres Herrn und verdoppelte deshalb ihre Zärtlichkeit gegen ihn, sein Wink war ihr Gebot. Aber sie könnt ihm nichts mehr zu Danke tun, er war finster, mürrisch und grämisch, absentierte sich von ihr bei jeder Gelegenheit, trieb sich auf seinen Landschlössern und in den Wäldern umher, indes die Einsame zu Haus sich grämte und jammerte, dass es einen Stein hätte erbarmen mögen.
Eines Tages überraschte er sie in einer Anwandelung ihrer Leidensergießung: "Weib", fuhr er auf, "was hast du stets zu winseln und zu stöhnen, dass mir die Ohren gellen, was soll das Eulengeschrei, das mir Unlust macht und weder dir noch mir zu etwas frommen kann?"
"Lieber Herr", antwortete die sanfte Dulderin, "lasst mir meinen Schmerz. Ich bin ein betrübtes Weib, des ich wohl Ursache habe, sintemal ich Eurer Lieb und Gunst verlustig gehe und nicht weiß, wodurch ich diesen Unwillen verschulde. Hab ich Gnade für Euch gefunden, so tut mir kund Euer Missbehagen, dass ich sehe, wie ich's wenden mag."
Gombald wurde durch diese Rede gerührt: "Gutes Weib", sprach er und fasste sie traulich bei der Hand, "Ihr habt nichts verschuldet, doch will ich Euch nicht verbergen, was mir's Herz abdrückt, und das möget Ihr nicht wenden. Unser beider Eh macht mir Gewissensskrupel; ich denke, sie sei Blutschande und große Sünde, die sich nicht abbüßen lässt, weder in dieser noch in jener Welt. Wir sind im verbotenen Grad geheiratet, Geschwisterkind, das ist bald als eine Ehe zwischen Bruder und Schwester; dafür hilft keine Absolution und keine Dispensation. Seht, das quält mein Gewissen Tag und Nacht und brennt mich auf der Seele."
In den Zeiten, wo es noch ein Gewissen gab, war dieses, absonderlich bei großen Herren, so fein, zart und empfindsam, wie das Häutlein Periostium genannt, wo die geringste Verletzung große Qual und Angst verursacht, denn obgleich es durch den Schlaftrunk der Begierden gar leicht zu betäuben und einzuschläfern war, dass man daran sägen und drein bohren konnte wie man wollte, ohne dass es sich regte oder bewegte, so erwachte es doch über kurz oder lang, und verursachte Brennen und Jucken unter der Hirnhaut.
Bei keiner Gelegenheit aber war es reizbarer, als wenn ein Zweifelsknoten über einen verbotenen Ehegrad es drückte. Alle christlichen Könige und Fürsten gehören, wie bekannt, zu einer Familie; folglich, da sie von jeher nicht außer ihrem Clan heiraten durften, mussten sie sich mit ihren Muhmen und Basen vermählen, und solange diese jung und schön waren, wiegte das sinnliche Gefühl der Liebe alle moralischen Gefühle in einen narkotischen Schlummer.
Wenn aber die geliebte Cousine an der Seite ihres Eheherrn zu altern begann, oder Sättigung Überdruss gebar, oder eine andere Dame seinen Augen besser gefiel, erwachte mit einem Mal das zarte Gewissen des tugendhaften Gemahls, zwängte und drängte ihn, dass er weder ruhen noch rasten konnte, bis er einen Scheidebrief in Rom vom heiligen Vater gelöst hatte, Frau Base ins Kloster wandern und ihre ehelichen Gerechtsame einer anderen einräumen musste, an welche das kanonische Recht keinen Anspruch hatte.
So schied sich Heinrich VIII. von Catharinen von Arragonien, seiner Schwägerin, bloß auf Antrieb seines zarten Gewissens, obgleich er mit dessen völliger Zustimmung zwo Nachfolgerinnen der selben einer angeblichen Liebelei halber enthalsen ließ, und so schieden sich laut Zeugnis der Geschichte vor ihm gar viele gewissenhafte Fürsten und Monarchen von ihren Gemahlinnen, obwohl keiner nachher in des frommen Königs Fußtapfen getreten ist.
Es war also kein Wunder, dass Graf Gombald, der Sitte und Denkungsart seines Zeitalters gemäß, eine schwere Gewissensrüge über die zu nahe Verwandtschaft mit seiner Gemahlin empfand, sobald ihm eine Liebschaft vorkam, die seiner Sinnlichkeit mehr behagte als diese. Die gute Dame mochte remonstrieren, soviel sie wollte, das Gewissen ihres Herrn zu beruhigen, es war vergebene Müh.
"Ach, liebster Gemahl", sprach sie, "wenn Ihr kein Erbarmen mit Eurer unglücklichen Gattin habt, so erbarmt Euch des unschuldigen Pfandes Eurer erstorbenen Liebe, welches ich unterm Herzen trage. Könnt ich's doch augenblicks Euch in die Armen geben, vielleicht rührte Euch der Anblick der Unschuld und brächte mir Euer abwendiges Herz zurück."
Ein Strom bitterer, gesalzener Zähren stürzte diesen Worten nach. Aber die eherne Brust des hartherzigen Mannes fühlte nicht die siebenfachen Leiden seiner Gemahlin, er verließ sie eilends, schwang sich aufs Ross und ritt gen Mecheln zum Erzbischof, löste mit schwerem Gelde einen Scheidebrief und verstieß sein treues, gutes Weib ins Kloster, wo sie sich so härmte und abzehrte, dass ihre Gestalt ganz zerfiel. Als ihre Stunde kam, genas sie eines Töchterleins, welches sie brünstiglich herzte, an den treuen mütterlichen Busen drückte und mit heißen Zähren netzte.
Aber der Engel des Todes stund neben ihr und drückte ihr schnell die Augen zu, dass sie sich des Anblicks des holden Kindes nicht lange erfreuen konnte. Bald darauf kam der Graf angeritten, nahm das Kindlein zu sich, tat es unter die Hand einer Gouvernante in eins seiner Schlösser und gab dem zarten Fräulein einige Dirnen und Hofzwerge zur Aufwartung; er aber rüstete sich aufs stattlichste aus: denn sein Streben und Sorgen war, die schöne Brabanterin zu erlangen.
Frohen Mutes zog er an den Hof der Gräfin Richilde, warf sich wonnetrunken ihr zu Füßen, und als sie den herrlichen Mann erblickte, nach welchem ihr Herz so lange geseufzt hatte, fühlte sie darinnen unausredbares Entzücken und schwur dem Ritter von Stund an den Bund der Treue. Ihr Palast verwandelte sich in ein Ida und Paphos, denn die Göttin Cythere schien ihre Residenz dahin verlegt zu haben.
In dem süßen Freudentaumel, unter den ausgesuchtesten Ergötzlichkeiten, entschwanden dem glücklichen Paare Tage und Jahre wie ein heiterer Morgentraum, und Gombald und Richilde beteuerten einander oft, dass man in den Vorhöfen des Himmels nicht glücklicher sein könne, als er und sie zusammen lebten; kein Wunsch war ihnen übrig als der, äonenlang ihr wechselseitiges Glück zu genießen ohne Wandel. Allein das glückliche Paar besaß zu wenig Philosophie, um einzusehen, dass ein fortwährender Genuss des Vergnügens eigentlich das Grab des Vergnügens ist, und dass diese Würze des Lebens, in zu starken Dosen genommen, dem selben allen Hochgeschmack und Anmut raubt.
Unvermerkt erschlafft die Reizbarkeit der Organe, das Gefühl der Lebensfreuden; alle Ergötzlichkeiten gewinnen einen einförmigen Gang, und die raffinierteste Abwechslung wird endlich auch ein fades Einerlei. Dame Richilde, nach ihrer veränderlichen Gemütsart, verspürte diese Unbequemlichkeit zuerst, wurde launisch, herrisch, kalt und mitunter eifersüchtig. Der Herr Gemahl befand sich auch nicht mehr in der ehemaligen Lage der Behaglichkeit: ein gewisser Spleen drückte seine Seele, der Minneblick im Auge war erloschen, und das Gewissen, womit er ehedem heuchlerischen Scherz getrieben, fing nun an, zu ernsten.
Es kam ihm der Skrupel ein, dass er seine erste Gemahlin gemordet habe; er gedachte der selben öfters mit Wehmut und vielen Lobsprüchen, und der Sage nach soll's nie gut Geblüt in der zwoten Ehe geben, wenn von der seligen Frau zu oft die Rede ist; es gab oft verschiedene Debatten mit Dame Richilde, und er sagte ihr zuweilen gerade ins Angesicht, dass sie die Stifterin alles Unglücks sei. "Wir können nicht ferner zusammen hausen", sprach er einstmals nach einem Ehezwist zu seiner Gemahlin, "mein Gewissen drängt mich, meine Schuld zu versühnen, ich will gen Jerusalem wallfahrten zum Heiligen Grabe und versuchen, ob ich dort die Ruhe meines Herzens wieder finden kann."
Gesagt, getan! Richilde widersetzte sich diesem Vorschlag nur schwach; Graf Gombald rüstete sich zur Wallfahrt, machte sein Testament, nahm lauen Abschied und zog davon. - Eh ein Jahr verging, kam Botschaft nach Brabant, dass der Graf in Syrien an der schwarzen Pest gestorben sei, ohne den Trost gehabt zu haben, am Heiligen Grabe seine Sünden abzubüßen. Die Gräfin empfing diese Zeitung mit großer Gleichmütigkeit, gleichwohl beobachtete sie äußerlich alle Regeln des Wohlstandes, sie wehklagte, weinte, hüllte sich in Boy und Flor nach den Vorschriften der Etikette, ließ auch dem seligen Herrn ein prächtiges Zenotaphium errichten, an welchem weinende Genien mit ausgelöschten Fackeln und Tränenkrügen nicht fehlten.
Inzwischen hat ein schlauer Menschenspäher längst bemerkt, dass junge Witwen geartet sind wie grünes Holz, welches an einem Ende brennt, wenn am anderen das Wasser herausträufelt. Das Herz der Gräfin Richilde konnte nicht lange unbeschäftigt bleiben. Die Trauer erhob ihre Reize so sehr, dass sich jedermann herzudrängte, die schöne Witwe zu sehen. Viele Glücksritter zogen an ihren Hof, ihr Heil zu versuchen und diese reiche Beute zu erhaschen, sie fand Anbeter und Bewunderer in Menge, und die Hofschmeichler waren, was das Lob ihrer Gestalt betraf, wieder vollkommen in Odem gesetzt.
Das gefiel der eitlen Frau ungemein wohl, weil sie aber doch gern Gewissheit von der Sache zu haben und überzeugt zu sein wünschte, dass der Finger der Zeit in fünfzehn Jahren keinen ihrer Reize verwischt habe, ratfragte sie deshalb ihren Wahrheitsfreund, den magischen Spiegel mit dem gewöhnlichen Spruche:
Spiegel blink,
Spiegel blank,
Goldner Spiegel an der Wand,
Zeig mir das schönste Weib
in Brabant
Schauer und Entsetzen befiel sie, als der seidne Vorhang aufrauschte und eine fremde Gestalt ihr ins Auge fiel, schön wie eine Huldgöttin, der liebenswürdigste weibliche Engel voll sanfter Unschuld, aber das Bild hatte von ihr selbst keinen Zug. Es ist schwerlich zu entscheiden, ob hier zwischen Frag und Antwort nicht ein Missverstand obwaltete. Die Gräfin nahm das Wort Weib vielleicht im engeren Sinn und verlangte zu wissen, ob sie unter den Frauen ihrer Provinz, mit Ausschluss junger, aufblühender Mädchen, noch den Preis der Schönheit behaupte, der Genius des Spiegels aber gab dem Wort eine größere Ausdehnung und verstand darunter die ganze Flora des Geschlechts.
Dem sei wie ihm wolle, die schöne Witwe geriet über die unerwartete Antwort auf ihre Frage in große Wut, und es fehlte wenig, dass sie den indiskreten Spiegel solches hätte entgelten lassen, und das hätte man ihr verzeihen müssen: denn für eine Dame, die kein anderes Talent als Schönheit empfangen hat, gibt es keine größere Kränkung als die, wenn der Wahrheitsfreund auf der Toilette den unwiederbringlichen Verlust des ganzen Wertes ihrer Existenz verkündet.
Dame Richilde, untröstlich über die gemachte Entdeckung, fasste gegen die unschuldige Schöne, die sich im Besitz ihres prätendierten Eigentums befand, einen tödlichen Hass, sie prägte sich das liebliche Madonnengesicht genau ins Gedächtnis, und forschte mit großem Fleiß nach der Inhaberin desselben. Diese Entdeckung kostete wenig Mühe; sie erfuhr gar bald, dass der Beschreibung nach ihre eigne Stieftochter Blanca, von ihr der Balg zubenannt, ihr den Preis der Schönheit abgewonnen habe.
Alsbald gab ihr der Satan ins Herz, diese edle Pflanze, die dem Garten Eden zum Schmuck würde gedient haben, zu vernichten. Die Grausame berief in dieser Absicht den Hofarzt Sambul zu sich, gab ihm einen gezuckerten Granatapfel, zählt' ihm fünfzig Goldstücken in die Hand und sprach: "Richte mir diesen Apfel so zu, dass die eine Hälfte davon ganz unschädlich sei, die andere aber von Gift beschwängert werde, dass, wer davon genießt, in wenig Stunden sterbe."
Der Jud strich freudig sich den Bart und das Geld in seinen Säckel und verhieß zu tun, wie ihm die arge Frau geboten hatte. Er nahm eine spitze Nadel, grub damit drei Löchlein in den Apfel und ließ darein fließen einen scharfen Liquor, und nachdem die Gräfin den Apfel in Empfang genommen, stieg sie auf ihr Ross und trabte in Begleitung weniger Hofdiener zu ihrer Tochter Blanca hin, auf das abgelegene Schloss, wo das Fräulein hauste. Unterwegs schickte sie einen reitenden Boten voraus, der ansagen sollte, dass die Gräfin Richilde im Anzuge sei, das Fräulein heimzusuchen und mit ihr über des Papas Verlust zu weinen.
Diese Botschaft brachte das ganze Schloss in Aufruhr. Die feiste Duena watschelte im Haus umher, treppauf, treppnieder, setzte alle Kehrbesen in Bewegung, ließ eilends aufputzen, die Spinnweben zerstören, die Gastzimmer schmücken und die Küche bereiten; schalt und trieb die trägen Mägde zu Fleiß und Arbeit an, lärmte und kommandierte mit lauter Stimme wie ein Kaperkapitän, der einen Kauffahrer in der Ferne wittert.
Das Fräulein aber schmückte sich bescheiden, kleidete sich in die Farbe der Unschuld, und wie sie die Rosse antrappeln hörte, flog sie ihrer Mutter entgegen, empfing sie ehrerbietig und mit offenen Armen. Die Gräfin fand das Fräulein beim ersten Anblick siebenmal schöner als die Kopie, welche sie im Spiegel erblickt hatte, und dabei so klug, so verständig und so sittsam. Das engte ihr das Herz ein; aber die Schlange verbarg das Natterngift tief in ihrem Busen, tat falsch freundlich gegen sie, klagte über den hartherzigen Papa, der ihr, solang er lebte, den holden Anblick des Fräuleins geweigert hätte, und verhieß von nun an, mit treuer Mutterliebe sie zu umfangen.
Bald darauf bereiteten die Zwerglein die Tafel und trugen ein herrlich Mahl auf. Beim Dessert ließ die Hofmeisterin das köstlichste Obst aus dem Schlossgarten aufsetzen. Richilde kostete davon, fand es dennoch nicht schmackhaft genug und forderte von einem Diener ihren Granatapfel, womit sie, wie sie sagte, jede Mahlzeit zu beschließen pflegte. Der Diener reichte ihr solchen auf einem silbernen Teller dar. Sie zerlegt' ihn gar zierlich und bot der schönen Blanca gleichsam zum Zeichen ihres Wohlwollens, die Hälfte davon.
Sobald der Apfel verzehrt war, saß die Mutter mit ihrem Hofgesinde wieder auf und ritt von dannen. Bald nach ihrem Abzug ward dem Fräulein weh ums Herz, die rosenfarbenen Wangen erbleichten, alle Glieder ihres zarten Leibes erbebten, die Nerven zuckten und hüpften, ihre liebevollen Äuglein brachen und schlummerten in den endlosen Todesschlaf hinüber.
Ach, was erhob sich für Jammer und Herzeleid innerhalb der Mauren des Palastes über das Hinscheiden der schönen Blanca, die wie eine hundertblätterige Rose von einer räuberischen Hand in der schönsten Blüte gepflückt wurde, weil sie die Zierde des Gartens war. Die wohlbeleibte Duena regnete Tränenströme wie ein aufgedunsener Schwamm, der durch einen heftigen Druck alle eingesogene Feuchtigkeit auf einmal von sich gibt.
Die kunstreichen Zwerge aber zimmerten einen Sarg von Föhrenholz, mit silbernen Schildern und Handhaben, und machten, um des Anblicks ihrer holden Gebieterin nicht auf einmal beraubt zu sein, ein Glasfenster darein, die Dirnen fertigten ein Sterbekleid vom feinsten Brabanter Linnen, kleideten die Leiche darin, setzen die Keuschheitskrone, einen frischen Myrtenkranz, auf ihr Haupt, und brachten mit Trauergepränge den Sarg in die Schlosskapelle, wo der Pater Meßner das Seelamt hielt und das Glöcklein vom Morgen bis zur späten Mitternachts stunde dumpfen Sterbeklang tönte.
Indessen langte Donna Richilde wohlgemut in ihrer Heimat an. Das erste, was sie tat, war, dass sie ihre Frage an den Spiegel wiederholte und behänd den Vorhang aufflattern ließ. Mit inniger Freude und der Miene des Triumphs erblickte sie ihre eigne Gestalt zwar wieder, aber auf der metallenen Oberfläche hatten sich hie und da große Rostflecken angesetzt, wodurch die helle Politur der selben, wie durch Blatternarben ein jungfräuliches Gesicht, entstellt war.
Was schadet's, dachte die Gräfin bei sich selber, immer besser, dass sie auf dem Spiegel haften, als auf meiner Haut, er ist dennoch zu gebrauchen und vergewissert mich wieder meines Eigentums. In Gefahr, ein Gut zu verlieren, lernt man gemeiniglich den Wert des selben erst schätzen. Die schöne Richilde hatte oft Jahre vorübergehen lassen, ohne den Spiegel über ihre Schönheit zu quästionieren, jetzt ließ sie keinen Tag vorbei. Sie genoss verschiedene Male das Vergnügen, ihrer Gestalt ein Götzenopfer zu bringen.
Wie sich aber eines Tages zu eben dieser Absicht der Vorhang hob, Wunder über Wunder, da schwebte im Spiegel ihren Augen wieder die Gestalt der reizenden Blanca vor. Bei diesem Anblick wandelte die eifersüchtige Frau eine Ohnmacht an, aber sie zog eilends ihr Riechfläschgen hervor, und durch Hülfe des Hirschhorngeistes ging das Übel bald vorüber, sie sammelte alle Kräfte, um zu erforschen, ob sie ein falscher Wahn getäuscht habe, doch der Augenschein belehrte sie eines anderen.
Sogleich brütete sie über einer neuen Bosheit. Sambul der Hofarzt wurde vorbeschieden, zu dem sprach die Gräfin mit zornmütiger Gebärde: "Oh, du schändlicher Betrüger, schelmischer Jud! verachtest du also mein Gebot, dass du meiner spotten darfst? Hieß ich dir nicht einen Granatapfel also zurichten, dass sein Genuss töte, und du hast Lebenskraft und Balsam der Gesundheit hineingelegt? Das sollen mir dein Judasbart und deine Ohren entgelten."
Sambul der Arzt entsetzte sich ob dieser Rede seiner erzürnten Gebieterin, antwortete und sprach: "Au, weih mir! Wie geschieht mir? Weiß nicht, gestrenge Frau, wie ich Eure Ungnade verwirkt hab. Was Ihr mir befohlen, hab ich fleißig ausgerichtet; hat die Kunst falliert, so ist die Ursache davon, was ich nicht weiß." Die Dame schien sich etwas zu besänftigen und fuhr fort:
"Diesmal sei dir dein Fehl verziehen, doch mit dem Beding, dass du mir eine wohlriechende Seife bereitest, die das unfehlbar leiste, was der Granatapfel verfehlt hat." Der Arzt verhieß, sein Bestes zu tun, sie zahlte ihm wieder fünfzig Goldstücke in seinen Säckel und entließ ihn. Nach Verlauf einiger Tage brachte der Arzt der Gräfin die mörderische Komposition. Flugs staffierte sie ihre Amme, ein abgefeimtes Weib, als eine Krämerin mit kurzer Ware heraus, gab ihr feinen Zwirn, Nähnadeln, wohlriechende Pomade, Riechfläschgen und marmorierte Seifenkugeln mit rotem und blauem Geäder in ihren Kasten und hieß sie damit zu ihrer Tochter Blanca wandern, um ihr die Giftkugel in die Hand zu spielen, verhieß ihr dafür große Belohnung.
Das feile Weib zog hin zu dem Fräulein, welches keinen Betrug ahndete und sich durch die arglistige Schwätzerin bereden ließ, die Seife, welche die Schönheit der Haut bis ins höchste Alter konservieren sollte, einzuhandeln und ohne Vorwissen ihrer Duena einen Versuch damit zu machen. Die arge Stiefmutter konsultierte indes den verrosteten Spiegel fleißig, vermutete aus der Beschaffenheit des selben, dass ihr Anschlag müsse geglückt sein, denn die Rostflecken hatten sich wie Salpeterfraß in einer Nacht über die ganze Spiegelfläche ausgebreitet, dass sich auf ihr Befragen nur ein trüber Schatten auf der matten Oberfläche darstellte, welchem keine Gestalt mehr abzugewinnen war.
Der Verlust des Spiegels ging ihr zwar zu Herzen, doch glaubte sie dadurch den Ruhm, die erste Schönheit im Lande zu sein, nicht zu teuer bezahlt zu haben. Eine Zeitlang genoss das eitle Weib mit geheimer Zufriedenheit dieses eingebildete Vergnügen, bis ein fremder Ritter an ihren Hof kam, der in dem Schloss der Gräfin Blanca unterwegs eingesprochen und sie nicht in der Gruft, sondern an der Toilette gefunden, und von ihrer Schönheit gerührt, sie zur Dame seines Herzens erkoren hatte.
Weil er nun die Gräfin von Brabant gern erlustieren und sich vor ihr auf dem Turnierplatz zeigen wollte, doch nicht vermeinte, dass die Mutter auf die Tochter eifersüchtig sei, warf er bei einem Freudenmahl, von Weindunst erhitzt, seinen eisernen Handschuh auf den Tisch und sprach: Wer das Fräulein Blanca von Löwen nicht für die schönste Dame in Brabant erkläre, solle den Handschuh an sich nehmen, zum Zeichen, dass er tags darauf zu Schimpf oder Ernst eine Lanze mit ihm. brechen wolle.
Über diese Unbesonnenheit des Gaskoniers skandalisierte sich der ganze Hof höchlich, man schalt ihn insgeheim Meister Duns und Ritter Großbrot. Richilde erbleichte über die Novelle, dass Fräulein Blanca nochmals aufgelebt sei; die Ausforderung war ihr ein Dolchstich ins Herz; doch zwang sie sich zu einem huldreichen Lächeln und genehmigte die Partie, hoffend, dass die Ritter ihres Hofes sich um den Handschuh reißen würden.
Wie aber keiner hervortrat, den Kampf anzunehmen, denn der Fremdling hatte ein keckes Ansehen, war fast nervig und von starken Knochen, machte sie ein gar trübseliges Gesicht, dass männiglich Verdruss und Herzeleid ihr abmerken konnte. Das erbarmte ihren getreuen Stallmeister, dass er den eisernen Handschuh aufnahm. Aber wie der Kampf des folgenden Tages begann, behielt der Gaskonier nach einem wackeren Rennen den Sieg und empfing den Ritterdank von der Gräfin Richilde, die vor Unmut zu sterben gedachte.
Vorerst ließ sie ihren Zorn an dem Arzt Sambul aus, er ward in den Turm geworfen, in Ketten geschlossen, und ohne weitern Verhör ließ ihm die gestrenge Frau den ehrwürdigen Bart Haar bei Haar ausraufen und reinweg beide Ohren abschneiden. Nachdem der erste Sturm vorüber war und die Grausame bedachte, dass ihre Tochter Blanca dennoch über sie triumphieren werde, wofern es ihr nicht gelingen sollte, sie durch List hinzurichten, denn das väterliche Testament hatte ihr alle Gewalt über die Tochter geraubt, so schrieb sie einen Brief an das Fräulein, so zärtlich, und freute sich ihrer Genesung so mütterlich, als ob ihr das Herz jedes Wort in die Feder diktiert hätte.
Diesen Brief gab sie ihrer Vertrauten, der Amme, ihn dem eingekerkerten Arzt zu bringen, benebst einen Zettel, darauf stunden geschrieben diese Worte: "Schleuß in diesen Brief Tod und Verderben ein für die Hand, die ihn öffnet. Hüte Dich, zum dritten Mal mich zu täuschen, so lieb Dir Dein Leben ist." Sambul der Jud simulierte lange, was er tun sollte, und klimperte nachdenklich an dem Geschmeide, als bet er sein jüdisch Paternoster an den Ketten ab. Endlich schien die Liebe zum Leben, obgleich in einem traurigen Kerker, mit einem Kopf ohne Ohren und einem Kinn ohne Bart, alle andre Betrachtungen zu überwiegen und er verhieß zu gehorchen.
Die Gräfin schickte den Brief durch einen reitenden Boten ab, der bei seiner Ankunft viel Grimassen machte, als enthalte der Brief Wunderdinge, auch wollt er nicht sagen, von wo er gekommen sei. Das Fräulein, begierig, den Inhalt zu erfahren, löste behänd das Siegel, las einige Zeilen, fiel auf den Sofa zurück, schloss die lichtvollen, blauen Augen und verschied.
Seit der Zeit erfuhr die mörderische Stiefmutter nichts mehr von ihrer Tochter, und obgleich sie oft Kundschafter ausschickte, so brachten ihr diese keine andere Botschaft, als dass das Fräulein aus ihrem Totenschlummer nicht mehr erwacht sei. Also war die schöne Blanca durch die Ränke des hässlichen Weibes dreimal gestorben und dreimal begraben.
Nachdem die getreuen Hofzwerge sie zum ersten Mal beigesetzt hatten und die Seelmessen angeordnet waren, hielten sie nebst den weinenden Dirnen bei der Gruft fleißig Wacht und schauten durch das Fensterlein oft in den Sarg, des Anblicks ihrer teuren Gebieterin noch solange zu genießen, bis die Verwesung ihre Gestalt vernichten würde.
Aber mit Verwunderung wurden sie gewahr, dass sich nach einigen Tagen die bleichen Wangen mit einer sanften Röte überzogen, auf den erblassten Lippen fing an der Purpur des Lebens wieder zu glühen, bald darauf schlug das Fräulein die Augen auf. Als das die aufwartenden Diener wahrnahmen, hoben sie freudig den Deckel vom Sarge, die schöne Blanca richtete sich auf und wunderte sich bass, da sie sich in einer Totengruft, und ihre Bedienung um sich her in tiefer Trauer erblickte. Eilends verließ sie den grausenvollen Ort und zitterte wie die Eurydice mit wankendem Knie aus dem Schattenreiche zum erquickenden Tageslicht herauf.
Der Arzt Sambul war im Grunde ein frommer Israelite, der an keiner Büberei Gefallen trug, außer wenn die Prädilektion für die edleren Metalle sein enges Gewissen zuweilen ins weite dehnte. Bei dem Granatapfel, welchen die Gräfin ihm darreichte, fiel ihm der Unglücksapfel aus dem Paradies ein, auch der goldene Apfel aus dem Garten der Hesperiden, welcher drei Göttinnen entzweite und Ursache war, dass eine herrliche Königsstadt verwüstet wurde, und er dachte alsbald bei sich selbst, es sei genug an dem Unfug, welchen zwei Äpfel bereits in der Welt gestiftet hätten, der dritte solle die Äpfelschuld nicht mehren.
Anstatt des Giftes, den er darin verbergen sollte, tingiert' er die Hälfte davon mit einer narkotischen Essenz, welche die Sinnen betäubte, ohne den Leib zu zerstören. Ebenso verfuhr er das zweite Mal mit der Seifenkugel, nur dass er die Poition des Mohnsafts mehrte, daher das Fräulein nicht zu der Zeit wie vorher erwachte und die Zwerglein wähnten, sie sei und bleibe tot, trugen sie also abermals zu Grabe und hüteten solches mit großem Fleiße, bis sie zur Freude ihres Hofgesindes dennoch wieder erwachte.
Der Schutzengel des Fräuleins sah die Gefahr, in welcher das Leben seiner Pflegebefohlnen schwebte, als die Todesfurcht den Arzt entschlossen machte, das Bubenstück der Vergiftung wirklich zu begehen. Darum schlüpft' er unsichtbar ins Gefängnis und begann mit der Seele des Juden einen heftigen Streit, die er nach langem Kampfe überwältigte und dem Überwundnen den Entschluss abnötigte, seiner Gewissenhaftigkeit den Hals ebenso standhaft aufzuopfern, als vorher den Bart und beide Ohren.
Vermöge seiner einmischen Kenntnisse quintessentierte er seinen einschläfernden Liquor in ein flüchtiges Salz, welches von der freien Luft alsbald aufgelöst und eingesogen wurde, damit bestrich er den Brief an die schöne Blanca, und als sie solchen las, empfing ihre ganze Atmosphäre eine betäubende Eigenschaft, indem sie den verfeinerten Magsamengeist einatmete. Die Wirkung davon war so gewaltsam, dass die Erstarrung des Körpers länger dauerte, also dass die ungeduldige Duena an dem Wiederaufleben ihrer jungen Herrschaft gänzlich verzweifelte und ihr zum dritten Mal die Exequien halten ließ.
Als das Hofgesinde eben mit dieser traurigen Feierlichkeit beschäftigt war und das Trauergeläut unablässig tönte, kam ein junger Pilger angeschritten, ging in die Kapelle, kniete sich vor den Altar in der Frühmetten und verrichtete seine Andacht.
Er hieß Gottfried von Ardenne, war ein Sohn Teutebald des Wüterichs, den die heilige Kirche seiner bösen Taten halber ausgestoßen und mit dem Bann belegt hatte, darunter er gestorben war, weshalb er von den Flammen des Fegfeuers wohl gepeinigt ward. Weil's ihm nun in der Glut viel zu heiß war, bat er den Engelpförtner flehentlich, ihn ein wenig hinaus ins Freie zu lassen, frische Luft zu schöpfen und den Seinen kund zu tun, welche Qual er leide. Diese Bitte ward ihm, auf sein Ehrenwort, sich zu rechter Zeit und Stunde wieder einzustellen, leicht zugestanden; denn in den damaligen Zeiten war gar schlechte Polizei in der Unterwelt, die Seelen schweiften scharenweise in die Oberwelt herauf, gaben ihren hinterlassenen Freunden nächtliche Besuche und hatten Freiheit, mit ihnen nach Belieben zu kosen. Heutzutage sind sie dagegen unter strenger Klausur, dürfen nicht mehr so frank und frei herumtosen und spuken gehen, die Lebenden molestieren und zu fürchten machen.
Teutebald nützte die Zeit seiner Beurlaubung aufs fleißigste, erschien seiner tugendsamen Wittib drei Nächte hintereinander, weckte sie aus dem süßen Schlafe, indem er ihre Hand mit der Spitze seines glühenden Fingers berührte und sprach: "Liebes Weib, habt Erbarmen mit Eurem abgeschiedenen Gemahl, den die Qualen der Vorhölle peinigen, versöhnt mich mit der heiligen Kirche und erlöst meine arme Seele, auf dass Euch auch dereinst Barmherzigkeit widerfahre."
Die Wittib nahm diese Worte zu Herzen, redete davon mit ihrem Sohn, gab ihm Juwelen und Geschmeide, und der biedere Jüngling nahm einen Pilgerstab in seine Hand, wallfahrtete barfuss nach Rom zum Papst und erhielt Ablass für seinen Vater unter dem Beding, auf dem Heimwege in jeder Kirche, wo er vorüber zöge, eine Messe zu hören. Er nahm einen großen Umweg, um viele heilige Orte zu besuchen, und so kam er auch durch Brabant.
Wie der fromme Pilger seinem Gelübde Genüge geleistet und seiner Gewohnheit nach in den Armenstock eine milde Gabe geopfert hatte, frug er den Bruder Küster, warum die Kapelle schwarz behangen sei und was das castrum doloris bedeute? Dieser erzählte ihm der Länge nach alles, was sich zugetragen hatte mit der schönen Blanca, durch die boshaften Ränke ihrer Stiefmutter.
Darüber verwunderte sich Gottfried gar höchlich und sprach: "Ist's vergönnt, den Leichnam des Fräuleins zu schauen, so führt mich zur Gruft. So Gott will, mag ich sie wohl wieder ins Leben rufen, wenn anders ihre Seele noch in ihr ist. Ich trage eine Reliquie, vom Heiligen Vater verehrt, bei mir, das ist ein Splitter vom Stab Elisä des Propheten, die zerstört die Zauberei und widersteht auch allen sonstigen Eingriffen in die Gerechtsame der Natur."
Der Küster rief eilends die wachsamen Zwerge herbei, und da sie hörten die Worte des Pilgers, freuten sie sich sehr, führten ihn hinab in die Gruft, und Gottfried ward entzückt über den Anblick des schönen alabasternen Bildes, welches er durchs Glasfenster im Sarg erblickte. Der Deckel wurde abgehoben, er hieß das leidtragende Gesinde hinausgehen bis auf die Zwerglein, brachte seine Reliquie hervor und legte sie auf das Herz der Erstorbenen. Nach wenigen Augenblicken verschwand die Erstarrung, und Geist und Leben kehrten in den erblassten Körper zurück.
Das Fräulein verwunderte sich über den holden Fremdling, den sie neben sich erblickte, und die hocherfreuten Zwerge hielten den Wundermann für einen Engel vom Himmel. Gottfried sagte der Erwachten an, wer er sei und die Ursache seiner Wallfahrt, und sie berichtete ihm dagegen ihre Schicksale und Verfolgungen der grausamen Stiefmutter. "Ihr werdet", sprach Gottfried, "den Nachstellungen der Giftspinne nicht entgehen, sofern Ihr nicht meinem Rate folgt.
Verweilt noch eine Zeitlang in dieser Gruft, damit es nicht ruchbar werde, dass Ihr lebt. Ich will meine Wallfahrt vollenden und bald wiederkommen. Euch nach Ardenne zu meiner Mutter zu führen und, so ich's enden mag, an Eurer Mörderin Euch rächen." Der Rat gefiel der schönen Blanca wohl, der edle Pilger verließ sie und sprach draußen zu dem herzudringenden Gesinde mit verstellten Worten: "Der Leichnam Eurer Herrschaft wird nimmer wieder erwarmen, die Quelle des Lebens ist versiegt, hin ist hin, und tot ist tot!"
Die treuen Zwerge aber, die um die Wahrheit wussten, hielten reinen Mund, versorgten ihr Fräulein insgeheim mit Speise und Trank, hüteten übrigens des Grabes wie vorher und harrten auf die Wiederkehr des frommen Pilgers.
Gottfried sputete sich, nach Ardenne zu gelangen, umarmte seine zärtliche Mutter, und weil er müde war von der Reise, legte er sich zeitig zur Ruhe und schlief mit dem Gedanken an Fräulein Blanca flugs und fröhlich ein. Da erschien ihm sein Vater im Traum mit heiterem Angesicht, sprach, er sei aus dem Fegfeuer erlöst, erteilte dem frommen Sohn den Segen und verhieß ihm Glück zu seinem Vorhaben. Am frühen Morgen rüstete Gottfried sich ritterlich, nahm seine Reisigen zu sich, beurlaubte sich von der Mutter und saß auf.
Wie er seine Reise nun bald vollendet hatte und in der Mitternachtsstunde das Totenglöcklein im Schloss der schönen Blanca tönen hörte, saß er ab, zog sein Pilgerkleid über den Harnisch und verrichtete seine Andacht in der Kapelle. Die spekulierenden Zwerge hatten kaum den knienden Pilger am Altar wahrgenommen, so liefen sie hinab in die Gruft, ihrer Gebieterin die gute neue Mär zu verkünden. Sie warf ihr Sterbegewand von sich, und sobald die Metten vorbei war und Meßner und Küster aus der frostigen Kirche nach dem warmen Bett eilten, stieg das reizende Mädchen herauf aus der Totengruft, mit fröhlichem Herzklopfen, wie am Tage der letzten Posaune die Seligen aus der dunkeln Grabeshöhle zum Leben hervorgehen werden.
Da sich aber das tugendsame Fräulein in den Armen eines jungen Mannes sah, der sie davonführen wollte, kam sie Grausen und Entsetzen an, und sie sprach mit verschämtem Angesicht: "Bedenkt, was Ihr tut, junger Mann, fragt Euer Herz, ob es aufrichtig oder ein Schalk ist; täuscht Ihr das Vertrauen, das ich zu Euch hege, so wisst, dass Euch die Rache des Himmels verfolgen wird." Der Ritter antwortete bescheidentlich: "Die heilige Jungfrau sei Zeuge der Lauterkeit meiner Gesinnung, und der Fluch des Himmels treffe mich, wenn ein sträflicher Gedanke in meiner Seele ist."
Darauf schwang sich das Fräulein getrost aufs Ross, und Gottfried geleitete sie sicher nach Ardenne zu seiner Mutter, welche sie mit innigster Zärtlichkeit empfing und mit solcher Sorgfalt pflegte, als wäre sie ihre leibliche Tochter. Bald entwickelten sich die sanften sympathetischen Gefühle der Liebe in dem Herzen des jungen Ritters und der schönen Bianca. Die Wünsche der guten Mutter und des ganzen Hofes vereinbarten sich, das schöne Bündnis des edlen Paares durch das heilige Sakrament der Ehe, je eher, je lieber, versiegelt zu sehen.
Aber Gottfried gedachte, dass er seiner Braut Rache gelobt hätte. Mitten unter den Zubereitungen zum Beilager verließ er seine Residenz und zog nach Brabant zur Gräfin Richilde, die noch immer mit ihrer zwoten Wahl beschäftigt war und, weil sie den Spiegel nicht mehr ratfragen konnte, damit nie zustande kam.
Sobald Gottfried von Ardenne am Hof erschien, zog seine schöne Gestalt die Augen der Gräfin auf sich, dass sie ihm vor allen Edlen den Vorzug gab. Er nannte sich den Ritter vom Grabe, und das war das einzige, was sie an ihm auszusetzen fand; sie wünschte ihm einen gefälligem Beinamen, denn das Leben hatte für sie noch so viele Reize, dass ihr der Gedanke vom Grabe immer schauderhaft auffiel. Inzwischen erklärte sie sich den Beinamen des Ardenners vom Heiligen Grabe, meinte, er sei irgend nach Jerusalem gewallfahrtet und sei Ritter vom Heiligen Grabe, und so ließ sie es ohne weitere Nachforschung dabei bewenden.
Nachdem sie mit ihrem Herzen über die aufkeimende Leidenschaft Rücksprache genommen hatte, fand sie, dass unter der gesamten Ritterschaft, die darinnen aus- und einzog, Ritter Gottfried prädominiere, deshalb legte sie's darauf an, ihn durch die verführerischen Netze der Koketterie zu bestricken. Durch die Kunst wusste sie die Reize der Jugend wieder aufzufrischen, die abgeblühten zu verbergen, oder mit dem kunstreichen Gewebe feinsten Brabanter Spitzen zu bedecken.
Sie unterließ dabei nicht, ihrem Endymion die anlockendsten Avancen zu machen und ihn auf alle Art zu reizen, bald in dem prunkvollen Gewand, das ehemals Dame Juno an einem Galatage im hohen Olymp selbst nicht reicher tragen konnte; bald im verführerischen Neglige einer leicht geschürzten Grazie; bald bei einem tête-à-tête im Lustgarten, am Springbrunnen, wo marmorne Najaden aus ihren Urnen einen Silberstrom ins Bassin rauschen ließen; bald bei einer traulichen Promenade Hand in Hand, wenn der freundliche Mond sein falbes Licht durch die dunkeln Bogengänge des ernsten Taxus goss; bald in der schattigen Laube, wenn ihre melodische Hand dem horchsamen Ritter die weichsten Akkorde ins Herz zu lautenieren gedachte.
Mit scheinbarem Enthusiasmus umfasste Gottfried einsmals bei einer solchen empfindsamen Entrevue der Gräfin Knie und sprach: "lasst ab, holde Grausame, durch Euren mächtigen Zauber mein Herz zu zerreißen und schlafende Wünsche aufzuwecken, die mir das Hirn verwirren: Liebe ohne Hoffnung ist bitterer denn der Tod." Sanft lächelnd hob ihn Richilde mit ihren schwanenweißen Armen auf und gegenredete mit süßer Suada also:
"Armer Hoffnungsloser, was macht Euch mutlos? Seid Ihr so ungelehrig, die Sympathien der Liebe, die aus meinem Herzen Euch entgegenwallen, zu empfinden oder darauf zu achten? Wenn Euch die Sprache des Herzens unverständlich ist, so nehmt das Geständnis der Liebe von meinem Munde. Was hindert uns, das Schicksal unseres Lebens auf ewig zu vereinbaren?" -
"Ach", seufzte Gottfried, indem er Richildens sammetweiche Hand an die Lippen drückte, "Eure Güte entzückt mich; aber Ihr kennt nicht das Gelübde, welches mich bindet, keine Gemahlin als von der Hand meiner Mutter zu empfangen und diese gute Mutter auch nicht zu verlassen, bis ich die letzte Kindespflicht erfüllt und ihr die Augen zugedrückt habe. Könnt Ihr Euch entschließen, teure Gebieterin meines Herzens, Euer Hoflager zu verlassen und mir nach Ardenne zu folgen, so wär mein Los das glücklichste auf Erden."
Die Gräfin bedachte sich nicht lange, sie willigte in alles, was ihr Inamorato begehrte. Der Vorschlag, Brabant zu verlassen, behagte ihr im Grunde eben nicht, noch weniger die Schwiegermutter, die ihr eine lästige Zulage zu sein schien; allein die Liebe überwindet alles.
Mit großer Behändigkeit wurde der Brautzug veranstaltet, das Personale des glänzenden Gefolges ernannt, darunter auch der Hofarzt Sambul paradierte, ob ihm gleich der Bart und beide Ohren mangelten.
Die schlaue Richilde hatte ihn der Banden entledigt, auch ihm huldreich die Ehre der ehemaligen Favoritenschaft wieder angedeihen lassen, denn sie gedachte sich seiner zu bedienen, die Schwiegermutter gelegentlich aus der Welt zu schaffen, um mit ihrem Gemahl nach Brabant zurückzukehren.
Die ehrwürdige Matrone empfing ihren Sohn und die vermeintliche Schnur mit hofmäßiger Etikette, schien die getroffene Wahl des Ritters vom Grabe höchlich zu billigen, und es wurde alles fördersamt in Bereitschaft gesetzt, das Beilager zu vollziehen. Der feierliche Tag erschien, und Dame Richilde, geschmückt wie die Königin der Fayen, trat in den Saal, wo sie zur Trau geführt werden sollte und wünschte, dass die Stunden Flügel hätten.
Indessen kam ein Edelknabe herbei und raunte mit bedenklicher Miene dem Bräutigam etwas ins Ohr. Gottfried schlug mit scheinbarem Entsetzen die Hände zusammen und sprach mit lauter Stimme: "Unglücklicher Jüngling, wer wird an deinem Ehrentage den Brautreihen mit dir anheben, da eine mörderische Hand deine Geliebte gemordet hat?" Hierauf wendete er sich zur Gräfin und sprach:
"Wisset, schöne Richilde, dass ich zwölf Jungfrauen ausgesteuert habe, die mit mir zum Traualtar gehen sollten, und die Schönste darunter ist aus Eifersucht von einer unnatürlichen Mutter gemordet; sprecht, welche Rache diese Schandtat verdiene?" Richilde, unwillig über einen Zufall, der ihre Wünsche aufzuhalten oder doch die Freude des Tages zu mindern schien, sprach mit Unwillen:
"O der schaudervollen Tat! Die grausame Mutter verdiente, an der Gemordeten Stelle den Brautreihen mit dem unglücklichen Jüngling in glühenden eisernen Pantoffeln anzuheben, das würde Balsam für die Wunde seines Herzens sein, denn die Rache ist süß wie die Liebe." -
"Ihr urteilet recht", erwiderte Gottfried, "Amen, es geschehe also!" Der ganze Hof applaudierte der Gräfin wegen des gerechten Urteils, und die Witzlinge vermaßen sich hoch und teuer, die Königin aus dem Reich Arabien, die zu Salomon gewallfahrtet war, Weisheit zu holen, hätte es nicht besser sprechen mögen.
In dem Augenblicke flogen die hohen Flügeltüren des Nebengemachs auf, wo der Traualtar zugerichtet war. Darin stund der weibliche Engel, Fräulein Blanca, mit herrlichem Brautschmuck angetan; sie stützte sich auf eine der zwölf Jungfrauen, als sie die fürchterliche Stiefmutter erblickte, und schlug scheu die Augen nieder.
Richildens Blut erstarrte in den Adern, wie vom Blitz gerührt sank sie zu Boden, ihre Sinne umnebelten sich, und sie lag starr im Hinbrüten. Aber die Riechfläschgen der Höflinge und Damen gossen einen so kräftigen Platzregen von Lavendelgeist über sie, dass sich wider Willen ihre Lebensgeister ermunterten. Darauf hielt der Ritter vom Grabe einen Sermon an sie, davon ihr jedes Wort durch die Seele schnitt, und führte die schöne Blanca zum Altar, wo der Bischof in pontificalibus das edle Paar zusammen gab, nebst den zwölf ausgesteuerten Jungfrauen mit ihren Geliebten.
Wie die geistliche Zeremonie geendigt war, ging der gesamte Brautzug in den Tanzsaal. Die künstlichen Zwerge hatten indessen mit großer Behändigkeit ein Paar Pantoffeln von blankem Stahl geschmiedet, stunden am Kamin, schürten Feuer an und glühten die Tanzschuhe hochpurpurrot. Da trat hervor Gunzelin, der knochenfeste gaskonische Ritter, und forderte die Giftnatter zum Tanz auf, den Brautreihen mit ihr zu beginnen, und ob sie sich gleich diese Ehre höchlich verbat, so half doch kein Bitten noch Sträuben.
Er umfasste sie mit seinen kräftigen Armen, die Zwerglein schuheten ihr die glühenden Pantoffeln an, und Gunzelin schliff mit ihr einen so raschen Schleifer längs dem Saal hinab, dass der Erdboden rauchte und ihre zarten, wohlgeratenen Füße kein Hühnerauge mehr quälte, dazu waldhornierten die Musikanten so herzhaft, dass alles Gewinsel und Wehklagen in die rauschende Musik verschlungen ward. Nach unendlichen Wirbeln und Kreisen drehte der flinke Ritter die erhitzte Tänzerin, welche noch nie ein Schleifer so heiß gemacht hatte, zum Saal hinaus, die Stiegen hinab in einen wohlverwahrten Turm, wo die büßende Sünderin Zeit und Muße hatte, Pönitenz zu tun. Sambul der Arzt aber kochte flugs eine köstliche Salbe, welche die Schmerzen linderte und die Brandblasen heilte.
Gottfried von Ardenne und Blanca lebten in einer paradiesischen Ehe und belohnten reichlich den Arzt Sambul, der wider Gewohnheit seiner Kollegen nicht tötete, wo er's durfte. Auch ward ihm sein Biedersinn oben im Himmel zum Segen angeschrieben; sein Geschlecht blüht noch in späten Enkelsöhnen. Einer seiner Nachkommen, der Jud Samuel Sambul, steht hocherhaben wie eine Zeder im Hause Israel, dient Seiner mauritanischen Majestät, dem König in Marokko, als erster Minister und lebt, einige Bastonaden auf die Fußsohlen abgerechnet, in Glück und Ehre bis auf diesen Tag.
Johann Karl August Musäus
DER WASSERVERKÄUFER ...
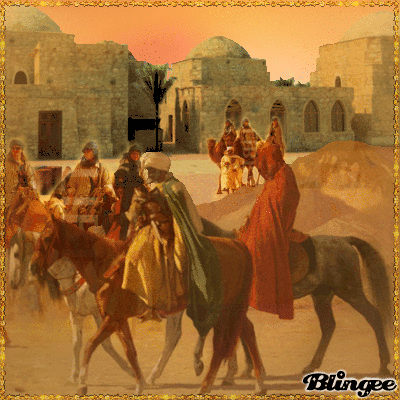
Auf einem Gut am Fuße des Spessarts war ein Bauer verstorben, dessen Söhne dem Hof den Rücken gekehrt und in der Stadt ihr Auskommen gefunden hatten. So fand sich keiner, der hätte weiter dort wirtschaften mögen und das Gut ward an einen wohlhabenden Handelsmann aus dem Orient gegeben, der die größte Menge Geldes geboten.
Dieser setzte die Bewohner des Tals schon bald in großes Erstaunen, wie er schon nach wenigen Monden den ärmlichen Hof in ein prunkvolles Herrenhaus umwandelte. Die Wände glitzerten von Marmor, edle Steine und Mosaike umrankten die kunstvoll gefertigten Fenster, ein eisernes Tor ward vom besten Schmied des Landes gefertigt, so ein Stück hatte noch keiner gesehen und im Hofe wuchsen Palmen neben einem plätschernden Brunnen, um den gezähmte Raubkatzen strichen.
Bei all dem war der neue Herr des Hauses freundlich und umgänglich, kaufte gern in den kleinen Läden im Nachbarort und ließ die Leute in seinem Anwesen ein- und ausgehen, als ob für ihn ein Fremder und ein Gast ein und dasselbe seien.
Ein Ratsherr aus dem Dorfe frug schließlich den Handelsmann, wie er denn zu seinem Reichtum gekommen und womit er Gewerbe treibe. Dieser gab ihm zur Antwort, ein Wasserverkäufer sei er, wie schon sein Vater, sein Großvater und alle seine Vorfahren, die ihm bekannt wären. Im fernen Afrika und im Perserlande habe er Wasser feilgeboten und damit die Kehlen der durstigen Reisenden erfrischt. Darob war die Verwunderung groß, denn, so fragten die Leute, wie könne denn einer allein mit dem kühlen Trank sein Vermögen machen, auch wenn es, wie im Orient, rarer sei als im regenreichen Spessartwalde.
Das Tränklein sei, so entgegnete der Fremde, auch im Orient wohlfeil gewesen, denn allerorten habe es Wasserstellen und der Zisternen genug selbst in der weitesten Ödnis gegeben. Er habe indes nach etlichen Jahren des einfachen Lebens nicht nur mit dem Nass, sondern auch mit Kamelen und Viehzeug begonnen zu handeln. So seien der Wasserstellen nicht weniger geworden, aber das Wasser habe nun wohl auch den Tieren als Tränke gedienet und nicht wenige warden verschmutzt, so dass die Reisenden das Wasser verschmäht, wollten sie nicht in Siechtum verfallen.
Also sei reines Wasser ein teures Gut geworden, mit dem er und seine Familie viel Gold und Geld angehäufet. Wenn aber ein Wasser aus dem Lande der Käufer gekommen, hätten sie schon dessentwegen ihm misstraut und es verschmäht. So galt bald nur noch als ein edles Nass, was über viele Tagesreisen herangebracht ward.
„Hört den weisen Mann“, sprachen da so manche Leute, „warum sollten wir da Wasser verschenken, wenn so grosser Wert aus ihm ersprießt?“ Und sie trieben ihr Viehzeug in die Quellen und Bäche und überließen ihre Fluren der Kunst der Alchemisten, bis der letzte Brunnen verdorben.
Alsdann leiteten sie von fern aus dem Bachgau und dem Alzenauer Land das Wasser in die Dörfer, das war so hart und schlecht, dass es nur mit großer Mühsal zum Trunke bereitet werden konnte und war, auch wenn es teuer bezahlt werden mußte, doch nur ein schändliches Gesöff. Wohl aber waren die Dorfoberen nun der lästigen Sorge um die Brunnen enthoben, die Bäuerlein konnten auf den Feldern treiben, was ihnen gutdünkte, und das Geld floß reichlich in die Taschen der Wassermeister.
Anderorten führten die Dorfoberen die edleren Quellen des Spessartwaldes durch die Rohre der Stadt Frankfurt, und man sann, einen großen Speicher im tiefen Wald zu errichten, dessen Wasser man für teures Geld in die großen Städte des Frankenlandes zu verkaufen trachtete.
Doch weiteres erzählte sodann der Fremde aus dem Morgenland:
Märchenhafte Schätze hätten seine Karawanen bis aus dem fernen Chinesenlande heran geschafft: feinstes Porzellan sei die Zierde der Zelte geworden, in ihnen duftiger Tee aus Indien; kunstvoll gewebte Teppiche aus dem Perserlande hätten den Boden bedeckt. Da aber die Taglöhner aus den fernen Landen von unübertrefflicher Bescheidenheit wären, so trügen die Kamele die Gürtel des Maghreb zum fernen Hispanien, nur um die Ösen zu stanzen, und wieder her; ein Kefir käme aus dem fernen Kaukasus, der Topf, worin er bereitet, aus dem kühlen Lappenland.
So die Bauern des Alpenlandes für ihre Viehherden und ihren Rahm von den Landesfürsten extra belohnt, bedienten sie sich nun der Fleischtöpfe Ägyptens und strichen gleichermaßen die Subsidien ein. Köstlicher schwarzer Reis käme aus dem Indianerland, Fisch von den Quellen des Nils in Afrika, Nüsse von der Elfenbeinküste, Pfeffer, Zimt und Saffaran von den Molukkeninseln, wo dergleichen überhaupt nichts wert, hier aber mit Gold aufgewogen würde. Und all dies hätten seine Karawanen bewirkt, für die allerorten Wege eingerichtet, an deren Umschlagplätzen die ganze Welt sich am Reichtum des Orient erbauen könnte.
Und die Ratsherren der Dörfer beschlossen reihum, Wege zu bauen bis in das Morgenland. Bald durchzogen etlich neue Straßen in allen Himmelsrichtungen die Wälder des Spessart, große Wagen bevölkerten die einstmals verträumten Dörfer, das grobe Holz der Spessartforsten blieb auf den Haufen sitzen, statt der faden Äpfel und fauligen Pflaumen bedeckten Datteln, Feigen und Mangofrüchte die Ladentische und ließen die Körbe auf den Märkten überquellen. Ein jeder sah um sich herum den Überfluss des Orients und gab gar vieles auf sich, dem armseligen Treiben der Dorfbauern ein Ende geboten zu haben.
Nun aber war es an einem unschuldigen Knäblein, den Herrn aus dem Morgenlande zu fragen, warum er wohl, wenn sein Heimatland von Gold und Elfenbein geschaffen, dieses verlassen und nicht mehr unter den seinen verweilen wollte.
Da senkte der Fremde den Blick, schwieg eine geraume Weile und sprach dann, wo er einst unter Palmen gelegen, wäre heute wüstes Land. Die Brunnen seien versiegt, die Häuser verfallen und die Wege vom Sand bedeckt. Er aber zöge es nicht vor, auf hartem Fels sein Lager einzunehmen und dasselbe mit Skorpionen und Schlangen zu teilen. Dann erhob er sich und begab sich in seine Gemächer.
Hierauf schwieg so mancher Dorfrat, den fein gekleideten Bürgern wollten die süßen Früchte nicht mehr so recht schmecken und ihre Blicke mochten an den Tischen aus den edlen Hölzern Amazoniens keinen Gefallen mehr finden.
Darob aber gerieten die Alten des Dorfes, dem der Knabe entstammte, in großen Zorn. Heftig gescholten ward er, über das Knie gelegt und ordentlich durchgebläut, sodann angewiesen, das Haus seiner Eltern aufzusuchen und dem des Handelsmanns fortan fern zu bleiben. Einige aber liefen dem Muselmann hinterdrein, mischten in seinen Saft Branntwein, um ihn fröhlich zu stimmen, und ließen nicht eher von ihm ab, bis er sich wieder zu den Gästen begab, bleich und schwankend zwar, aber ohne dunkle Gedanken, die ihnen das Gemüt hätten bewegen können.
Noch am Tage darauf traf eine Karawane ein, die brachte Fichtenhölzer aus dem fernen Sibirien, Kartoffeln aus Ägypten, Wasser von den Felsen der Insel Madagaskar, Tuche aus Abessinien und Leder vom sagenhaften Indusland. Und die Hölzer wurden sogleich weiter zum Entrinden nach Siebenbürgen verschickt, die Kartoffeln zum Schälen nach Galizien, das Tuch verschiffte man zum Verschneiden auf die philippinischen Inseln, das Leder ward in den Bergen des Atlas zu Bällen vernäht.
Das Wasser von der Madagasseninsel ward indessen in kristallene Flaschen gefüllt und teurer als Wein verkauft. In die Behälter des kostbaren Guts füllte man indessen feinen Sand aus den Gruben der Spessarttäler und verbrachte ihn in die große Sahara, wo für den Obersten der Karawansereien Mauerwerk für ein großes Bad erstellt werden sollte. Und wer das große Werk verrichtet sah, pries den Morgenländer ob seiner großen Weisheit, die dem Lande so unermeßlichen Reichtum beschert und bat Gott, dass er ihm noch ein langes Leben bescheren möge.
Deutschland-Unbekannt
DAS WUNDERSCHIFF ...
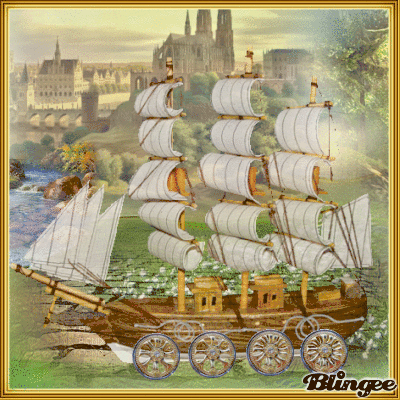
Es war einmal ein reicher König, der hatte die seltsamsten Wünsche. Eines Morgens befahl er: "Man baue mir ein Schiff, mit dem ich zu Wasser und zu Lande fahren kann!" Noch am selben Tage ließ sein Kanzler im ganzen Reich durch Herolde verkünden: "Wer es vermag, dem König ein Schiff zu bauen, mit dem er zu Wasser und zu Lande fahren kann, der bekommt seine Tochter zur Frau und soll nach ihm König werden!"
Diese Kunde hörte auch ein reicher Sägmüller, der drei Söhne hatte. Er rief sie zu sich und sagte: "Ich will gern alles aufwenden, was ich habe. Versucht's, ob einer von euch ein solches Schiff zuwege bringt!" Die Söhne waren gleich bereit dazu; als sie sich aber darum stritten, wer es mit dem Bau zuerst versuchen dürfe, bestimmte der Vater, daß der älteste den Anfang machen solle.
Der zog auch gleich mit den Knechten hinaus in den Wald, um das nötige Holz zum Schiffsbau zu fällen. Sie hatten schon eine stattliche Anzahl Tannen gehauen, da kam ein alter Mann den Waldweg daher und bat um ein Stück Brot. Der junge Sägmüller aber sagte: "Ich habe nur Brot für mich und meine Leute und kann dir nichts abgeben!" "Was willst du denn da mit deinen Leuten machen?" fragte der Alte. - "Ein Schiff mit dem man zu Wasser und zu Lande fahren kann!" schnarrte ihn der Junge an. - "Das werdet ihr wohl bleibenlassen !" entgegnete der Mann und ging weiter. Und wie er gesagt hatte, so geschah es auch. Sie arbeiteten lange und konnten das Schiff doch nicht zustande bringen.
Als der älteste Sohn unverrichteter Dinge nach Hause kam, zog der zweite aus. Die Sonne sank, und er wollte mit den Knechten gerade Feierabend machen, als wieder der alte Mann dahergestockt kam und um ein Stück Brot bat. "Für fremde Leute haben wir kein Brot!" bekam er zur Antwort. Darauf fragte der Mann: "Was wollt ihr denn hier machen?" - "Ein Schiff das zu Wasser und zu Lande fahren kann!" - "Das werdet ihr wohl bleibenlassen!" sagte der Alte und ging weiter. Und er behielt recht. Auch der zweite Sohn mußte nach vergeblicher Mühe wieder umkehren.
Jetzt kam die Reihe an Hans, den jüngsten. Er rief die Arbeiter zusammen, zog in den Wald hinaus und legte hurtig Hand ans Werk. Gegen Abend kam auch zu ihm der alte Mann und bat um ein Stückchen Brot. - "Gerne", sagte Hans. "Setzt Euch nur her zu mir." Und er reichte ihm Brot und Käse und füllte ihm einen Becher mit Wein. Der Alte bedankte sich und fragte nach einer Weile : "Was wollt ihr denn da machen?" - "Ein Schiff, mit dem man zu Wasser und zu Lande fahren kann", antwortete Hans. - "So, so", sagte der Mann. - "Meine zwei Brüder haben es schon vor mir versucht, aber es ist ihnen nicht gelungen", erzählte Hans.
Der Alte nickte: "Ich weiß es. Auch du würdest es nicht zuwege bringen. Weil du aber der beste von euch drei Brüdern bist, sollst du das Glück haben, die schöne Königstochter zu freien. Komm zu dieser Stunde über drei Tage hierher an diesen Platz, so will ich dir das Schiff mitbringen. Pünktlich zur ausgemachten Stunde erschien der Alte und übergab dem Hans das Wunderschiff, das zu Wasser und zu Lande fahren konnte. Wie staunte da der junge Bursche und kannte sich fast nicht mehr vor Freude. "Nun, steig ein!" sagte der Mann. "Und fahr mit Glück!" - Ehe Hans sich aber umsah, seinem Helfer zu danken, war der Fremde verschwunden. Da stieg er ins Schiff und machte sich ohne Aufenthalt auf den Weg in die Hauptstadt und zum Palaste des Königs.
Wie er so mit seinem Schiff über Land und Wasser dahin segelte, sah er vor einem Wald einen Jäger stehen. Der hatte das Gewehr angelegt und zielte ins Blaue hinein. Da hielt Hans sein Schiff an und fragte: "Wonach zielst du denn?" - Der Jäger sagte: "Ich will den Spatzen schießen, der in dem Dorf hinterm Wald auf der Kirchturmspitze sitzt." - Hans meinte: "Das ist doch nicht möglich!" - Der Schütze aber behauptete: "Mit diesem Gewehr kann ich auf vierhundert Stunden weit jeden Vogel treffen!" - "Willst du nicht mitfahren?" fragte Hans. - "Das möchte ich schon gerne; aber ich habe kein Geld." - "Das tut nichts!" sagte Hans. Da setzte sich der Jäger zu ihm in das Schiff und sie fuhren miteinander weiter.
Sie waren noch nicht lange unterwegs, da trafen sie einen Mann, der hatte auf der rechten Seite ein ungeheuer langes Ohr. Es reichte bis auf den Boden. Hans hielt sein Schiff an und fragte den Mann: "Was fängst du denn mit deinem langen Ohr an?" - "Damit kann ich auf vierhundert Stunden weit alles hören, was gesprochen wird", entgegnete er. - "Ei, so horch einmal, was man im Königsschloß spricht!" sagte Hans. Da horchte der Langohr ein Weilchen hin und sagte: "Man spricht dort gerade von dem Wunsch des Königs, der ein Schiff haben will, das zu Wasser und zu Lande fahren kann. Aber die Minister sagen, es sei nicht möglich, ein solches zu bauen." - "Willst du nicht mitfahren?" fragte Hans. "Ja, das möchte ich schon gerne, aber ich habe kein Geld." - "Das tut nichts!" sagte Hans, ließ ihn einsteigen und fuhr weiter.
Bald begegneten sie wieder einem Mann; der hatte ganz gewaltig große Stiefel an den Yüßen. Hans hielt sein Schiff an und fragte ihn: "Was machst du denn mit den großen Stiefeln?" - Der Mann antwortete: "In diesen Stiefeln komme ich schneller voran als der Wind!" - "Ei, willst du nicht mitfahren?" fragte Hans. - "Dazu hätte ich schon Lust, aber ich habe kein Geld, um die Fahrt zu bezahlen." - "Das tut nichts!" sagte Hans, und so fuhr der Schnelläufer auch mit.
Über eine Weile sahen sie noch einen vierten Mann am Wege stehen. Dem ragte ein großer Holzzapfen aus seinem Hosenboden. Darüber wunderte sich Hans sehr und hielt darum sein Schiff an. Er fragte den Mann: "Warum hast du dahinten einen Zapfen stecken?" - "Das hat seinen guten Grund", antwortete der Mann; "denn wenn ich den Zapfen herausziehen würde, könnte ich das ganze Königreich voll machen!" - "Ei!" sagte Hans, "willst du nicht mitfahren?" - "Ich möchte schon", antwortete der Mann, "aber ich habe kein Geld und ich brauche auch sehr viel zu essen." - "Das tut nichts!" sagte Hans. "Fahr nur mit!" So stieg auch der Zapfenmann ins Schiff und fuhr mit an den Königshof.
Als Hans vor dem Schloß ankam, übergab er das Schiff mit den vier Männern der Obhut der Wache und ging geradeswegs zum König. Er verbeugte sich höflich und sprach: "Herr König, drunten habe ich ein Schiff, das zu Wasser und zu Lande fahren kann!" Da fragte der König: "Hast du es auch selbst gemacht?" - "Ja!" sagte Hans. "So säge einmal ein Stück aus dem Schiff heraus und setze es dann wieder ein!" gebot der König. Da sagte Hans: "Ich habe ein ganzes und heiles Schiff gebaut; warum soll ich`s mutwillig zerstören und hernach wieder flicken? Das tu ich nicht!" Als der König den Hans auf diese Art nicht loswerden konnte, ließ er seinen Kanzler kommen und beriet mit ihm, was hier zu machen sei. Denn er meinte, diesem dummen Burschen könne er doch nicht seine Tochter zur Frau geben.
Der schlug ihm vor: "Stellt ihm eine unlösbare Aufgabe; sagt, daß Ihr ihm Tochter und Reich erst abtreten könnt, wenn er auch diesen Auftrag erfüllt habe." - "Und welches, meinst du, wäre diese unlösbare Aufgabe?" fragte der König. - "Schickt ihn nach dem Brunnen, der dreihundertfünfzig Stunden von hier liegt, er soll daraus binnen drei Stunden einen Krug Wasser holen. Ich denke, das wird der Hans wohl bleibenlassen!" Dieser Rat gefiel dem König. Er ließ Hans zu sich rufen und sagte: "Höre einmal, du mußt mir erst noch einen Krug Wasser aus dem Brunnen an der Grenze meines Reiches holen. Bist du in drei Stunden wieder hier, so sollst du meine Tochter bekommen und König werden." - "Soll geschehen!" sagte Hans und eilte zu seinem Schiff und seinen Leuten.
"Zieh schnell deine großen Stiefel an!" rief er dem Schnelläufer zu und fuhr ihn übers Wasser. Der Schnellläufer flog wie der Wind zum Brunnen, füllte daraus den Krug und wollte sich gleich wieder auf den Rückweg machen. Dann dachte er aber: "Du hast ja noch Zeit und kannst dich erst ein wenig ausruhen", legte sich unter einen Baum und schlief ein. Zwei Stunden waren schon vergangen, und Hans stand auf seinem Schiff und wartete und wartete; doch der Läufer kam nicht.
Da sagte Hans zu dem Langohr: "Horch doch einmal hin, wo der Läufer steckt!" Der Langohr legte sein Ohr an die Erde und lauschte eine Weile. "Der ist bei dem Brunnen eingeschlafen, ich höre ihn dort schnarchen!" sagte er. Da nahm der Scharfschütze seine Büchse, lud einen Kieselstein hinein und schoß ihn dem Schläfer so dicht am Kopf vorbei, daß es nur so pfiff. Davon erwachte der Schnelläufer, lief weiter und kam gerade noch zur rechten Zeit mit seinem Krug Wasser an.
Hans brachte ihn dem König und verlangte nun seine Tochter und das Königreich. Nun war der König wieder in Not, denn er hatte nicht gedacht, daß Hans das Wasser aus dem fernen Brunnen so schnell herbeischaffen könnte. Weil er aber gar keinen Ausweg mehr wußte, fragte er endlich den Hans: "Ist es dir nicht einerlei, wenn ich dir anstatt der Prinzessin und meinem Reich Gold gebe?" Hans sagte: "Mir kann es gleich sein. Aber ich will so viel Gold, als mein Schiff tragen kann." Der König sagte ihm dies zu, ließ aber sogleich wieder seinen Kanzler rufen und sprach: "Sobald der Hans weggefahren ist, soll ihm ein halbes Regiment roter Husaren nachreiten und ihm das Gold wieder abnehmen!"
Nun wurde von den Dienern des Königs eine Tonne Gold nach der andern auf das Schiff gebracht. Als es voll beladen war, trat Hans mit seinen Gehilfen die Rückreise an. Während sie zum Stadttor hinausfuhren, sagte Hans zum Langohr: "Horche einmal, was sie jetzt im Schloß sprechen!" Da horchte er auf und sagte: "Der König schickt soeben ein halbes Regiment rote Husaren aus, die sollen dir das Gold wieder abnehmen und dem König zurückbringen. " Es dauerte auch nicht lange, da kamen die Rotjacken dahergesprengt.
Als sie nahe genug waren, sagte Hans zum Zapfenmann: "Was meinst du, nun könntest du einmal den Husaren deine hintere Seite zeigen und den Zapfen herausziehen!" Der war mit Freuden bereit dazu. Er zog den Zapfen heraus - und da ging`s wie aus einer Feuerspritze auf die roten Husaren los, daß sie gar nicht wußten, was ihnen geschah. Als sie aber alle so übel zugerichtet waren, daß sie`s nicht mehr länger aushalten konnten, wandten sie ihre Pferde um und ritten so schnell sie konnten aufs Schloß zurück.
Als der König sie zurückkommen sah und hörte, daß sie dem Hans das Gold nicht abgenommen hatten, wurde er sehr zornig und sprach: "Das habe ich schon zum voraus gewußt, daß die gelben Husaren nichts ausrichten würden! Deshalb habe ich ausdrücklich die roten dazu bestimmt! Aber so geht`s, wenn meine Befehle nicht pünktlich ausgeführt werden!"
Unterdessen segelte Hans mit seinen Gefährten ungestört der Heimat zu und gab jedem seinen Teil von dem Golde, so daß sie alle mehr bekamen, als sie jemals in ihrem Leben verbrauchen konnten.
Franz Georg Brustgi - Schwäbisches Volksmärchen
STUMME LIEBE ...
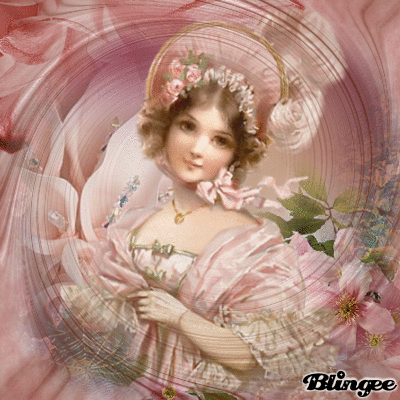
Es war einmal ein reicher Kaufmann, Melchior von Bremen genannt, der sich immer hohnlächelnd den Bart strich, wenn vom reichen Mann im Evangelium gepredigt wurde, den er, im Vergleich mit sich, nur für einen kleinen Krämer schätzte. Er hatte des Geldes so viel, dass er seinen Speisesaal mit harten Talern pflastern ließ.
In jenen frugalen Zeiten herrschte dennoch, so gut als in den unsrigen, ein gewisser Luxus, nur mit dem Unterschiede, dass er bei den Vätern mehr als bei den Enkeln aufs Solide gestellt war. Ob ihm diese Hoffart gleich, von seinen Mitbürgern und Konsorten, sehr verarget und für eine Prahlerei ausgedeutet wurde: so war´s damit doch mehr auf kaufmännische Spekulation, als Aufschneiderei angesehen.
Der schlaue Bremer merkte wohl, dass die Neider und Tadler dieser scheinbaren Eitelkeit nur den Ruf seines Reichtums ausbreiten und seinen Kredit dadurch mehren würden. Er erreichte diese Absicht vollkommen: das tote Kapital von alten Talern, das so weislich im Speisesaal zur Schau ausgestellt war, brachte hundertfältige Zinsen durch die stillschweigende Bürgschaft, die es in allen Handelsgeschäften für die Valuta leistete; aber endlich wurde es doch eine Klippe, woran die Wohlfahrt des Hauses scheiterte.
Melchior von Bremen starb auf einen jähen Trunk bei einem Quabbenschmause, ohne dass er Zeit hatte sein Haus zu bestellen, und hinterließ all sein Hab und Gut seinem einzigen Sohne im blühenden Jünglingsalter, der eben die Jahre erreicht hatte, die väterliche Erbschaft gesetzmäßig anzutreten.
Franz Melcherson war ein herrlicher Junge, und hatte von der Natur die besten Anlagen empfangen. Sein Körper war regelmäßig gebaut, dabei fest und konsistent; seine Gemütsart heiter und jovialisch, als wenn geräuchert Ochsenfleisch und alter Franzwein auf seine Existenz Einfluss gehabt hätten. Auf seinen Wangen blühte Gesundheit, und aus den braunen Augen sah Behaglichkeit und froher Jugendsinn hervor. Er glich einer markigen Pflanze, die nur Wasser und ein mageres Erdreich bedarf, um wohl zu gedeihen; in allzu fettem Boden aber geilen Überwuchs treibt, ohne Frucht und Genuss.
Der väterliche Nachlass war, wie es oft der Fall ist, des Sohnes Verderben. Kaum hatte er das Vergnügen empfunden, Besitzer eines großen Vermögens zu sein, und damit nach Belieben schalten zu können: so suchte er sich dessen, nicht anders als einer drückenden Bürde, zu entledigen, spielte den reichen Mann im Evangelium im Wortverstande, und lebte alle Tage herrlich und in Freuden.
Kein Gastmahl am Hofe des Bischofs kam den seinigen gleich an Pracht und Überfluss, und so lange die Stadt Bremen steht, wird solch ein Ochsenfest nicht wieder erlebt, als er jährlich zu begehen pflegte: an jeden Bürger in der Stadt spendete er einen Krüselbraten aus und ein Krüglein spanischen Wein. Davor ließ die ganze Stadt den Sohn des Alten hoch leben, und Franz war der Held des Tages.
Bei diesem fortwährenden Taumel von Schwelgerei wurde an keine Bilanzrechnung gedacht, die ehemals das Vademekum der Handelsleute war, jetzt aber immer mehr außer Brauch kommt, daher das Zünglein der merkantilischen Waage sich oft, mit magnetischer Kraft, zum Fallissement neiget. Einige Jahre verliefen, ohne dass der verschwenderische Gauch eine Abnahme seiner Renten spürte; denn bei des Vaters Hinscheiden waren Kisten und Kasten voll.
Die gefräßige Schar der Tischfreunde, das luftige Völklein der lustigen Brüder, die Spieler, Lungerer und alle, die von dem verlornen Sohn Nutz und Gewinn hatten, sahen sich wohl vor, ihn zu einiger Besonnenheit kommen zu lassen; sie rissen ihn von einem Vergnügen zum andern fort, und erhielten ihn immer im Atem, damit nicht ein nüchterner Augenblick die Vernunft aufwecken, und ihren räuberischen Klauen die Beute entführen möchte.
Aber plötzlich versiegte das Brünnlein des Wohllebens, die Tonnen Goldes, aus dem väterlichen Nachlass, waren abgezapft bis auf die Hefen. Franz kommandierte eines Tages eine große Zahlung, der Kassierer war außerstand, die Ordre seines Herrn zu honorieren und gab sie mit Protest zurück. Das fuhr dem jungen Schlemmer mächtig vor die Stirn; doch fühlte er nur Verdruss und Unwillen über seinen widerspenstigen Diener, dem er allein, keineswegs aber seiner eignen übeln Wirtschaft, die Unordnung in seinen Finanzen beimaß.
Er gab sich auch keine weitere Mühe, die Ursache davon zu ergründen, sondern, nachdem er zu der gewöhnlichen Litanei des Unsinns seine Zuflucht genommen und einige Dutzend Flüche abgedonnert hatte, ließ er an den achselzuckenden Haushalter den lakonischen Befehl ergehen: Schaff Rat.
Die Geldmäkler, die Wucherer und Wechsler wurden nun in Tätigkeit gesetzt. Gegen hohe Zinsen flossen, im Kurzen, wieder große Summen in die ledigen Kassen: der Saal mit harten Talern gepflastert galt damals, in den Augen der Gläubiger, mehr als in unsern Tagen ein offener Kreditbrief des amerikanischen Generalkongresses, oder aller dreizehn vereinigten Staaten. Das Palliativ leistete eine Zeitlang gute Dienste; doch unter der Hand breitete sich das Gerücht in der Stadt aus, das silberne Pflaster im Speisesaal sei in aller Stille aufgehoben und mit einem steinernen vertauscht worden.
Die Sache wurde von Stund an, auf Verlangen der Darleiher, gerichtlich untersucht und in der Tat also befunden. Nun war nicht zu leugnen, dass ein Pflaster von buntfarbigem Marmor, à la mosaique, sich in einem Speisesaal ungleich besser ausnahm, als die verblichenen alten Taler; allein die Gläubiger respektierten den feinen Geschmack des Eigentümers so wenig, dass sie ohne Verzug ihre Zahlung forderten, und da diese nicht erfolgte, wurde der Konkursprozeß eröffnet, das väterliche Haus nebst allen annexis, Vorratshäusern, Gärten, Feldgütern, auch allen Mobilien, bei brennender Kerze versteigert, und der Besitzer, der sich zur Notwehr mit einigen rechtlichen Schikanen noch verbollwerkt hatte, judizialiter exmittiert.
Jetzt war´s zu spät über seine Unbesonnenheit zu philosophieren, da die vernünftigsten Betrachtungen nichts bessern und die heilsamsten Entschließungen den Schaden nicht mehr heilen konnten. Nach der Denkungsart unsers verfeinerten Zeitalters hätte nun der Held mit Würde von der Bühne abtreten, seine Existenz auf irgend eine Art vernichten, die große Reise in die weite Welt antreten oder sich entgurgeln müssen, da er in seiner Vaterstadt nicht mehr, als ein Mann von Ehre, leben konnte.
Franz tat indessen weder das eine noch das andere. Das qu´en dira-t-on? welches die gallische Sittlichkeit, als Zaum und Gebiss für Torheit und Unbesonnenheit, erfunden hat, sie damit zu zähmen, war dem zügellosen Wicht bei seinem Wohlstande nicht eingefallen, und sein Gefühlssinn war noch nicht fein genug, die Schande seiner mutwilligen Verschwendung zu empfinden. Es war ihm wie einem berauschten Zecher zu Mute, der eben aus dem Weintaumel wieder erwacht, und sich nicht zu besinnen weiß, was mit ihm vorgegangen ist.
Er lebte nach der Weise verunglückter Verschwender, schämte sich nicht und grämte sich nicht. Zum Glück hatte er noch einige Reliquien aus dem Familienschmucke vom Schiffbruch geborgen, die ihn noch eine Zeitlang für drückenden Mangel schützten.
Er bezog ein Quartier in einem abgelegnen Gäßgen, in welches die Sonne das ganze Jahr nicht schien, außer in den längsten Tagen, wenn sie ein wenig über die hohen Dächer blickte. Hier fand er, für seine jetzt sehr eingeschränkten Bedürfnisse, alles was er brauchte: die frugale Küche des Wirts schützte ihn für Hunger, der Ofen für Kälte, das Dach für den Regen, die vier Wände für den Wind; nur für die peinliche Langeweile wusste er weder Rat noch Zuflucht.
Das lockere Gesindel der Schmarotzer war mit dem Wohlstande davon geflohen, und von seinen ehemaligen Freunden kannte ihn keiner mehr. Die Lektüre war damals noch kein Zeitbedürfnis, man verstund sich nicht auf die Kunst, mit den hirnlosen Spielen der Phantasie, die gewöhnlich in den seichtesten Köpfen der Nation spuken, die Zeit zu töten.
Es gab keine empfindsamen, pädagogischen, psychologischen, komischen, Volks- und Hexenromane; keine Robinsonaden, keine Familien- noch Klostergeschichten, keine Plimplamplaskos, keine Kakerlaks, und die ganze fade Rosenthalsche Sippschaft hatte ihren Höckenweibermund noch nicht aufgetan, die Geduld des ehrsamen Publikums mit ihren Armseligkeiten zu ermüden. Aber doch tummelten sich die Ritter schon wacker auf der Stechbahn herum, Dietrich von Bern, Hildebrand, der gehörnte Seyfried, der starke Rennewart gingen auf die Drachen- und Lindwurmsjagd, und erlegten Riesen und Zwerge von zwölf Mannsstärke.
Der ehrwürdige Theuerdank war das höchste Ideal von deutscher Art und Kunst, und damals das neueste Produkt des vaterländischen Witzes, doch nur für die schönen Geister, Dichter und Denker seines Jahrhunderts. Franz gehörte zu keiner von diesen Klassen, daher wusste er sich mit nichts zu beschäftigen, als dass er seine Laute stimmte und zuweilen drauf klimperte, hiernächst zur Abwechselung aus dem Fenster schaute und Wetterbeobachtungen anstellte, aus welchen sich gleichwohl so wenig ein Resultat ergab, als aus der verlornen Mühe unsrer windsüchtigen Meteorologen.
Sein Beobachtungsgeist bekam indessen bald eine andere Nahrung, wodurch der leere Raum in Kopf und Herzen auf einmal ausgefüllt wurde. In dem engen Gäßgen, seinem Fenster gerade gegenüber, wohnte eine ehrbare Matrone, die auf Hoffnung besserer Zeiten, sich kümmerlich vom langen Faden nährte, den sie nebst einer wunderschönen Tochter durch die Spindel gewann.
Sie zogen tagtäglich denselben so lang aus, dass sie die ganze Stadt Bremen, mit Wall und Graben und allen Vorstädten, leicht damit hätten umspannen mögen. Die beiden Spinnerinnen waren eigentlich nicht für die Spindel geboren, sie waren von gutem Herkommen, und lebten ehedem im behaglichen Wohlstande. Der schönen Meta Vater hatte ein eignes Schiff auf der See, das er selbst befrachtete und damit jährlich nach Antwerpen fuhr: aber ein schwerer Sturm begrub das Schiff, mit Mann und Maus und einer reichen Ladung, in den Abgrund des Meeres, als Meta noch nicht ihre Kinderjahre zurückgelegt hatte.
Die Mutter, eine verständige gesetzte Frau, ertrug den Verlust ihres Gatten und des sämtlichen Vermögens, mit weiser Standhaftigkeit, entschlug sich, aus edlem Stolze, bei ihrer Dürftigkeit, aller Unterstützungen des wohltätigen Mitleids ihrer Freunde und Anverwandtschaft, die sie für schimpfliche Almosen hielt, solange sie noch in ihrer eignen Tätigkeit Mittel zu finden glaubte, durch ihrer Hände Fleiß sich zu ernähren.
Sie überließ ihr großes Haus und all das köstliche Geräte darin den harten Gläubigern ihres verunglückten Mannes, bezog eine kleine Wohnung im engen Gäßgen, und spann vom frühen Morgen an bis in die späte Nacht, ob ihr dieser Broterwerb gleich schwer einging, und sie den Faden oft mit heißen Tränen netzte. Dennoch erreichte sie, durch diese Emsigkeit, den Endzweck von niemand abzuhängen und keinem Menschen einige Verbindlichkeit schuldig zu sein. In der Folge lehrte sie die heranwachsende Tochter zu gleicher Beschäftigung an, und lebte so genau, dass sie von ihrem Erwerb noch einen Sparpfennig zurücklegte, den sie anwendete, nebenher einen kleinen Flachshandel zu treiben.
Sie vermeinte jedoch keineswegs, in diesem dürftigen Zustande ihr Leben zu beschließen, vielmehr stärkte die wackere Frau ihren Mut mit günstigen Aussichten in die Zukunft, hoffte dereinst wieder in eine behagliche Lage zu kommen und in dem Herbste des Lebens auch noch ihren Weibersommer zu genüßen. Diese Hoffnung gründete sich nicht so ganz auf leere Träume der Phantasie, sondern auf eine planmäßige und vernünftige Erwartung.
Sie sah ihre Tochter wie eine Frühlingsrose aufblühen, dabei war sie tugendlich und sittsam, und mit so vielen Talenten des Geistes und Herzens begabt, dass die Mutter Freude und Trost an ihr empfand, und sich den Bissen aus dem Munde absparte, um nichts an einer anständigen Erziehung mangeln zu lassen.
Denn sie glaubte, wenn ein Mädchen der Skizze gleich käme, welche Salomon der weise Philogyn von dem Ideal einer vollkommnen Gattin entworfen hat: so könne es nicht fehlen, dass eine so köstliche Perle zum Hausschmuck eines rechtlichen Mannes werde aufgesucht und darum gehandelt werden: denn Schönheit und Tugend miteinander vereinbart, galten zu Mutter Brigittens Zeiten gerade soviel in den Augen der Freier, als in unsern Tagen Sippschaft und Vermögen. Zudem gab es auch mehr Ehekompetenten: man hatte damals den Glauben, die Frau sei der wesentlichste, nicht aber nach der verfeinerten ökonomischen Theorie, der entbehrlichste Hausrat in der Wirtschaft.
Die schöne Meta blühte zwar nur wie eine köstliche seltene Blume im Gewächshaus, nicht unter Gottes freiem Himmel; sie lebte unter mütterlicher Aufsicht und Gewahrsam höchst eingezogen und stille, ließ sich auf keiner Promenade und in keiner Gesellschaft blicken; kam im ganzen Jahre kaum einmal vors Tor ihrer Vaterstadt, und das schien den Grundsätzen einer gesunden Mutterpolitik gerade entgegen.
Die alte Frau E** in Memel verstund´s weiland anders, schickte die reisende Sophie, wie klar am Tage liegt, eigentlich nur auf Heiratsspekulation von Memel nach Sachsen, und erreichte ihre Absicht vollkommen: wie viel Herzen steckte die wandernde Nymphe in Brand, wie viel Kompetenten warben um sie! Wenn sie als ein häusliches sittsames Mädchen daheim geblieben war, würde sie in der Klausur ihrer jungfräulichen Zelle vielleicht abgeblüht haben, ohne sogar an dem Magister Kübbuz eine Eroberung zu machen.
Andere Zeiten, andere Sitten. Töchter sind bei uns ein Kapital, das in Umlauf muss gesetzt werden, wenn´s rentieren soll; ehemals wurden sie wie Spargeld unter Schloss und Riegel aufbewahrt; aber die Wechsler wussten doch, wo der Schatz verborgen lag und wie ihm beizukommen sei.
Mutter Brigitta steuerte sich auf einen wohlhabenden Eidam, der sie einst wieder aus dem babylonischen Gefängnis im engen Gäßgen, in das Land des Überflusses, wo Milch und Honig innen fleußt, zurückführen würde, und vertraute fest darauf, die Urne des Schicksals werde das Los ihrer Tochter mit keiner Niete zusammen paaren.
Eines Tages, als Nachbar Franz zum Fenster ausschaute, um Wetterbeobachtungen anzustellen, erblickte er die reizende Meta, welche mit der Mutter aus der Kirche zurückkam, wo sie täglich Messe zu hören nicht verfehlte.
In seinem Glücke hatte der unstete Wüstling für das schöne Geschlecht keine Augen gehabt, die feinern Gefühle schliefen noch in seiner Brust, und alle Sinnen waren, von dem unaufhörlichen Rausche des Wohllebens, gleichsam umnebelt. Jetzt hatten sich die stürmischen Wellen der Ausgelassenheit gelegt, und bei der großen Windstille wirkte das kleinste Lüftgen auf die Spiegelfläche seiner Seele.
Er wurde von dem Anblick der lieblichsten weiblichen Figur, die ihm jemals vorgeschwebt hatte, bezaubert, gab von Stund an das dürre meteorologische Studium auf, und stellte nun ganz andere Beobachtungen an zu Beförderung der Menschenkunde, die ihm weit unterhaltendere Beschäftigung gaben. Er zog bei seinem Wirt bald Kundschaft von der angenehmen Nachbarschaft ein, und erfuhr das größtenteils, was wir bereits schon wissen.
Jetzt fiel ihm der erste reuige Gedanke über seine unbesonnene Verschwendung auf, es regte sich ein geheimes Wohlwollen in seinem Herzen gegen die neue Bekanntschaft, und er wünschte nur um deswillen sein väterliches Erbgut wieder zurück, die liebenswürdige Meta damit auszusteuern. Das Quartier im engen Gäßgen war ihm jetzt so lieb, dass er´s nicht mit dem Schudding würde vertauscht haben.
Er kam den ganzen Tag nicht mehr vom Fenster hinweg, um die Gelegenheit zu erlauren, das liebe Mädchen zu beäugeln, und wenn sie sich sehen ließ, fühlte er mehr Entzücken in seiner Seele, als der Beobachter Horockes zu Liverpool empfand, da er zum ersten Mal die Venus durch die Sonne wandern sah.
Zum Unglück stellte die wachsame Mutter Gegenbeobachtungen an, und merkte bald, was der Lungerer gegenüber im Schilde führte, und weil er als ein Wüstling ohnehin bei ihr gar schlecht akkreditiert war, so entrüstete sie dieses tägliche Angaffen so sehr, dass sie ihr Fenster mit einer Schleierwolke verhüllte und die Vorhänge dichte zuzog. Meta erhielt strengen Befehl, sich nicht mehr am Fenster sehen zu lassen, und wenn die Mutter mit ihr in die Messe ging, hing sie ihr ein Regentuch übers Gesicht, vermummte sie wie eine Favoritin des Großherrn, und sputete sich, dass sie mit ihr um die Ecke des Gäßleins herum kam, um dem Auflaurer aus den Augen zu gehen.
Franz stund eben nicht im Rufe, dass der Scharfsinn sein vorzüglichstes Talent sei; aber die Liebe weckt alle Fähigkeiten der Seele auf. Er merkte, dass er durch sein unbescheidenes Spähen sich verraten hatte, und zog sich alsbald von seinem Fensterposten zurück, mit dem Entschluss, nicht wieder auszuschauen, wenn auch das Venerabile vorbei getragen würde. Dagegen sann er auf einen Fund, seine Beobachtungen dennoch unbemerkt fortzusetzen, und das gelang seiner Erfindsamkeit ohne große Mühe.
Er heuerte den größten Spiegel der aufzutreiben war, und hing diesen, in seiner Stube, unter einer solchen Richtung auf, dass er durch den selben alles, was in der Wohnung seiner Nachbarinnen vorging, deutlich bemerken konnte. Da man in vielen Tagen nichts mehr von dem Lauerer wahrnahm, öffneten sich allmählich die Gardinen wieder, und der große Spiegel empfing zuweilen die Gestalt des herrlichen Mädchens, und gab sie, zur großen Augenweide seines Inhabers, getreulich zurück.
Je tiefer die Liebe in seinem Herzen Wurzel schlug, desto mehr erweiterten sich seine Wünsche. Jetzt kam es darauf an, der schönen Meta seine Leidenschaft zu veroffenbaren, und ihre gegenseitige Gesinnung zu erforschen. Der gewöhnliche und gangbarste Weg, den Verliebte unter einer solchen Konstellation ihrer Neigungen und Wünsche einzuschlagen pflegen, war ihm in seiner gegenwärtigen Lage ganz unzugänglich.
In jenem sittsamen Zeitalter hielt es überhaupt schwer für verliebte Paladins, sich bei den Töchtern vom Hause zu introduzieren: Toiletten-Besuche waren noch nicht Sitte, trauliche Zusammenkünfte unter vier Augen, waren mit dem Verluste des guten Rufs von Seiten der weiblichen Teilhaberschaft verpönt, Promenaden, Esplanaden, Maskeraden, Pickeniks, Goutés, Soupés, und andere Erfindungen des neuern Witzes, die süße Minne zu begünstigen, gab es noch nicht; nur die verschwiegene Ehekammer gestattete die Konkurrenz beider Geschlechter, zur Erörterung ihrer Herzensangelegenheiten.
Dem ungeachtet gingen alle Dinge ihren Gang, so gut wie bei uns. Gevatterschaften, Hochzeitschmäuse, Leichenmahle, waren, vornehmlich in Reichsstädten, privilegierte Vehikel, Liebschaften anzuspinnen und Ehetraktaten zu betreiben, darum sagt das alte Sprichwort: Es wird keine Hochzeit vollbracht, es wird eine neue erdacht. Aber einen verarmten Schlemmer begehrte niemand in seine geistliche Verwandtschaft aufzunehmen, er wurde zu keinem Hochzeitmahl, zu keinem Leichenessen geladen. Der Schleifweg, durch die Zofe, durch die junge Magd oder einen anderen dienstbaren Geist von Unterhändlerin zu negoziieren, war hier versperrt: Mutter Brigitta hatte weder Magd noch Zofe, der Flachs- und Garnhandel ging allein durch ihre Hand, und sie verließ die Tochter so wenig als ihr Schatten.
Unter diesen Umständen war´s unmöglich, dass Nachbar Franz der geliebten Meta sein Herz entweder mündlich oder schriftlich entdecken konnte. Er erfand aber bald ein Sprachidiom, das für die Darstellung der Leidenschaften ausdrücklich gemacht scheint. Zwar gebührt ihm nicht die Ehre der ersten Erfindung: lange vor ihm hatten die empfindsamen Seladons in Welschland und Spanien, schmelzende Harmonien bei ihren Serenaden, die Sprache des Herzens, unter dem Balkon ihrer Donna, reden lassen, und dieses melodische Pathos soll in liebes Deklarationen des Zwecks nicht leicht verfehlen, und nach dem Geständnis der Damen Herz anfassender und hinreißender sein, als weiland die Wohlredenheit des ehrwürdigen Vaters Chrysostomus, oder die Beredsamkeit des schulgerechten Cicero und Demosthenes.
Aber davon hatte der schlichte Bremer nie ein Wort gehört, folglich war die Erfindung, seine Herzgefühle in musikalische Akkorde überzutragen, und sie der geliebten Meta vor zu lautenieren, ganz die seinige.
In einer empfindsamen Stunde ergriff er sein Instrument, ließ es jedoch nicht wie sonst bei dem bloßen Stimmen bewenden, sondern lockte rührende Melodien aus den harmonischen Saiten hervor, und in minder als einem Monat, schuf die Liebe den musikalischen Stümper zum neuen Amphion um. Die ersten Versuche schienen eben nicht bemerkt zu werden; aber bald wurde im engen Gäßgen alles Ohr, wenn der Virtuos einen Akkord anschlug, die Mütter schwiegen die Kinder, die Väter wehrten den lärmenden Knaben vor den Türen, und er hatte das Vergnügen, durch den Spiegel zu bemerken, dass Meta mit ihrer alabasternen Hand zuweilen das Fenster öffnete, wenn er anfing zu präludieren.
War´s ihm gelungen sie herbeizuziehen, dass sie ihm das Ohr lieh, so rauschten seine Phantasien im frohen Allegro, oder hüpften in scherzenden Tanzmelodien daher; hielt sie aber der Umtrieb der Spindel oder die geschäftige Mutter ab, sich sehen zu lassen, so wälzte ein schwerfälliges Andante sich über den Steg der seufzenden Laute, welches in schmachtenden Modulationen ganz das Gefühl des Kummers ausdrückte, den Liebesqual in seine Seele goss.
Meta war keine ungelehrige Schülerin, und lernte bald diese ausdrucksvolle Sprache verstehen. Sie machte verschiedene Versuche, zu prüfen, ob sie sich alles recht verdolmetscht hätte, und fand, dass sie nach ihrer Willkür die Virtuosenlaune des unsichtbaren Lautenschlägers regieren konnte: denn die stillen sittsamen Mädchen haben, wie bekannt, einen ungleich schärferen Gefühlblick, als die raschen flatterhaften Dirnen, die mit schmetterlingsartigem Leichtsinn von einem Gegenstande zum anderen forteilen, und an keinen ihre Aufmerksamkeit heften.
Sie fand ihre weibliche Eitelkeit dadurch geschmeichelt, und es behagte ihr, durch eine geheime Zaubermacht, die nachbarliche Laute bald in den Ton der Freude, bald in den wimmernden Klageton stimmen zu können. Mutter Brigitta aber hatte mit dem Erwerb im Kleinen immer den Kopf so voll, dass sie nicht darauf achtete, und die schlaue Tochter hütete sich wohl, ihr die gemachte Entdeckung mitzuteilen, und dachte vielmehr darauf, eine Gelegenheit auszuspähen, diese harmonischen Apostrophen an ihr Herz, aus einem gewissen Wohlwollen gegen den girrenden Nachbar, oder aus Eitelkeit, um ihren hermeneutischen Scharfsinn zu veroffenbaren, durch eine symbolische Gegenrede zu erwidern.
Sie äußerte ein Verlangen, Blumentöpfe vor dem Fenster zu haben, und dieses unschuldige Vergnügen ihr zu gestatten, fand bei der Mutter keine Schwierigkeit, die nichts mehr von dem lauersamen Nachbar fürchtete, nachdem sie ihn nicht mehr vor Augen sah.
Nun hatte Meta einen Beruf ihre Blumen zu warten, zu begießen, für die Sturmwinde sie zu sichern und anzubinden, auch ihr Wachstum und Gedeihen zu beobachten. Mit unaussprechlichem Entzücken erklärte der glückliche Liebhaber diese Hieroglyphen ganz zu seinem Vorteil, und die beredte Laute ermangelte nicht, seine frohen Empfindungen in das horchsame Ohr der schönen Blumenfreundin, über das enge Gäßgen hinüber zu modulieren.
Das tat in dem zarten jungfräulichen Herzen Wunder. Es fing an sie heimlich zu kränken, wenn Mutter Brigitta, bei ihren weisen Tischreden, wo sie mit der Tochter zuweilen ein Stündchen zu kosen pflegte, den musikalischen Nachbar in die Zensur nahm, ihn einen Taugenichts und Lungerer schalt; oder mit dem verlorenen Sohne verglich. Sie nahm immer seine Partei, wälzte die Schuld seines Verderbens auf die leidige Verführung, und legte ihm nichts zur Last, als dass er das goldne Sprüchlein nicht erwogen hätte: Junges Blut spar dein Gut! Indessen verteidigte sie ihn mit schlauer Vorsicht, dass es schien, es sei damit mehr auf die Unterhaltung des Gesprächs abgesehen, als das sie an der Sache selbst Anteil nahm.
Während dass Mutter Brigitta innerhalb ihrer vier Wände gegen den jungen Wildfang eiferte, hegte dieser für sie gleichwohl die besten Gesinnungen und machte die ernsthafteste Spekulation, wie er nach Vermögen ihre dürftigen Umstände verbessern, und die wenige Habe, die ihm noch übrig war, mit ihr teilen möchte, so dass es ihr doch gänzlich verborgen blieb, dass ein Teil seines Eigentums in das ihrige übergegangen sei.
Eigentlich war´s mit dieser milden Spende freilich nicht auf die Mutter, sondern auf die Tochter abgesehen. Unter der Hand hatte er vernommen, dass der schönen Meta nach einem neuen Leibrock gelüste, welchen zu kaufen die Mutter ihr abschlug, unter dem Vorwand schwerer Zeiten. Er urteilte aber ganz recht, dass ein Geschenk oder ein Stück Zeug, von unbekannter Hand, wohl schwerlich dürfte angenommen werden, oder die Tochter sich darein kleiden möchte, und dass er alles verderben würde, wofern er sich als der Geber zu der Spende legitimieren wollte. Unversehens führte der Zufall eine Gelegenheit herbei, diesen guten Willen auf die schicklichste Art zu realisieren.
Mutter Brigitta beklagte sich gegen eine Nachbarin, der Flachs sei nicht geraten, und koste mehr im Einkauf, als die Abnehmer dafür bezahlen wollten, daher sei dieser Nahrungszweig vor der Hand nichts anderes als ein dürrer Ast. Horcher Franz ließ sich das nicht zweimal sagen, er lief alsbald zum Goldschmied, und vermäkelte die Ohrenspangen seiner Mutter, kaufte einige Steine Flachs ein, und ließ sie durch eine Unterhändlerin, die er gewann, seiner Nachbarin für einen geringen Preis anbieten.
Der Handel wurde geschlossen, und wucherte so reichlich, dass die schöne Meta, auf Allerheiligentag, in einem neuen Leibrock prangte. Sie leuchtete in diesem Prunk dem spähenden Nachbar dergestalt in die Augen, dass er die heiligen elftausend Jungfrauen samt und sonders würde vorbeigegangen sein, wenn ihm vergönnt gewesen war, sich ein Herzgespiel darunter zu suchen, um die reizende Meta zu wählen.
Doch eben da er sich über den guten Erfolg seiner unschuldigen List in der Seele freute, wurde das Geheimnis verraten. Mutter Brigitta wollte der Flachströdlerin, die ihr so reichlichen Erwerb eingebracht hatte, zur Vergeltung auch eine Güte tun, und bewirtete sie mit einem wohl gezuckerten Reisbrei und einem Quartiergen spanischen Sekt. Diese Näscherei setzte nicht nur den zahnlosen Mund, sondern auch die geschwätzige Zunge der Alten in Bewegung, sie verhieß den Flachshandel fortzusetzen, wenn ihr Kommittent sich ferner geneigt dazu finden ließ, wie sie aus guten Gründen vermute.
Ein Wort gabs andere. Mutter Evens Töchter forschten, mit der ihrem Geschlechte gewöhnlichen Neugier so lange nach, bis sie das morsche Siegel der weiblichen Verschwiegenheit auflösten. Meta erbleichte vor Schrecken über diese Entdeckung, die sie würde entzückt haben, wenn nicht die Mutter Teilhaberin derselben gewesen wäre. Aber sie kannte ihre strengen Begriffe von Sittlichkeit und Anstand, und die machten ihr für den Verlust des neuen Leibrocks bange.
Die ernste Frau geriet nicht minder in Bestürzung über diese Novelle, und wünschte ihrerseits gleichfalls, dass sie allein Notiz von der eigentlichen Beschaffenheit ihres Flachshandels möchte erhalten haben, denn sie fürchtete, die nachbarliche Großmut möchte auf das Herz der Tochter einen Eindruck machen, der ihren ganzen Plan verrückte. Daher beschloss sie, den noch zarten Keim des Unkrautes, auf frischer Tat, aus dem jungfräulichen Herzen zu vertilgen.
Der Leibrock wurde, aller Bitten und Tränen der lieblichen Besitzerin ungeachtet, vorerst in Beschlag genommen, und des folgenden Tages auf den Trödelmarkt geschickt, das daraus gelöste Geld, mit dem übrigen aufs gewissenhafteste berechneten Gewinn von dem Flachsnegoz, zusammengepackt und als eine alte Schuld unter der Aufschrift: an Herrn Franz Melcherson, sesshaft in Bremen, durch Beihülfe des Hamburger Boten zurückspediert.
Der Empfänger nahm aus gutem Glauben das Päckchen Geld als einen unvermuteten Segen an, wünschte, dass alle Schuldner seines Vaters in Abzahlung der alten Reste so gewissenhaft sein möchten, als dieser biedere Unbekannte, und ahnte nichts von dem wahren Zusammenhange der Sache; die schwatzhafte Mäklerin hütete sich auch wohl, von ihrer Plauderei ihm Confidence zu machen, sie begnügte sich nur ihm zu sagen, Mutter Brigitta habe den Flachshandel aufgegeben.
Unterdessen belehrte ihn der Spiegel, dass gegenüber die Aspekten in einer Nacht sich gar sehr verändert hatten. Die Blumentöpfe waren insgesamt verschwunden, und die Schleierwolken bedeckten wieder den freundlichen Horizont der gegenseitigen Fenster. Meta war selten sichtbar, und wenn sie ja einmal auf einen Augenblick zum Vorschein kam, wie der Silbermond in einer stürmischen Nacht aus dem Gewölke, so erschien sie mit gar trübseligem Gesicht, das Feuer ihrer Augen war verloschen, und ihm bedünkte, sie zerdrücke zuweilen ein perlendes Tränlein mit dem Finger.
Das griff ihm gewaltsam ans Herz, und die Laute hallte schwermutsvolle Mitempfindung in weichen lydischen Tönen. Er quälte sich und sann, die Ursache des Trübsinns seiner Liebschaft zu erforschen, ohne mit seinem Dichten und Denken etwas zu enden. Nach Verlauf einiger Tage bemerkte er mit großer Bestürzung, dass sein liebster Hausrat, der große Spiegel, ihm völlig unbrauchbar sei. Er lagerte sich an einem heitern Morgen in den gewöhnlichen Hinterhalt, und wurde gewahr, dass die Wolken gegenüber alle wie nächtliche Nebel verschwunden waren, welches er anfangs einer großen Wäsche zuschrieb; aber bald sah er, dass inwendig im Zimmer alles öd und ledig war: die angenehme Nachbarschaft war abends zuvor in aller Stille dekampiert, und hatte das Quartier verändert.
Nun konnte er mit aller Muße und Bequemlichkeit wieder der freien Aussicht genießen, ohne zu befürchten, irgend jemand durch sein Ausschauen lästig zu fallen; allein für ihn war´s ein peinlicher Verlust, des wonnigen Anblicks seiner platonischen Liebschaft entbehren zu müssen. Stumm und fühllos stund er da, wie ehemals sein Kunstgenoß der harmonische Orpheus, als der geliebte Schatten seiner Eurydice wieder zum Orkus hinabschwand, und wenn zu seiner Zeit das Tollhäuslergefühl unserer Kraftmänner, die im abgewichenen Jahrzehend tosten, nun aber, wie die Hummeln beim ersten Froste, verschwunden sind, zur Existenz wär gediehen gewesen: so würde diese Windstille in einen plötzlichen Orkan übergegangen sein.
Das wenigste was er hätte tun können, wäre gewesen, sich die Haare auszuraufen, auf der Erde sich herumzuwälzen, oder den Kopf gegen die Wand zu rennen, den Ofen und die Fenster einzuschlagen, und seiner als ein Unsinniger zu beginnen. Alles das unterblieb, aus dem ganz einleuchtenden Grunde, weil wahre Liebe nie Toren macht, sondern das Universale ist, kranke Gemüter von Torheit zu heilen, der Ausschweifung sanfte Fesseln anzulegen, und jugendliche Unbesonnenheit, von dem Wege des Verderbens, auf die Bahn der Vernunft zu leiten: denn der Wüstling, welchen die Liebe nicht wieder zurechte bringt, ist unwiederbringlich verloren.
Sobald sich sein Geist wieder gesammelt hatte, stellte er über das unerwartete Phänomenon am nachbarlichen Horizont mancherlei lehrreiche Betrachtungen an. Er vermutete allerdings, dass er der Hebel gewesen sein möchte, der die Bewegung im engen Gäßgen veranlasst und die Auswanderung der weiblichen Kolonie bewirkt habe; der Geldempfang, der eingestellte Flachshandel, und die darauf erfolgte Emigration dienten einander zu wechselseitigen Exponenten, ihm alles aufzuklären.
Er merkte, dass Mutter Brigitta hinter seine Geheimnisse gekommen sei, und sah aus allen Umständen, dass er nicht ihr Held war, und diese Entdeckung munterte eben seine Hoffnung nicht sehr auf. Die symbolische Rücksprache der schönen Meta hingegen, welche sie, mittelst der Blumentöpfe, auf seine harmonischen Liebesanträge mit ihm genommen hatte, ihr Trübsinn, und die Zähre, die er kurz vor der Auswanderung aus dem engen Gäßgen in ihren schönen Augen bemerkt hatte, belebten seine Hoffnung wieder und erhielten ihn bei gutem Mute.
Sein erstes Geschäft war, auf Kundschaft auszugehen und in Erfahrung zu bringen, wo Mutter Brigitta ihre Residenz hin verlegt habe, um das geheime Einverständnis mit der zärtlichen Tochter auf irgend eine Weise zu unterhalten. Es kostete ihn wenig Mühe, ihren Aufenthalt zu erfahren, gleichwohl war er zu bescheiden, ihr mit wesentlicher Wohnung zu folgen, und begnügte sich nur die Kirche auszuspähen, wo sie nun Messe hörten, um sich das Vergnügen des Anblicks seiner Geliebten täglich einmal zu verschaffen.
Er verfehlte nie, ihr auf dem Heimwege zu begegnen, bald da bald dort in einem Laden, oder in einer Haustür, wo sie vorübergehen musste, ihr aufzupassen und sie freundlich zu grüßen, welches so viel galt als ein Billet doux und auch die nämliche Wirkung tat.
Wär Meta nicht allzu klostermäßig erzogen, und von der strengen Mutter wie ein Schatz von den Augen eines Geizigen bewacht worden, so hätte Nachbar Franz, mit seiner verborgenen Werbung auf ihr Herz, ohne Zweifel wenig Eindruck gemacht. Aber sie war in dem kritischen Alter, wo Mutter Natur und Mutter Brigitta, mit ihrer guten Lehr und Unterricht, immer in Kollision kamen.
Jene lehrte sie durch geheimen Instinkt Empfindungen kennen, und pries ihr solche als die Panazee des Lebens an, für die sie keinen Namen hatte; diese warnte sie für den Überraschungen einer Leidenschaft, die sie nicht mit dem wahren Namen benennen wollte, die aber, ihrer Sage nach, für junge Mädchen schädlicher und verderblicher sein sollte als Blattergift. Jene belebte im blühenden Lenz des Lebens, nach Beschaffenheit der Jahreszeit, ihr Herz mit wohltätiger Wärme; diese wollte, dass es immer so frostig und kalt als ein Eiskeller bleiben sollte.
Dieses ganz entgegengesetzte pädagogische System zweier guten Mütter, gab dem lenksamen Herzen der Tochter die Richtung eines Schiffs, das gegen den Wind gesteuert wird, und weder dem Winde noch dem Ruder folgt, sondern ganz natürlich eine dritte Direktion nimmt. Sie behielt die Sittsamkeit und Tugend bei, die ihr durch die Erziehung von Jugend an war eingeprägt worden, und ihr Herz war aller zärtlichen Empfindungen empfänglich.
Weil nun Nachbar Franz der erste Jüngling war, der diese schlafenden Gefühle aufgeweckt hatte: so empfand sie ein gewisses Behagen an ihm, das sie sich kaum selbst gestand, das aber jedes minder unerfahrene Mädchen würde für Liebe erklärt haben. Darum ging ihr der Abschied aus dem engen Gäßgen so nahe, darum zitterte ein Tränlein von ihren schönen Augen, darum dankte sie dem lauersamen Franz so freundlich, wenn er sie auf dem Kirchwege grüßte, und wurde rot dabei bis an die Ohren.
Beide Liebenden hatten zwar nie ein Wort miteinander gesprochen; aber er verstand sie, sie verstand ihn so vollkommen, dass sie unter vier Augen sich gegeneinander nicht deutlicher würden haben erklären können, und beide Kontrahenten schwuren, jeder Teil für sich im Herzen, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dem anderen den Bund der Treue.
Johann Karl August Musäus
EIN GUTES REZEPT ...
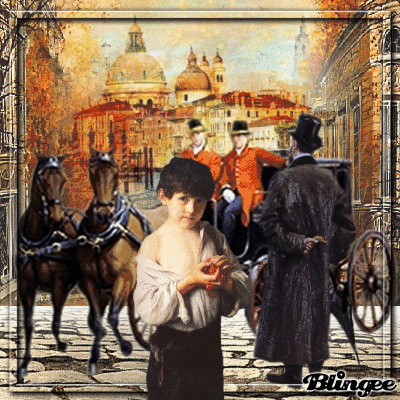
In Wien der Kaiser Joseph war ein weiser und wohltätiger Monarch, wie jedermann weiß; aber nicht alle Leute wissen, wie er einmal der Doktor gewesen ist und eine arme Frau kuriert hat.
Eine arme kranke Frau sagte zu ihrem Büblein. "Kind, hol' mir einen Doktor, sonst kann ich's nimmer aushalten vor Schmerzen." Das Büblein lief zum ersten Doktor und zum zweiten, aber keiner wollte kommen, denn in Wien kostet ein Gang zu einem Patienten einen Gulden, und der arme Knabe hatte nichts als Tränen, die wohl im Himmel für gute Münze gelten, aber nicht bei allen Leuten auf der Erde.
Als er aber zum dritten Doktor auf dem Weg war oder heim, fuhr langsam der Kaiser, in einer offenen Kutsche an ihm vorbei; der Knabe hielt ihn wohl für einen reichen Herrn, ob er gleich nicht wusste, dass es der Kaiser ist, und dachte: ich will's probieren. "Gnädiger Herr", sagte er, "wollet Ihr mir nicht einen Gulden schenken, seid so barmherzig!"
Der Kaiser dachte: der fasst es kurz und denkt, wenn ich den Gulden auf einmal bekomme, so brauch' ich nicht sechzigmal um den Kreuzer zu betteln. "Tut es ein Käsperlein oder zwei Vierundzwanziger nicht auch?" fragt ihn der Kaiser. Das Büblein sagte: "Nein", und offenbarte ihm, wozu das Geld benötigt sei.
Also gab ihm der Kaiser den Gulden und ließ sich genau von ihm beschreiben, wie seine Mutter heißt, und wo sie wohnt, und während das Büblein zum dritten Doktor springt, und die kranke Frau betet daheim, der liebe Gott wollte sie doch nicht verlassen, fährt der Kaiser zu ihrer Wohnung und verhüllt sich ein wenig in seinen Mantel, also dass man ihn nicht recht erkennen konnte, wer ihn nicht express darum ansah.
Als er aber zu der kranken Frau in ihr Stüblein kam, und sah recht leer und betrübt darin aus, meinte sie, es ist der Doktor, und erzählte ihm ihren Umstand, und wie sie noch so arm dabei sei und sich nicht pflegen könne. Der Kaiser sagte: "ich will Euch dann jetzt ein Rezept verschreiben", und sie sagte ihm, wo des Bübleins Schreibzeug ist.
Also schrieb er das Rezept und belehrte die Frau, in welche Apotheke sie es schicken müsse, wenn das Kind heim kommt, und legte es auf den Tisch. Als er aber kaum eine Minute fort war, kam der rechte Doktor auch. Die Frau, verwunderte sich nicht wenig, als sie hörte, er sei auch der Doktor, und entschuldigte sich, es sei schon so einer da gewesen, und hab ihr etwas verordnet, und sie habe nur auf ihr Büblein gewartet.
Als aber der Doktor das Rezept in die Hand nahm und sehen wollte, wer bei ihr gewesen sei und was für einen Trank oder Pillelein er ihr verordnet hat, erstaunte er auch nicht wenig und sagte, zu ihr: "Frau", sagte er, "Ihr seid einem guten Arzt in die Hände gefallen, denn er hat Euch fünfundzwanzig Dublonen verordnet, beim Zahlamt zu erheben, und unten dran steht. Joseph, wenn Ihr ihn kennt. Ein solches Magenpflaster und Herzsalbe und Augentrost hätte ich Euch nicht verschreiben können."
Da tat die Frau einen Blick gegen den Himmel und konnte nichts sagen vor Dankbarkeit und Rührung, und das Geld wurde hernach richtig und ohne Anstand von dem Zahlamt ausbezahlt, und der Doktor verordnete ihr eine Mixtur, und durch die gute Arznei und durch die gute Pflege, die sie sich jetzt verschaffen konnte, stand sie in wenig Tagen wieder auf gesunden Beinen. Also hat der Doktor die kranke Frau kuriert, und der Kaiser die arme, und sie lebt noch und hat sich später wieder verheiratet.
Johann Peter Hebel
DAS MÄRCHEN VON DEN KÜCHELN ...
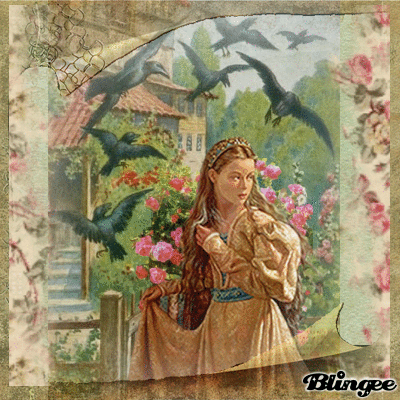
Als die Küchle gebacken waren, gab die Mutter jedem Kinde eins zum Imbiss; die übrigen aber trug sie in die Speis für das Mittagessen, und sagte dann, und drohte: Rührt mir nichts an in der Kuchel und im Keller, das sag' ich euch; sonst ergeht es euch, wie jenen bösen Buben, von denen die Geschichte erzählt.
Eine Bäuerin hatte sechs Kinder, lauter Buben, von sechs bis zwölf Jahren. Da hatte sie denn mit ihrem Manne vollauf zu tun, um sie alle zu ernähren. Am Notdürftigen fehlte es auch den Kindern eben nicht; aber Küchle kriegten sie nie, gleich wie die Kinder in anderen Bauernhäusern.
Da sagten sie oft: »Aber, Mutter! wann backet Ihr uns denn einmal Küchle? Wir möchten auch einmal Küchle haben.« Die Mutter sagte dann jedesmal: »Merkt! Schwarzes Brot macht die Backen rot. Habt ihr sonst keine Schmerzen?« Warum sie aber keine Küchle backen, und weder sie selbst noch ihr Mann eins schmecken und essen mochte, das muss wohl, denk' ich, seine geheime Ursache gehabt haben. –
Das ging nun so fort bis ins siebente Jahr. Da gebar sie ein Töchterle, das sie Lisele nannte; und ihre Freude darob war so groß, dass sie den Buben versprach, sie wolle ihnen endlich auch Küchle backen. Als die Buben das hörten, hatten sie große Freude, und sie konnten kaum den Tag erwarten, wo sie endlich auch einmal Küchle kriegen sollten.
Die Mutter richtete den Teig zu; sie machte Feuer an; sie setzte die Pfanne voll Schmalz darüber; jetzt pregelte schon das erste Küchle und bräunte sich; jetzt ward es herausgelangt mit dem Spieß, und in die Schüssel gelegt; und da lag es nun so schön braun und von Fett triefend, und es schmeckte (roch) so gut, dass den Buben der Mund darnach wässerte, und der Gelust ihnen aus den Augen lugte.
Darauf als die sechs Küchle gebacken waren, nahm die Mutter die Schüssel, und trug sie in die Speis, indem sie sagte: »Die Küchle müssen erst ein wenig auskühlen; dann schmecken sie besser.« Kaum aber hatte die Mutter die Kuchel verlassen, so schlichen die bösen Buben in die Speis, und jeder nahm sein Küchle, und lief davon; und vor dem Fenster, daraus die Mutter guckte, blieben sie stehen, und bissen in die Küchel, und lachten sie aus.
Das verdross die Mutter, und sie rief voll Ingrimm: »O ihr vermaledeiten Rabenkinder!« Als sie das kaum ausgesprochen, sieh, da verwandelten sich plötzlich die Buben in lauter Raben, und sie flogen auf und davon, schreiend und krächzend. – Es gereute zwar die Mutter alsbald ihr Fluch, und sie weinte und jammerte; aber es war zu spät. Da sah sie das Lisele liegen in der Wiege, und sie sagte: »Sei du mein Trost und meine Freude und meine einzige Hoffnung!« – So vergingen ein paar Jahre und drüber.
Da wie eines Tages Lisele im Garten saß im Grase und ihre Milchbrocken aß, kamen sechs Raben herbei geflogen, und setzten sich im Kreis um das Kindlein, als bäten sie dasselbe um ein Bröckle. Und Lisele, wie es denn ein gar gutes Herz hatte, warf jetzt dem einen, dann den anderen Vögeln einen Brocken hin, und lugte ihnen zu, wie sie fraßen, und hatte ihre Freude daran.
Ihr habts erraten, wenn ihr glaubt, dass diese sechs Raben niemand anders gewesen, als die verwünschten Brüder. Ach! sie hatten ihren bösen Lust teuer büßen müssen. Sommer und Winter, bei Hitz' und bei Kälte, mussten sie sich auf freiem Felde aufhalten, und sich kümmerlich nähren von dem Aas und dem Dung und all dem Unrat. Oft flatterten sie um das Haus, darin sie geboren worden – denn sie hatten die Besinnung behalten, gleich Menschen – aber aus Furcht vor der Mutter, die ihnen geflucht, flogen sie bei jedem Geräusch gleich wieder hinweg, schreiend und krächzend.
An jenem Tage aber, als sie ihr Schwesterle erblickten, da fassten sie Zutrauen, und flogen näher, um Speise bittend; und von der Zeit an kamen sie alle Tage, das Lisele aufzusuchen, die auch jederzeit schon auf sie wartete, und gern mit ihnen teilte. »Allmählich wurden sie so heimlich, dass sie ihr aus der Hand fraßen. Und wenn sie noch nicht da waren, so rief nur Lisele:
Raben schwarz, mit dem Schnabel rot,
Kommt doch her zum Vesperbrod!
und alsogleich kamen sie herbei geflogen, als wenn es so sein müsste, im Sommer in den Garten, im Winter vor's Fenster. – Das hat viele Jahre so gedauert. Eines Tags sind sie aber alle ausgeblieben, und nicht wieder gekommen.«
»Wo sind sie denn aber hingekommen?« fragten die Kinder. »Müsst ihr denn sogleich alles wissen?« sagte die Mutter.
Hier hielt die Großmutter inne, und sie sagte, dass nun der Großvater seine Geschichte beginnen sollte. Dieser erzählte folgende Geschichte »Der Reiter und sein Ross«
Ludwig Aurbacher: Büchlein für die Jugend
DER REITER UND SEIN ROSS ...

Wer im Kleinen nicht Sorge trägt, muss im Großen Schaden leiden ...
Das erfuhr einst ein Kaufherr, der, um eines schlechten Nagels halber, ein schönes Ross verlor. Dieser ritt von dem Markte nach seiner Heimat zurück, wohl bepackt mit Geld und Geldsorgen. In einem Städtchen hielt er Mittag; und der Knecht, als er ihm sein Pferd vorführte, sagte: »Herr, es fehlt dem Ross ein Nagel am Hufeisen, am linken Hinterfuß.« Ei was! sagte der Kaufherr; »Nagel hin, Nagel her! Die sechs Stunden, die ich noch zu machen habe, wird das Eisen wohl noch halten. Ich hab' Eile.« Und damit ritt er fort.
Nach etlichen Stunden, als er wieder einkehrte und dem Rosse Brot geben ließ, kam der Knecht in die Stube, und sagte: »Herr, es fehlte eurem Pferde ein Hufeisen am linken Hinterfuß. Soll ich's wohl zum Schmied führen?« »Hm! sagte der Kaufherr, Hufeisen hin, Hufeisen her! Die Paar Stunden, die ich noch zu machen habe, wird das Pferd wohl aushalten. Ich hab' Eile.« Und er ritt wieder fort.
Er ritt aber nicht lange, so fing das Pferd zu hinken an; und das Pferd hinkte nicht lange, so fing es zu stolpern an, und es stolperte nicht lange, so fiel es endlich, und brach sich ein Bein, und stand nicht mehr auf. Da sagte der Kaufherr freilich nicht mehr: Pferd hin, Pferd her; sondern er kratzte sich hinter den Ohren, schnallte ganz stät die Geldkatze und den Mantel ab, und setzte seinen Weg fort, zu Fuß, wohlbeladen mit Geld und Geldsorgen; und er hatte nun keine Eile mehr. Unterwegs aber dachte er wohl: »An dem ganzen Unglück ist doch nur der vermaledeite Nagel Schuld.«
Aber ... Vorgetan und nachbedacht
Hat manchen schon in Schaden gebracht.
Die Großmutter fuhr hierauf fort in ihrem Märchen:
Als die Küchle gebacken waren, sagte die Mutter: »Da, nehmt's mit Dank, und esset ordele; und lasset kein Brösele fallen, oder ihr hebt's vom Boden wieder auf; – es ist Gottes Gabe! – Und dass keins dem anderen neidisch sei! Sonst gibt's Riss! – Kinderle, gönnt fein alles einander von Herzen, wie ich's euch gönne, und Gott gesegn' es euch!« Drauf sagte sie: Ich könnt' euch eine traurige Geschichte erzählen, wie's Menschen ergeht, welche Gottes Gabe verachten oder sie anderen missgönnen.
Es lebten zu einer Zeit zwei Grafen, von großem Reichtum und Ansehen; und ihre prächtigen Schlösser lagen nahe an einander auf hohen Bergen, und ein enges Tal war dazwischen. Der eine hatte ein Söhnle, der andere ein Töchterle; und die Eltern wachten schon früh daran, wie sie beide einstens mit einander vermählen, und so ihre Güter zusammen bringen wollten. Und das wäre gut gewesen.
Aber die beiden Grafen waren gar stolze und hochmütige Herren, und sahen auf die anderen Leute mit Verachtung herab, als wären sie nicht auch Menschen, wie alle. Und diesen bösen Sinn übertrugen sie auch auf ihre Kinder; und der Junker tat über die Maßen wirrisch und vornehm gegen alle, die nicht seines gleichen waren, und das Fräule war zänkisch und neidisch, und gönnte Niemanden nichts.
Nun wohnte im Thale, das zwischen den beiden Schlössen lag, in einer ärmlichen Hütte ein altes Mütterle, die sich kümmerlich nährte. An der Kirchweih aber mochte sie wohl denken: »Heute will ich mir auch einmal einen guten Tag antun; und ich will, wie andere Leute, Küchle backen; und wenn sie gut geraten, so will ich auch den beiden jungen Herrschaften einige schicken.«
Und es geschah; und sie schickte ein Paar der schönsten Küchle auf das eine Schloss, für den gnädigen Junker, und ein Paar andere, die eben so schön waren, auf das andere Schloss für das gnädige Fräule. Als der Junker durch den Boten die Ausrichtung gehört, da wurde er aus eitlem Stolz ganz unwillig, und er nahm das Teller, und warf die Küchle zu Boden, und trat sie mit Füßen, wobei er sagte: »Das sei eine Kost für gemeine Leute, aber nicht für vornehmer Herren Kinder.«
Zu gleicher Zeit kam auch der andere Bote zum Fräule und machte seine Ausrichtung. Wie diese die schönen Küchle sah, und merkte, dass sie so gut schmecken, da erwachte in ihr der Neid, und sie sagte: »Was? dieses Lumpenvolk isst so gut? So etwas gehört nur auf vornehmer Leute Tafel.« Und die Eltern beider Kinder, als sie das hörten, lachten dazu.
Ihr mögt denken, Kinder, dass solche Ruchlosigkeit nicht ungestraft geblieben. Die beiden Schlösser sind alsogleich, mit Mann und Maus, in die Erde versunken. Junker und Fräule sind aber bei Leben geblieben. Wisst ihr, wie? und wo? Arme Bauersleute sind's geworden; die Eltern sind's gewesen von den sechs Buben, die in Raben verwandelt worden, und von dem kleinen Lisele, die sie mildtätig gespeiset. Jetzt wisst ihr alles, und ihr mögt nun fein eure Lehre daraus nehmen.
»Was ist denn aber aus dem Lisele geworden, und ihren sechs Brüdern?« fragten die Kinder. »Hab' ich's euch nicht schon erzählt?«, sagte die Mutter. »Nun«, sagte sie, »so will ich's euch ein anders Mal erzählen.«
Ludwig Aurbacher: Büchlein für die Jugend
DER LÜGNER ...

Als die Großmutter wieder eine Pause machte, nahm der Großvater das Wort, und erzählte folgende Geschichte:
Es begab sich, dass ein frommer Rittersmann ins Wälschland nach Rom pilgerte. Unterwegs gesellte sich ein lustiger Bruder zu ihm, den jener sofort als Bedienten mit sich nahm. Dieser Geselle
hatte aber die böse Gewohnheit, dass er entsetzlich log, was der Ritter nicht leiden mochte.
Eines Tags erzählte er ihm: er habe auf seinen Reisen einen Hund gesehen, der so groß gewesen sei, wie ein Elefant. Das verwies ihm der Ritter, und sagte, das sei gewiss erlogen. Jener aber beteuerte und schwor, dass es wahr sei, und dass nicht ein Haar daran fehle.
Da dachte der Ritter: Wart, deine Lüge will ich dir so schwer machen, dass du sie gern abschüttelst. Er sagte nach einiger Weile zu dem Gesellen: Nun kommen wir bald zu einem Flusse, den wir übersetzen müssen; und es ist die Eigenschaft dieses Wassers, dass derjenige, welcher an demselben Tage gelogen, ohne Rettung darin ersaufet.
Das fiel dem Lügner etwas schwer aufs Herz, und er fragte: wie weit es noch hin sei? Der Ritter antwortete: nicht mehr gar so weit. Da sagte jener, von Furcht getrieben: »Mit Verlaub! habe ich nicht vorher zu Euch gesagt: der Hund, den ich gesehen, sei so groß gewesen, wie ein Elefant?« »Ja, antwortete der Ritter, das hast du gesagt.« »Da hab' ich mich versprochen, sagte der Geselle; ich wollte sagen, er sei so groß gewesen, wie ein Ochs.«
Sie gingen darauf eine Weile weiter, und der Ritter sagte: Nun sehen wir schon in der Ferne den Fluss, über den wir setzen müssen. Der Geselle sah trübselig hinaus und schwieg still. Kurz darauf sagte er aber: »Wenn ich's so recht bei mir bedenke, so erinnere ich mich, dass jener Hund doch nicht ganz so groß gewesen ist, wie ein Ochs; aber größer war er sicherlich, als ein Kalb, ein gemästetes; das kann ich Euch sagen, und ich lass mir nun nichts mehr abmarkten.«
Der Ritter sagte darauf kein Wort, sondern ritt weiter, und sie standen nun am Flusse. Wie nun der Ritter schon im Wasser war, schaute er nach dem Gesellen um, und sah, dass er noch am Ufer wartete, und sich am Kopf kratzte. »Nun was ist's? fragte der Ritter; folgst du, oder folgst du nicht?« Der Geselle sagte: »Mit Vergunst, Herr Ritter! dass ich Euch etwas sagen will. Der Hund, von dem ich zu Euch gesprochen; er war eigentlich nicht viel größer, als ein anderer Hund, oder vielmehr gerade so groß, wie Ihr wisst, dass die Hunde alle sind.«
Nachdem er dies Geständnis getan, ritt auch er in das Wasser, und beide kamen glücklich ans andere Ufer. Als sie wieder im Trockenen waren, da las ihm aber der Ritter ein tüchtiges Capitel; und späterhin, so oft es dem Gesellen beifallen wollte, zu lügen und aufzuschneiden, so erinnerte er ihn an den Hund und an das Wasser, das keinen Lügner duldete.
Nachdem der Großvater geendet, wendete sich Fritz wieder zur Großmutter, und sagte, in einem Tone, der fast wie Spott klang: »Als die Küchle gebacken waren – – wie heißt's weiter?« Die Großmutter drohte dem Schelm mit dem Finger, und fuhr dann fort:
Als die Küchle gebacken waren, sagte die Mutter: »Die armen Kinder des Nachbauern möchten auch gern Kirchweih haben. Ihr könnt wohl warten bis Mittag, wo andere Leute essen.« Also wurden die Küchle eingepackt, und hinüber getragen zu des Nachbauern seinen Kindern. »Was man den Armen tut, tragt Gotteslohn, sprach die Mutter; und die Creatur schreit zum Himmel, und bringt Segen oder Fluch. –
Habt ihr die Geschichte von den sechs Raben nicht vergessen, und dem Schwesterle, das sie gefüttert? Hört nun, wie die Geschichte ausgegangen.«
Das fromme Lisele war von dem Tage an, als die Raben ausgeblieben, nicht mehr bei frohen Sinnen. Es schmeckte ihr kein Vesperbrot mehr, seitdem sie es nicht mehr mit ihren lieben Vögeln teilen konnte. Da kam sie auf den Gedanken: als habe vielleicht das Brot den Raben endlich zu schlecht geschienen, und sie seien darum ausgeblieben. Und sie bat die Mutter, dass sie ihr doch einmal ein einziges Küchle backen möchte, aber ein recht großes.
Die Mutter erschrak darob, wie ihr leicht denken mögt, denn die Küchle gemahnten sie an jenes frühere Unglück. Sie konnte aber dem Lisele, dem einzigen Kinde, nichts abschlagen, und so backte sie denn eines Tags Eines, und zwar ein so großes, dass es die ganze Pfanne ausfüllte. Das nahm Lisele, die nun sieben Jahre alt geworden, und trug es mit sich fort in den Garten, und rief:
Raben schwarz, mit dem Schnabel rot,
Kommet her zum Vesperbrot.
Doch die Raben kamen nicht; aber, indem sie die Worte gesprochen, entwitschte ihr das Küchle, und es wargelte fort auf dem Boden, wie ein Rad. Lisele lief ihm nach, um es einzuholen; aber das Küchle rollte fort und fort, jetzt bergab, dann gradaus, dann ums Eck herum, immer weiter und weiter, bis endlich ein Berg von lauterm Kristall am Wege stand.
Das Küchle aber rädelte sich auch den Berg hinauf, und Lisele konnte nicht nach auf der glatten Wand, weil sie immer ausrutschte. Das arme Mädle wurde nun sehr traurig, und fing an, bitterlich zu weinen. Da öffnete sich ein Tor im Kristallberg, und heraus trat eine weiße Frau zu ihr, die sagte:
»Weine nicht! Dein Küchle ist am rechten Orte. Willst du aber selbst sehen, wo es hin gekommen, so nimm diesen Ring, stecke ihn an den Finger, und reibe ihn.« Lisele nahm den Ring mit Dank an, und tat, wie ihr geraten ward. Und, sieh da! husch! flog sie als Fliege davon, den Kristallberg hinauf, wohin das Küchle den Weg genommen.
Oben am Gipfel bemerkte sie eine weite Öffnung, und wie sie hinein schaute – was meint ihr, was sie da sah? Sechs Junker, in schönen, seidenen Kleidern, saßen da um einen großen Tisch, in dessen Mitte, auf einer silbernen Schüssel, das Küchle lag. Es war aber ein hoher, weiter Saal, darin sie saßen, Boden und Wände von eitelm Silber und Golde, und übersät mit funkelnden Edelsteinen, so dass es im Himmel nicht schöner sein könnte.
Lisele bekam Lust, in den Saal zu fliegen, und die schönen Junker in der Nähe zu besehen – wie denn die Mädle alle neugierig sind. Und sie flog sogleich hinab, und setzte sich dem ältesten auf die Nase. Die Junker waren in lebhaftem Gespräch über das Küchle, wie es so plötzlich herein gekommen, und was wohl die Mutter mache und das liebe Lisele.
So konnte sie denn von einem zum anderen fliegen, und jeden genau besehen, ohne dass sie bemerkt wurde. Endlich aber sah sie der jüngste, und er rief: »Wie kommt denn diese Fliege herein? Jagt sie hinaus!« Und nun machten sie alle Jagd auf die arme Fliege; diese flog hin und her, auf und ab, in voller Angst, erschlagen zu werden, bis sie endlich ganz müd und matt an der Wand hinab fiel in ein Eck, wo man sie nicht mehr bemerkte.
Als sie wieder zu sich gekommen, so stand sie wieder in ihrer wahren Gestalt da, wie sie leibte und lebte; und sie fürchtete und schämte sich, unter so vielen Junkern allein da zu sein. Diese aber, als sie kaum das Mädle erblickten, riefen wie aus Einem Munde: »Sieh da! Schwester Lisele! Ja, wie kommst denn du hierher, liebs Schwesterle? Sei willkommen, Herzenslisele!«
Und sie küssten und drückten sie, dass sie sich fast ihrer erwehren musste. Dann führten sie dieselbe zum Tische; dann musste sie ihnen sagen, wie's zu Hause zugehe, und ob die Mutter noch auf sie zürne; dann erzählten sie, wie es ihnen ergangen; dann baten sie, sie möchte, wie sie es einst mit ihnen als Raben getan, das Küchle verteilen und mit ihnen essen.
Das geschah denn auch; und es schmeckte ihnen über die Maßen gut. Während sie nun so fein friedlich und geschwisterlich mit einander aßen, bemerkten sie nicht, dass der Kristallberg sich plötzlich in einen großen Palast verwandelt habe, mit hohen Fenstern, Toren und Türen, und dass sie in einem prächtigen Speisesaal saßen, aus dem man eine schöne Aussicht hatte an zwei wohl angebaute Berge und längs einem fruchtbaren Thale hin.
Leute kamen von allen Seiten herbei, und guckten in den Saal, und verwunderten sich über den Palast, und über die schönen Kinder, die also in Eintracht zusammen wohnten und aßen und fröhlichen Mutes waren.
»Was ist denn aber aus den Eltern geworden?« fragte Fritz neugierig, nachdem die Großmutter eine Pause gemacht. Diese sagte: »Um das haben auch die neugierigen Kinder ihre Mutter gefragt. Weißt du aber, was die Mutter gesagt hat? ... So eben, hat sie gesagt, hab' ich euch das noch erzählen wollen; es kann aber auch ein anderes Mal geschehen.«
Ludwig Aurbacher: Büchlein für die Jugend
DER VOGEL UND DER BAUERSMANN ...

Die Reihe kam wieder an den Großvater, und er begann, wie folgt:
Ein Bauer hatte einen großen Garten voll schöner Blumen und Früchte, und auf allen Bäumen sangen gar lieblich Vögelein aller Art. Aber der Mann war ein plumper Geselle von einfältigem Verstande und eigennützigem Gemüte.
Eines Tags sah er auf einem Baume ein Vögelein von seltsamer Art, das eine wunderschöne Stimme hatte, und allerlei Weisen sang. Das gedachte er zu fangen, und er legte ihm Schlingen, und fing es.
Da begann der Vogel zu sprechen, und sagte: Was willst du von mir, und was hoffest du, dass ich dir nütze? Der Bauer sagte: Du sollst mir singen im Käfig. Der Vogel: Das will ich nicht, sondern ich werde schweigen. Der Bauer: So werd' ich dich würgen und essen. Der Vogel: Du magst mich sieden oder braten, so hast du an mir nur ein winziges Bisslein. Wenn du mich aber wieder fliegen lässest, so will ich dir sehr zu Nutzen sein; denn ich werde dir drei weise Lehren geben, die feiner klingen, als der schönste Gesang, und so viel wert sind, als der größte Schatz.
Das gefiel dem Bauern, und er ließ den Vogel wieder frei. Da sprach das Vögelein: »Zum ersten, glaub' nicht alles, was man dir sagt; zum andern, behalte, was du hast; zum dritten bekümmere dich nicht um das, was du verlierst. Nach diesen Worten flog das Vögelein auf einen Baum, und fing da an mit heller Stimme zu fingen und zu sagen:
Dem Himmel sei Dank! Dieses teuern Sinne sind so verdunkelt, dass seine Augen nicht gesehen haben, noch seine Hände gegriffen, noch seine Vernunft gemerkt den kostbaren Edelstein in meinem Leib, der wohl zwei Lot schwer ist. Er wäre damit sehr reich geworden, aber ich hätte mein eignes Leben lassen müssen.«
Als das der Bauer hörte, ward er sehr betrübt in seinem Gemüte, und sprach weinend und klagend: Weh mir Armen, der ich den betrüglichen Worten dieses falschen, bösen Vogels geglaubt habe!
Da sprach der Vogel: »O du Tor! warum betrübst du dich in deinem Herzen? Und warum vergissest du die Lehren, die ich dir gegeben habe? Zum ersten, du sollst nicht alles glauben, was man dir sagt. Wie aber könnte es möglich sein, dass ich einen Stein, zwei Lot schwer, in mir trage, da ich doch selbst kaum ein Quentlein wäge? Zum andern, wenn das auch wahr gewesen wäre, warum hast du nicht behalten, was du gehabt? Zum dritten endlich, da du das verloren hättest, so solltest du das vergessen und aus dem Gemüte schlagen.«
Damit flog der Vogel fort in den Wald, und der Bauer sah sich verspottet und verlacht. – Diese Fabel lehrt, dass ein unverständiger Mensch, wenn man ihm auch das Glück in die Hand legte, und die Weisheit in den Mund, doch um nichts reicher und klüger würde.
Der Großvater bemerkte sogleich: »Die Volksweisheit, wie sie sich in dergleichen Fabeln und in den meisten Sprichwörtern kund gibt, hat ein doppeltes Gesicht, gleich dem Janus-Kopfe. Das Eine wendet sich nach der Seite des Sittlichen, das andere nach dem Klugen. Aus jenem Mund vernehmen wir, was gut und böse ist, aus diesem, was nützlich und schädlich ist.
Und so lassen sich denn jene drei Sprüche, welche das kluge Vögelein in der erzählten Fabel vorbringt, in einer andern Beziehung geradezu umkehren, so dass sie also lauten müssten: Glaube alles, was man dir sagt – Behalte nicht, was du hast – Bekümmere dich um das, was du verlierst. – Du begreifest doch das, Karl?«
»Allerdings, erwiderte dieser. Das sagt uns ja schon die Vernunft und der Katechismus. Unsern lieben Eltern z.B. werden wir wohl alles glauben dürfen, was sie uns sagen; und den Armen sollen wir gern mitteilen, was wir im Überflusse besitzen; und, wenn der Mensch seine Ehre verliert, so soll er sich doch wohl darum bekümmern, wie er dieselbe wieder gewinnen könne.«
Nach einer Pause, während sie sich noch mal geräuspert, nahm wieder die Großmutter das Wort, und erzählte:
Als die Küchle gebacken waren, sagte die Mutter: »Jetzt mache sich vorerst jedes von euch an seine Arbeit. Es geht ein Sprichwort: Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Und ein anderes: Hunger ist der beste Koch.« –
Sobald nun die Arbeit getan war, gab die Mutter einem jeden Kind' sein Küchle, und sie sagte: Schmeckts? Gott 'segn' es! Nun wisst ihr, wie's Leuten ist, die vorerst arbeiten, und dann essen. Das sollten eben der Junker erfahren, und das Fräule, die weder Gottes Gabe noch Gottes Werk zu schätzen wussten.
Mit der armen Hütte, die unten im Tale gelegen zwischen den zwei Schlössern, und mit der armen Frau, die drin gewohnt, hatte es eine wunderliche Beschaffenheit; und die Nachbauren umher wussten unglaubliche Dinge davon zu erzählen. Leute, die unter Lichtzeit von Ungefähr an der Hütte vorbei gekommen, wollten bemerkt haben, dass die Alte statt Werg lauter Gold spann und Seide, und die Lumpen, in welche sie sonst gekleidet schien, waren lauter kostbare Stoffe, und alles glänzte in ihrem Stüble von Gold und Edelstein.
Auch erzählten viele, dass seit undenklichen Zeiten kein Glück oder Unglück in der Gegend geschehen, wo nicht die Alte ihre Hände im Spiel gehabt hätte. Daher sagten die Bösen unter ihnen, dass sie eine Hexe, aber die Guten, dass sie eine Fee gewesen. Wunderbar war es, daß an demselben Tag und in derselben Stund, wo die beiden Schlösser versunken, auch die Hütte plötzlich verschwunden ist; und es hat sich an der Stelle ein schmutzig grauer Bühel erhoben, auf dem kein Kräutle und kein Gräsle wuchs; und die ganze Gegend ist verändert worden, daß man sie nicht mehr erkennen konnte.
Wie aber der Junker und das Fräule gerettet wurden, das weiß niemand zu sagen; sie wussten es selbst nicht; ihr Schrecken war zu groß gewesen, als die Schlösser über ihnen einstürzten. Nur so viel erinnerten sie sich, dass sie plötzlich in einer fremden Gegend gestanden, und dass eine Bäuerin aus dem nächsten Dorfe sie auf der Straße gefunden, und in ihr Haus gebracht habe.
Diese hat sie nun in Gottesfurcht und bei Arbeit auferzogen; und als sie groß geworden, hat sie ihnen ihr Bauerngütle übergeben, und sie sind Mann und Weib geworden, und haben sieben Kinder bekommen, sechs Buben und das Lisele, wie ihr schon wisst. – Erratet ihr nun endlich, wer das arme Mütterle in der Hütte im Tal gewesen? Sicherlich ist sie eine Fee gewesen, und dieselbe, welche die ganze Geschichte, wie ihr sie gehört, angestiftet hat zum Schrecken der Gottlosen und zum Segen der Frommen. Nun könnt ihr auch das begreifen, was darauf gefolgt ist.
In demselben Augenblick, als die sechs Brüder mit ihrem Schwesterle das Küchle aßen in Lieb und Eintracht, da kamen Vater und Mutter in einer Kutsche gefahren zum Palast heran. Dieser stand auf demselben Platz, wo die Hütte der armen Frau gelegen war, und wo sich der schmutzig graue Bühel erhoben hatte.
Nachdem sie in den Saal getreten, ei! was war da ein Küssen und Drücken und Umarmen, und ein Fragen, und ein Erzählen, und ein Weinen vor Freuden! Die Fee hatte den Eltern alles kund getan, und dass nun der Zauber gelöset, und ihre Kinder gerettet seien. Und es erscholl alsogleich der Ruf ins ganze Land; und Kaiser und Könige und Fürsten und Grafen kamen herbei; und die Eltern erhielten die väterlichen Güter wieder, und die Kinder lebten in Freude und Eintracht beisammen, bis sie sich vermählten. Die Junker bekamen lauter schöne, edle Frauen aus fürstlichen und gräflichen Familien. Lisele ist aber eine Königin geworden.
Es war unter diesen Erzählungen spät geworden. Die Sonne senkte sich schon hinter die Berge; die Luft fing an, kühl zu wehen; man drängte zum Aufbruch. Für die Großeltern, Mutter und Tante hatte der Vater einen Wagen bestellt, der sie zurück bringen sollte. Die Übrigen traten den Rückweg zu Fuß an.
Ludwig Aurbacher: Büchlein für die Jugend
DAS MÄRCHEN VOM MURMELTIER ...
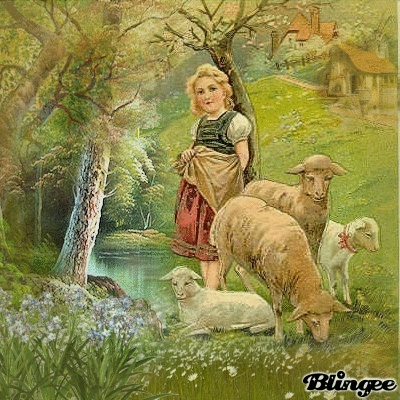
Frau Lureley, die gute und schöne Wasserfrau, reiste über Land, und als sie in Hessen ins Gebirg und in den wilden Wald kam, neigte sich die Sonne schon zu ihrem Untergang, und immer hatte sie noch keinen Brunnen gefunden in dem sie übernachten konnte. Sie war daher etwas besorgt und legte sich dann und wann auf die Erde, um zu lauschen, ob sie nicht einen Brunnen murmeln höre.
Als sie auch einmal so lauschte, hörte sie das Getrappel von einer Herde Schafe und eilte nun nach der Gegend zu, wo das Geräusch erschallte, weil sie wohl wußte, daß die Hirten sich in der Nähe der Brunnen gerne aufhalten. Nicht lange ging sie noch durch den Wald, als eine schöne Wiese vor ihr lag, worauf eine kleine Herde weidete; da sie aber hervortrat, stürzten die Schafe, durch ihre Erscheinung erschreckt, nach der andern Seite der Wiese dem Walde zu, und zugleich sah sie ein junges Hirtenmädchen der Herde nacheilen, um sie zurückzuhalten.
Die Hirtin hatte ein schwarzes Röckchen an, ihr Mieder war rot, ihre Haube auch schwarz, und ihre Haare hingen ihr in zwei langen blonden Zöpfen die Schultern herab, und während sie lief, spann sie ängstlich an einem Rocken. Endlich hatte sie die Herde wieder gesammelt, und da sie nun die schöne Wasserfrau erblickte, welche einen blauen, mit Silber durchwirkten Rock an hatte, stand sie erschrocken still und warf sich dann demütig auf die Knie. Frau Lureley aber nahte sich ihr und hob sie auf und sprach ganz freundlich zu ihr: »Mein Kind! fürchte dich nicht, ich bin ein reisendes Wasserfräulein und suche einen Brunnen, in dem ich heute übernachten kann; willst du mir einen Brunnen zeigen, so will ich dich belohnen.«
»Recht gern, mein schönes Fräulein!« sagte die Hirtin. »Ich muß nur noch meinen Rocken abspinnen und mein Körbchen voll Erdbeeren lesen, dann treibe ich die Herde an einen recht schönen Brunnen, der nicht weit von hier ist, um sie zu tränken, und wasche auch meine Erdbeeren dort.« - »Komm, gieb mir deinen Rocken,« sagte das freundliche Wasserfräulein, »ich will ein Weilchen spinnen, so sammle deine Erdbeeren geschwind, damit wir eher an den Brunnen kommen.«
Die Hirtin gab ihr den Rocken und suchte Erdbeeren, die sie plötzlich in solcher Menge fand, daß ihr Körbchen schnell gehäuft voll war. »Ich bin recht glücklich,« sagte sie, »mein Körbchen ist schon voll, jetzt will ich Euch zum Brunnen führen.« »Gut«, sagte das freundliche Wasserfräulein; die Hirtin trieb nun ihre Herde voran und folgte ihr an der Seite des Wasserfräulein durch den schönen stillen Abend.
»Wie heißt du, mein liebes Kind?« sagte Lureley. Die Hirtin erwiderte: »Ich heiße Murmeltier.« - »Murmeltier!« sagte Lureley erstaunt, »Murmeltier! Wer hat dir denn diesen häßlichen Namen gegeben? Du bist ja so freundlich, hast hübsche rote Wangen und ein Paar helle blaue Augen; so sieht ja kein Murmeltier aus!« Als Lureley so gesprochen hatte, sah sie, daß die Hirtin weinte, und bat sie nun sehr, nicht zu weinen und ihr zu erzählen, was für ein Kummer sie betrübe.
»Ach, liebes Wasserfräulein!« sagte die Hirtin, »ich weine oft hier auf der Wiese; denn es geht mir recht übel. Nicht weit von hier, im wilden Walde, wohnt meine Mutter und meine Schwester; sie lieben mich nicht, nichts kann ich recht machen; sie geben mir so viel Arbeit, daß ich sie nie ganz verrichten kann; ich soll alles tun, was zu Hause zu tun ist: waschen, Feuer machen, Stube und Stall kehren, und doch auch wieder die Herde fahren und pflegen und alle Abend den abgesponnenen Rocken und einen ganzen Korb voll Erdbeeren nach Hause bringen; und fehlt nur das Mindeste an diesen Aufgaben, so geben sie mir das Stückchen Brot nicht, wovon ich lebe, oder nehmen mir das Stroh, worauf ich schlafe, daß ich auf der harten Erde hungernd schlafen muß; ich sage zu allem dem auch kein Sterbenswörtchen und leide alles mit Geduld; wenn meine Schwester aber mich schlägt und ich weine still, so nennen sie dies murren, und so haben sie mir den Namen Murmeltier gegeben.
Ach! wenn die Sonne untergeht, werde ich immer gar traurig; denn nun muß ich nach Haus, und da geht mein Kummer und Leiden an. Wenn ich so den Tag über hier im Walde bin, da habe ich doch Ruhe, da ist mir wohl; alle Vögel kennen mich und grüßen mich und hüpfen um mich herum, wenn ich Erdbeeren lese, und sitzen auf meinem Rocken, wenn ich spinne, und so bring ich den Tag mit einiger Ruhe zu; doch sehe ich immer mit Angst nach der Sonne und zittere, wenn ich sehe, daß sie sich nach den Bäumen senkt; denn dann kommt der Abend, und ich muß nach Hause, wo mich Not und Elend erwarten.«
Während dieser Erzählung hatten sie sich dem Brunnen genähert. »Mein liebes Murmeltier!« sagte Lureley, »nun müssen wir scheiden; ich werde heute Nacht hier bei der Brunnenfrau dieser Quelle wohnen und morgen mit Tagesanbruch weiter reisen; nun hätte ich doch gerne ein Andenken von dir und möchte auch dir etwas geben, denn ich bin dir sehr gut, mein liebes Kind!« - »Ach!« sagte Murmeltier, »was habe ich armes Mägdlein, das ich Euch geben könnte?«
»Ich will dir sagen,« erwiderte Lureley, »wie wirs machen: gieb du mir deine Kleider, ich gebe dir meine; denn es ist mir der silberne lange Rock doch hinderlich auf der Reise, und ich werde in deinem kurzen Röckchen viel schneller gehen können.« Murmeltierchen mußte nun mit der Frau Lureley die Kleider wechseln, und ihr dann die Haare kämmen und flechten, wie sie es selbst trug. Aber wie wunderte sie sich, als ihr aus den Haaren der Frau Lureley lauter Perlen und Edelsteine in den Schoß fielen. »Die schenke ich dir alle«, sagte Frau Lureley; »jetzt will ich mich in dem Brunnen betrachten, wie mir dein Kleid steht«, und indem sie in den Brunnen sah, sagte sie: »O, allerliebst!« und sprang in den Brunnen hinab.
Murmeltier trat nun an den Brunnen und sagte: »Leb wohl, leb wohl, lieb Wasserfräulein! vergiß das arme Murmeltier nicht!«
Da tauchte Frau Lureley noch einmal hervor und sprach: »Mein liebes Kind! ertrage alles mit Geduld, bleibe fromm, fleißig und demütig, und wenn du in großer Not bist, so stürze dich in diesen Brunnen; ich will der Brunnenfrau, die drin wohnt, sagen, daß sie sich deiner annehmen soll. Nun leb wohl!« Da verschwand sie.
Murmeltier sah noch hinab, und da sie ihr eigenes Bild so schön geschmückt im Wasserspiegel sah, dachte sie nicht, daß sie es selbst sei und sagte nur immer: »Je, die schöne, liebe Lureley!« Nun wusch sie ihre Erdbeeren in dem Wasser und ließ dann ihre Herde trinken, nahm den Rocken und das Erdbeerenkörbchen und zog nach Hause, mehr an die liebe Frau denkend als an die harte Begegnung, die sie erleiden würde.
Als sie aber den Mond über den Bäumen heraufsteigen sah, ergriff sie eine große Angst, daß es schon so spät sei, und sie eilte furchtsam in ihre Hütte, trieb die Schafe in den Stall, nahm ihren Rocken und ihre Erdbeeren und trat an die Türe. Da hörte sie schon drin ihre Schwester zanken. »Das faule Murmeltier ist schon wieder zu spät nach Hause gekommen, Mutter!« sagte sie, »und wenn sie nicht alles fertig hat, so will ich sie recht anfahren und ihr das Brot nehmen.« -
»Ja,« sagte die Mutter, »das häßliche, freche Mädchen weiß gar nicht mehr, was sie vor Übermut treiben soll; hat sie nicht gestern gar einen Kranz von Rosen auf dem Kopf gehabt, als sie aus dem Walde kam; es wundert mich nicht, daß sie nie mit ihrer Arbeit fertig wird, wenn sie solche Eitelkeit treibt.« -
»Ich habe ihr aber den Kranz heruntergerissen und mit Füßen getreten«, sagte die böse Schwester, »und ihr einen Strohkranz gegeben. Wo sie nur so lange bleibt? Ich habe doch die Schafe schon blöken hören; sie hat gewiß wieder etwas angestellt und fürchtet sich, hereinzugehen; aber ich will sie schon bei den Ohren hereinziehen.« Nach diesen Worten riß Murxa (so hieß die böse Schwester) die Türe auf, um das Murmeltier zu holen; aber wie erstaunte sie und die Mutter, als sie die glänzende, von Silber schimmernde Jungfrau auf der Schwelle stehen sahen.
Die Frau Wirx, so hieß die alte Frau, und Murxa erkannten sie nicht und warfen sich vor ihr auf die Knie, denn sie hielten sie für eine Königin. Murmeltier aber sagte: »Liebe Mutter, liebe Schwester, ach! kennt ihr mich denn nicht mehr? Ich bin ja Murmeltier, eure Tochter.«
Nun erkannten sie das arme Kind an der Stimme und kamen auch gleich in den größten Zorn. »Ei! sieh da! das garstige Murmeltier läßt sich auf den Knien verehren«, schrie Murxa. »Wo hast du die prächtigen Kleider gestohlen?« sagte Wirx. »Herunter mit den Kleidern!« schrie die Schwester, »ich will sie anziehen« - und so ging es in einem Zanken fort.
Murmeltier ließ sich ruhig die Kleider ausziehen, gab der Mutter die Erdbeeren; die waren aber lauter Goldkörner, und dabei lagen die Perlen, die sie der Lureley aus den Haaren gekämmt hatte; darüber war die Mutter von neuem erstaunt, und als sie ihr den Rocken gab, war das Gespinnst reines Silber. Aber alles war nicht recht; bei allem wurde sie gezankt, und da sie von Frau Lureley erzählte, sagte Murxa:
»Morgen werde ich hin gehen und werde ganz anders beschenkt werden; die Frau Lureley muß nicht recht gescheit sein, daß sie sich so lang mit dir, häßliches Murmeltier! abgegeben« - und nun kniff sie dem armen Mädchen aus Bosheit in den Arm, daß sie laut weinte. »Fort auf dein Stroh, Murmeltier!« sagte Frau Wirx, »schreie uns hier die Ohren nicht voll« - und Murmeltier wünschte freundlich gute Nacht und ging auf ihr dürftiges Lager.
Aber sie konnte vor Traurigkeit nicht schlafen und weinte immerfort und sagte: »Ach! so ist denn, solange ich lebe, noch kein Mensch freundlich mit mir gewesen als die gute Frau Lureley, und alles, was sie mir geschenkt, habe ich hingegeben, und doch werde ich geschimpft und geschlagen; giebt es ein größeres Leid als meins? Nein, ich will nicht schlafen heut nacht; ich will zum Brunnen laufen, ehe die Frau Lureley abreist, und ihr mein Elend klagen, vielleicht giebt sie mir Trost und Rat.«
Geschwind stand sie auf und lief in den Wald an den Brunnen; sie hatte nichts an, als ihren Unterrock und ihr Hemd von grober Leinwand; denn die Schwester, die ihr das Kleid genommen, hatte ihr kein anderes dafür gegeben.
Es war heller Mondenschein, und sie lief in Angst an den Brunnen und kniete weinend dabei nieder. Anfangs scheute sie sich, der Frau Lureley zu rufen, weil sie fürchtete, sie möge sie aus dem Schlafe erwecken; da aber die Nachtigall sie sah, die sie gar wohl kannte, flog sie nieder zu ihr und setzte sich zu ihr auf den Rand des Brunnens und mischte ihren Gesang mit ihren Klagen. Die Nachtigall aber sang:
Viele, viele liebe, süße
Mägdlein kenne ich;
Wenn ich sie sehe gehen
Im Taue auf der Aue, ich sie anschaue
Und sie freundlich begrüße,
Wenn sie sich blicken, und pflücken, sich zu schmücken,
Und drücken mit Entzücken
Die lieben Blumen ans kindische Herz
Und sehen in die stillen blauen Augen,
Mit denen der schüchterne März
Die junge Wärme der Sonne
In sich will saugen,
In die kleinen blauen Violen;
Wenn sie auf leichten Sohlen
Bisweilen eilen zum Strauche
Und im duftenden Hauche
Des Sommers sich brechen
Die Rosen und sich stechen,
Dann ruf ich: Weh! weh! weh!
Auf die Dornen seh!
Und sie setzen sich nieder
Beim duftenden, berauschenden Flieder,
Singen Lieder und schmücken das Mieder
Mit süßen Primeln, Aurikeln, Lilien, Basilien,
Hyazinthen, und winden sich Kränze,
Daß ihr Haupt glänze im Lenze,
Dann sende ich süße Grüße, über die Wiese
Weiß ich zu locken die blumengeschmückten, entzückten Docken,
Die Frühlingsgesellen, zu hellen Waldquellen,
Wo in die Wellen sie stellen
Die rosigen Füße, zu kühlen im Schwülen;
Da grüß ich sie alle mit ihres Namens Schalle:
Grüß dich Gott, lieb, lieb Ludmilla!
Lilla! Sibylla! Kamilla!
Grüß dich Gott, lieb, lieb Agneta!
Margaretha! Elisabetha! Ameleya!
Sophia! Dora! Leonora!
Ricke! Fieke! Anna! Johanna!
Marianna! Susanna!
Grüß dich Gott und das Himmelblau,
Süße Jungfrau! aber alle, alle,
Wie auch ihr Name süß schalle,
Sind mir nicht so lieb, lieb, lieb, lieb,
Als du lieb, du süß, du zart, mild Bild,
Du still, fromm, blond, lind Kind,
Du schön, gut, treugemut
Murmeltierchen!
Murmeltierchen hörte zu, aber sie verstand nicht, was die liebe Frau Nachtigall sang, und sang ihr ganz leise wieder:
Schweig, liebe Nachtigall!
Daß der laute Widerhall
Nicht Frau Lureley erwecke,
Die hier in dem Brunnen ruht.
Ach, sie ist so lieb, so gut!
Laß sie schlummern und verstecke
Dich hier in der Rosenhecke,
Still, still, still, schweige, schweige!
Rauscht nicht so, ihr Eichenzweige!
Morgenwind, zieh still vorbei,
Wecke nicht Frau Lureley!
Sieh, wie ich so stille weine
Hier im lieben Mondenscheine;
Lasse mich alleine, alleine.
Als aber Frau Nachtigall den Namen Lureley hörte, gefiel er ihr so gut, daß sie laut zu singen begann:
Lureley! Lureley -
Klingt süß wie Ameley -
Alle Töne geb ich frei,
Lureley! Lureley!
Komm herbei, herbei, herbei,
Daß das Kind getröstet sei,
Ruf ich immer einerlei:
Lureley! Lureley! -
Nun erschallte aus dem Brunnen eine Stimme:
Wer wecket mich,
Das ist nicht fein!
Noch decket mich
Der Mondenschein;
Ich strecke mich
Und schlafe ein.
»Da hast du's gehört, Frau Nachtigall! jetzt sei still und verstecke dich.« Frau Nachtigall begab sich hinweg in die Rosenhecke und war ganz mäuschenstille.
Auch Murmeltier regte sich nicht, und mit dem Haupt an den Brunnen gelehnt, sah das arme Mädchen in den Mond, bis es entschlummerte und nicht eher erwachte, bis die Schwalbe über dem Brunnen am Fels ihr graues Köpfchen zum Nest herausstreckte und dem Morgenstern allerlei vorschwätzte:
I, wie ziehn die Winde
So geschwinde durch die Linde,
Daß die Blätter zwitschern
Und die Grasspitzen glitzern
Vom Tau, schau!
Da ruht die Jungfrau -
Sie ist gewiß von der Schwester
Gestern wieder geschimpft und gezwickt,
Aus dem Zimmer vertrieben, immer
Ist sie in Zwist, die List
Der bösen Frau Wirx
Quält sie, o, o die verschiednen Geschwister!
Die Schwester lästert und hetzet
Und schwätzet, bis sie das liebe Herz
Mit Schmerz verletzet.
Ach! hätte ich Kisten und Kasten voll
Silber, Perlen und Edelstein,
Dir, Murmeltier, wär alles allein;
Aber ich bin arm, daß Gott erbarm,
Alles ist leer, leer, leer, leer.
Über diesem Geschwätz der Schwalbe erwachte Murmeltier, und da sie in der kühlen Morgenluft fror, weil ihr die böse Schwester ihr Kleid genommen hatte, ward sie sehr traurig und sah in den Brunnen und konnte nicht widerstehen, sie stürzte sich hinab. Sie sank leise hinunter in eine Kammer ganz von reinem Glas, wo Frau Lureley und Frau Else, die Bewohnerin dieses Brunnens, auf dem Bette saßen.
Murmeltier umarmte weinend die Füße der Frau Lureley und küßte der Frau Else den Rock. Diese aber hoben sie auf und setzten sie neben sich, und Frau Else sagte zu ihr: »Mein liebes Mägdlein! soeben hat mir Frau Lureley viel Gutes von dir erzählt, und da sie jetzt abreist, will ich, die hier immer im Brunnen wohnt, deine Freundin sein.« Dann sprach Frau Lureley: »Warum hast du denn kein Kleid an?« - »Ach!« klagte Murmeltier, »alles hat mir die Mutter und die Schwester genommen, was Ihr mir geschenkt habt, und hat mich noch dazu in den Arm gezwickt, daß ich habe weinen müssen, da bin ich denn in meiner Angst hieher geflohen.«
»Wohlan, mein Kind!« sagte Frau Else »ich will dir ein anderes Röckchen geben« - und nun gab sie ihr ein schönes, einfaches, grünes Kleid; dann schenkte sie ihr einen Spinnrocken, der immer von selbst spann, wenn sie allein war, und einen Schäferstab, der alle Wölfe verscheuchte, wenn sie ihn auf der Wiese aufsteckte. Nachdem Murmeltier herzlich für diese Geschenke gedankt hatte, sagte Frau Else: »Nun, mein Kind, kämme mir und Frau Lureley die Haare, wir wollen die deinigen dann auch kämmen« - dann gab sie ihr einen goldnen Kamm, und Murmeltier kämmte beiden die Haare und flocht sie so schön, daß die Wasserfrauen sehr zufrieden mit ihr waren.
Frau Else kämmte ihr hierauf ihre Haare auch und sagte zu ihr: »Mein Kind! so oft du nun deine Haare schüttelst und kämmst, sollen dir die schönsten und glänzendsten Blumen herausfallen. Nun aber gehe nach Haus, besorge alles und führe dann deine Herde auf die Weide, damit die böse Frau Wirx und die Murxa dich nicht zanken.« -
Frau Lureley machte sich nun auch auf die Reise und stieg, nachdem sie von ihrer Wirtin, der Frau Else, Abschied genommen, mit dem Murmeltier aus dem Brunnen. »Liebes Murmeltier!« sagte sie, »jetzt führe mich noch auf den rechten Weg, es soll dich nicht gereuen.« Murmeltier tat es von Herzen, sie ging mit ihr, bis wo das Bächlein einen Teich bildete; da sah sie einen Biber, der sich in einer Falle gefangen hatte, und schnell machte sie ihn frei, wofür ihr der Biber die Füße küßte und freundlich murrte. Da sprach Frau Lureley zu dem Biber:
Lieber Biber!
Kannst nicht sagen,
Wie du möchtest dankbar sein.
Weil die Falle sie zerschlagen,
Sollst du ihr das Wasser tragen,
Sollst ihr Stall und Stub ausfegen
Und ihr dienen allerwegen.
Lieber Biber!
Kannst nicht sagen,
Wie du möchtest dankbar sein.
Nach diesen Worten umarmte Frau Lureley das gute Murmeltier und trennte sich von ihr. Murmeltier aber eilte nach Hause und der Biber hinter ihr her, und während sie die Schafe schnell aus dem Stall trieb, hatte er ihr schon das nötige Wasser getragen und mit seinem Schwanze alles rein und sauber gekehrt, worauf er sich nach seiner Wohnung zurückbegab.
Als Frau Wirx und Murxa die Schafe blöken hörten, standen sie auf und traten an die Türe. »Wer hat dir gesagt, die Schafe auszutreiben!« schrie Frau Wirx. »Hast du nicht gehört, daß Murxa heute auf die Wiese will?« - »Die Schafe mag sie immer treiben,« sagte Murxa, »aber nicht nach der Wiese; da geh ich allein hin; aber wo hat sie das grüne Kleid schon wieder her, sie muß gewiß stehlen.«
Nun näherte sich Murmeltier und erzählte alles, was ihr im Brunnen begegnet. »Sieh!« schrie die Murxa, »wie sie sich die Haare in so zierliche Flechten gelegt« und riß ihr die Zöpfe herunter; da schüttelte Murmeltier ihre Locken, und es fielen die schönsten Blumen heraus, worüber Frau Wirx und Murxa sehr erstaunten, und letztere sagte: »Gleich will ich zum Brunnen laufen und mit eben solchen Gaben zurückkehren.«
Frau Wirx befahl nun dem Murmeltier, ihre Herde nach der andern Seite des Waldes zu treiben und zugleich einen Korb voll Birnen am Abend mitzubringen von dem Baume, der dort stand. Murxa aber ging ganz hoffärtig in dem schönen Kleide der Frau Lureley nach dem Brunnen. Als Murmeltier mit der Herde zum Birnbaum gekommen war, steckte sie ihren Schäferstab in die Erde, zierte ihn mit Blumen und sprach:
Hüte, frommer Hirtenstab,
Den die gute Else gab,
Meine Herde,
Halte mir die Wölfe ab,
Laß die Lämmer nicht verlaufen,
Daß sie all auf einem Haufen
Hier im Gras beisammen bleiben,
Bis ich sie nach Haus will treiben;
In die Erde
Hab ich dich darum gesteckt
Und mit Blumen dich geziert,
Wie's gebührt.
Dann steckte sie ihren Rocken neben den Birnbaum und sprach:
Spinne, lieber Rocken, spinne
Fein und klar nach meinem Sinne,
Daß ich Fäden viel gewinne
Fein und klar, wie das Haar
Der Frau Else im Brunnen war.
Und sieh da! der Stab hütete die Lämmer, sie verließen ihn nicht, und der Rocken spann den klarsten und reinsten Faden wie das goldne Haar der Brunnenfrau. Traurig aber sah Murmeltier den Birnbaum an, er war hoch und steil; sie hatten ihr zwar eine Leiter mitgegeben, aber sie war viel zu kurz, und indem Murmeltier mit Sehnsucht hinauf nach den gelben Birnen sah, sprach sie:
Lieber Birnbaum auf der Wiese,
Kann ich dein gleich nicht genießen,
Will ich dich doch frisch begießen
Aus den Quellen, die hier fließen.
Und nun grub sie mit einem spitzigen Stein eine Rinne aus dem Quell bis zu dem Birnbaum, so daß das Wasser an seine Wurzel floß und den Baum erquickte. Als sie freudig so zusah, wie die durstige Erde rund um den Baum das Wasser einschluckte, fühlte der alte Birnbaum seine Wurzeln erfrischt, er sah mit freudigem Geräusch nieder zu dem Kinde und sprach, indem er die Äste niederbeugte, mit einer Stimme, die wie eine Säge zischte:
Quellen führst du mir zum Herzen,
Linderst mir des Durstes Schmerzen,
Meine Blätter nicht mehr ächzen,
Zungen, die nach Wasser lechzen,
Und ich senke meine Äste
Niederschwenkend, meine besten
Birnen kannst du so erreichen,
Ohne erst heraufzusteigen.
Murmeltier dankte dem Birnbaum und brach ganz leise, um ihm nicht weh zu tun, die schönsten gelben Birnen ab und legte sie schonend in ihren Korb. Worauf der Baum seine Zweige wieder emporhob und freundlich über ihr rauschte.
Als der Abend kam, nahm sie den Schäferstab und den Rocken in die Hand, hob sich den Korb voll Birnen auf den Kopf und zog hinter ihrer Herde nach Haus.
Unterwegs begegnete ihr ein schöner Jäger zu Pferd, er sah die schönen Birnen in ihrem Korb und kaufte sie ihr alle um mehrere Goldstücke ab, so daß sie ganz vergnügt nach Hause kam. Aber da erwartete sie wieder Zank und Verdruß, wenn sie gleich alles, was ihr aufgetragen war, wohl verrichtet hatte.
Murxa war an dem Brunnen gewesen und hatte der Frau Else grob und unhöflich gerufen. Da sie darauf nicht hören wollte, hatte sie einen schweren Stein hinab geworfen und war selbst hinterdrein gefallen; da fand sie denn keine gläserne Kammer, sondern ein trübes sumpfiges Wasser, und Frau Else erschien ihr und sprach: »Du böse, neidische Schwester! so oft du deine roten Haare schüttelst, soll lauter faules Schilf und Stroh herausfallen.«
Wütend vor Zorn fiel sie daher das arme Murmeltier an, die sich kaum vor ihren Mißhandlungen retten konnte. Da Murxa vor Zank und Zorn müde sich in eine Ecke setzte und weinte, legte Murmeltier der Mutter das Gold auf den Tisch und erzählte, wie es mit dem Birnbaum und dem Jäger gegangen war; aber sie hatte schlechten Dank, und wurde ihr gesagt: »Daß du mir heute Nacht das Haus noch kehrst und den Stall reinigest und Wasser zuträgst, sonst gibts Schläge; denn morgen früh mußt du den Esel mit einem Sack Korn in die Unglücksmühle treiben. Geschwind packe dich, Faulenzerin! und arbeite.«
Ruhig ging Murmeltier nach dem Hof, um zu kehren; aber da schlüpfte ihr Freund, der Biber, aus der Hecke hervor und fegte alles rein und trug ihr das Wasser, und gerührt nahm sie ihn in die Arme und gab ihm einen Kuß und sprach: »Lieber Biber! du bist mein einziger Trost, ohne deine Hülfe müßte ich vor Kummer und Not sterben.« -
Da konnte der Biber auf einmal reden und sprach: »Sei zufrieden, mein gutes Kind! und lege dich zu Bett und schlafe ruhig; ich verdanke dir das Leben und nun auch die Sprache, weil du mich geküßt hast. Wenn du morgen an meinem Bau am Teiche vorübergehst, so will ich dir wegen der Unglücksmühle guten Rat geben. Gute Nacht, lieb Murmeltier!« sprach er und ging fort. »Gute Nacht, lieber Biber!« sagte sie und ging, sich aufs Stroh zu legen.
Kaum daß der Tag graute, stand sie wieder auf, legte den Sack mit Korn auf den Esel und zog nach dem Teiche hin. Es war ihr angst und bang, nach der Mühle zu gehen; denn wenn gleich der Müller das feinste Mehl mahlte, so waren doch wenige Menschen wieder aus seiner Mühle herausgekommen, und wußte niemand, was aus ihnen dort geworden. Da sie nun an dem Teiche bei ihrem Freund Biber angekommen, rief sie ihn:
Lieber Biber!
Komm heraus
Aus dem Haus.
Der Biber ließ sie nicht lange warten, kam hervor, grüßte sie und setzte sich neben sie ins Gras, wo er also zu ihr sprach:
»Liebes Murmeltier! sie haben dich nach der Unglücksmühle geschickt, damit du zu Grunde gehst; kein Mensch geht mehr in die Mühle, ohne umzukommen; aber ich will dir raten, wie du sicher hingelangen kannst.« - »Ach! ist denn der Müller ein so gar grausamer Mann,« fragte Murmeltierchen, »daß er mich umbringen wird?« - »Das eben nicht,« sagte der Biber, »aber er ist ein sehr wunderlicher Mensch und gerät leicht in den bittersten Zorn; ich selbst habe es erfahren, laß dir erzählen.
Sein Vater, der alte Kampe, bemerkt plötzlich ein wunderbares Glück in seinem Haus: Gold, Silber, Getreide, Mehl, Gut und Geld mehrte sich unbegreiflich unter seinen Händen, und er wußte gar nicht, wo ihm all der Segen herwuchs. Als er nun einmal mit der Hacke im Garten stand und den vollen Segen seines Feldes und der Bäume anschaute, sprach er traurig: 'Lieber Himmel, was soll mir all das Glück, da ich den nicht kenne, der es geschenkt, um ihm zu danken; lieber wollt ich arm sein und den Freund umarmen, der mir diesen Segen bringt, als so allein hier in Hülle und Fülle sitzen.'
Kaum hatte er diese Worte von ganzer Seele gesprochen, als die Erde vor ihm erwühlt wurde und er, der einen Maulwurf zu sehen erwartete, schon die Hacke aufhob, um ihn zu erschlagen; aber sieh da! es war kein Maulwurf, es war ein kleines, braunes, freundliches Erdfräulein, das ihm die Arme entgegenstreckte und zu ihm sagte: 'Ich halte dich beim Wort, mein lieber Kampe! umarme mich, ich bin das deutsche Erdfräulein und heiße Wurzelwörtchen; immer hab ich dich geliebt wegen dem schönen, reinen und richtigen Deutsch, das du sprichst, und habe dich deswegen mit Segen überschüttet; werde mein Gemahl, so soll dein Glück sich immer mehren.'
Meister Kampe zögerte nicht lange, er schlug ein, und sie heirateten sich. Nach einem Jahr schenkte Wurzelwörtchen dem guten Müller Kampe einen Sohn, der Voß hieß und sehr bald sprechen, aber wie sprechen lernte: so schön, so richtig, so rein, daß auch kaum ein Härchen fehlte, daß man ihn gar nicht verstanden hätte. Dieser Sohn wuchs heran; er war ungemein tiefsinnig und still; er spintisierte bald alles aus und richtete die Mühle besser ein, daß die Räder auch so richtig klapperten, daß nicht eine Sekunde am Schlag fehlte.
Sein Vater wollte, er sollte sich ganz allein mit der Mühle abgeben, damit er selbst studieren könne, aber das ging nicht. Voß hatte einen viel größeren Trieb zum Studieren als sein Vater, und wartete nur eine Gelegenheit ab, diesem zu zeigen, daß er gegen seinen Sohn doch nur ein dummer Müller sei. Als nun Kampe mit seiner Frau Wurzelwörtchen einstens im Garten saß und neue Worte machte, trat Voßchen auf einmal hervor und las ihnen dreimalhunderttausend neue deutsche Wörter vor, an die der gute Meister Kampe nie gedacht hatte; und der Vater ward durch diese Gelehrsamkeit seines Sohnes so bestürzt, daß er in den Armen der Frau Wurzelwörtchen auf der Stelle verblich.
'Lebe wohl, mein Sohn!' sagte die Erdfrau; 'dein Vater ist durch dich gestorben, drum muß ich von dir scheiden; aber weil du unschuldig daran bist, so sollen dir meine Geister doch immer dienen.' Somit nahm sie ihren Gatten in die Arme und sank mit ihm in die Erde. Voß machte sich nicht viel daraus; er arbeitete immer darauf los und ward täglich finsterer und menschenscheuer; ja, je weiter er in der Sprache kam, je mehr hütete er sich, sie zu sprechen, um sie nicht zu verderben und zu beschmutzen.
Nun wurde ihm der große Zulauf zu seiner Mühle immer lästiger, weil der Mehlstaub ihm alle die schönen neuen Wörter und Redensarten bestaubte, die er täglich ausdachte, und er machte sich dran, den Zugang zu seiner Mühle auf alle mögliche Weise zu erschweren, was er auch mit Hilfe seiner Erdgeister so zustande brachte, daß fast niemand mehr zu ihm gelangt. Ich selbst habe seinen Zorn bitter erfahren, denn er ist es, der mich in einen Biber verwandelt hat.«
»Ach! was warst du denn, lieber Biber?« fragte Murmeltier neugierig.
»Ich war ein Fischer und hieß Biber«, sagte der Erzähler, »und lebte still hier am Teiche. Da nun einstens der Müller Voß eine Menge neuer Wörter und Redensarten, die ihm unter die Kleie gekommen waren, hier am Teiche waschen wollte, schnappten sie ihm meine Hechte und Karpfen weg, und so kamen alle diese wunderlichen Worte mit den Fischen nach und nach in meinen Netzen zu mir.
Ich aber trieb einen frommen Handel damit; denn da ich wußte, daß der Müller alle Leute in Kornsäcke steckte und so in den Rauch hängte, die zu seiner Mühle kamen, ohne ein neues Wort zu haben, so warnte ich hier die Vorübergehenden und gab ihnen für kleine Münze neue Wörter, womit sie den Müller bezahlen konnten. Endlich merkte der Müller ihre Quelle; zornig kam er zu mir, nahm meinen ganzen Vorrat als sein Eigentum in Besitz, und verwandelte mich zur Strafe in das, was mein Name bedeutete, in einen Biber, und nahm mir die Sprache; denn umbringen durfte er mich nicht, weil seine Mutter mir wohl wollte.
Als er mich so verwandelt hatte, sagte er: 'Solange sollst du die Sprache verlieren, bis ein Murmeltier dich umarmt und zu dir spricht: lieber Biber!' Daß du es sein könntest, wußte er nicht; so hast du mir die Sprache wiedergegeben und mir früher das Leben gerettet aus der Falle, die er mir gestellt, und nun will ich dir sagen, wie du zu der Mühle kommen kannst und wie du dich bei ihm benehmen mußt. -
Nehme hier nicht den kurzen Weg, sondern gehe dort droben auf dem Umweg durch die Felsen. Mische dich in keinen Streit, keinen Handel, der dir auf dem Weg aufstoßen könnte; stellen sich dir wilde Tiere entgegen, so berühre sie nur mit deinem Schäferstab; triffst du jemand in Not, so helfe von ganzem Herzen; fährt dich jemand grob an, so antworte ihm höflich; des Müllers bösen Hunden gebe dein Brot. An die Türe klopfe nicht, sondern sage nur: 'Ins Heu, ins Heu, ins Heuderlei'; erlaubt er dir, einen Strauß zu binden, so breche die Blumen nicht selber, sondern gehe lieber ohne Strauß heim; vor allem hüte dich, ein undeutsches Wort zu sagen, und statt Sack sage Beutel. - Nun gehe in Gottesnamen, ich will dir immer in der Nähe sein.«
Murmeltier dankte dem Biber und trat nun ihre Reise an. Das erste, was ihr begegnete, war ein sehr lächerlicher Zank jenseits des Zaunes, der ihren schmalen Fußsteig begleitete. Zwei Männer stritten sich: ob die Louise oder die Dorothea schöner sei; der eine schrie, Louise hat schönere Füße, der andere sagte, Dorothea hat eine schönere Seele.
Da schrie der erste: »Aber man geht nicht auf der Seele, man geht auf den Füßen«, und darauf sagte der zweite: »Man denkt auch nicht mit den Füßen, man denkt mit der Seele.« - »Louise hat immer mit den Hühnern zu tun.« - »Dorothea läuft immer an den Brunnen.« So zankten sie lange, und Murmeltier wollte eben durch den Busch gucken, als der Biber vor die Lücke trat und sie warnte.
Als sie weiterkam, stellte sich ihr ein Wolf entgegen; er hatte sich eine Schafshaut umgehängt und Kamaschen angezogen und stellte sich ganz galant. Aber Murmeltier kannte ihn gleich, sie zeigte ihm nur den Schäferstab, und er zog sich zurück. So machte sie es auch mit einem Bären und einem Auerochsen; schon sah sie die Mühle am Ende einer Wiese liegen, als sie plötzlich neben sich an einem Brunnen eine weinende Stimme hörte.
Sie eilt hinzu und sieht eine wunderschönes Kind in dem Brunnen liegen, das sich kaum mehr über dem Wasser erhalten kann. Ohne sich zu besinnen, springt Murmeltier hinab und wirft das Kind heraus ins weiche Gras. Als sie sich aber kaum selbst wieder auf den Rand des Brunnens geschwungen hatte, erblickt sie einen närrischen Affen in einer bunten Jacke, der das Kind aufpacken und davon laufen will.
Schnell springt nur Murmeltier herzu, rührt den Affen mit dem Schäferstab an, und er fällt auf den Rücken tot nieder. Nun naht sie sich, das Kind auf den Armen, der Türe der Mühle. Große Hunde nahen sich ihr; sie bellten nicht, denn der Müller, der das Hundegebell nicht leiden konnte, hatte ihnen die Zungen ausgeschnitten; aber grimmig fletschten sie die Zähne. Da gab ihnen Murmeltier ihr Brot, und sie legten sich ruhig wie Lämmer nieder und fraßen.
Nun war zwar ein schöner brillantener Klopfer an der Türe, aber Murmeltier rührte ihn nicht an und sagte nur: »Ins Heu, ins Heu, ins Heuderlei« da sprang die Türe auf, sie ging mit dem Kinde hinein.
»Wer hat dich gelehrt, unangemeldet zu treten ins gastfreie Haus, glänzt der Hammer doch blank gescheuert am reinlichen Tore«, schrie der Müller ihr entgegen. Murmeltier erwiderte: »Ich wollte nicht stören die Ruhe des heiligen Denkers mit lautem Gepoche.« Da sagte der Müller: »Immer wißt Ihr mit ekler Entschuldgung zu mehren die Schuld; schweiget und tretet herzu, weil Ihr nun einmal listig gelangt in das Haus.«
Nun eilte Murmeltier mit dem Kind ans Kaminfeuer, um es zu trocknen, und da sah der Müller, daß es Abraham, sein Söhnchen, war, dem sie das Leben gerettet; er brachte es gleich seiner Frau, die auch erfreut war. Als er aber hörte, daß Murmeltier auch den Affen totgeschlagen, ging er ganz froh hinaus und holte ihn herein und sagte ihr: »Herzlichen Dank verdienst du, o Freundin, du schlugst meinen Feind, den Affen Sonneto, den lumpengeflickten, und ich nagle den Schelm nun an den Baum des Gartens, daß er mir scheuche die Vögel, die Diebe der lachenden Kirschen.«
Nun nahm er Murmeltier mit in den Garten und nagelte den Affen an den Baum unter den bittersten Verwünschungen. Es war nicht zu sagen, wie schön der Garten war: da standen nichts als Lorbeer- und Olivenbäume und Rosen und Weinreben und eine Menge der schönsten Blumen. Der Müller sagte ihr, sie möge sich einen Strauß brechen; aber sie dankte. Da brach er ihr selbst einen und einen für ihre Mutter und sprach dann zu ihr:
»Nehme den Strauß, o Mägdlein! bewahr ihn, beschaue ihn täglich, und bemerkest du traurig, daß er verliere den Glanz und den Duft der schimmernden Blätter, dann besorge Gefahr und lege die zierlichen Blumen in Milch, so senket der Schlaf sich bleiern hernieder, und Wirx, die Mutter, wird schlummern mit Murxa, der zänkischen Schwester; dann aber schreite und suche in Kisten und Kasten der Mutter, du findest ein Lichtlein, der Docht ist gewunden aus schwarzer und rötlicher Wolle; dies aber nimm und lege an dessen Stelle dies ähnliche Kerzlein, das ich dir gebe, mein Kind! zum Danke der Rettung.«
Murmeltier dankte dem Müller herzlich, und schon wollte sie scheiden, als er ihr sagte: »Aber wo hast du das Korn, das zu mahlen du brachtest auf rüstigem Esel?«
Da erwiderte Murmeltier: »Draußen im leinenen Beutel träget es fest gefüllet das Tier und seufzt der Entladung.«
»Gut ist die Sprache, mein Kind!« versetzte der Müller, »doch sage, wer lehrt' dich zu meiden ausländisches Wort und den Sack nicht zu nennen, dem doch die sprechenden Völker alle gegeben das Recht der Heimat bei sich?« - »Ach!« sagte Murmeltier ängstlich und kniete nieder, »ach! teurer bester Herr! verzeiht mir, ich habe einen Freund, einen guten braven Mann, den Biber, der hat es mich gelehrt; ach! wenn Ihr mir eine Liebe antuen wolltet und wolltet ihn wieder zum Menschen machen; sprechen kann er schon, er hat mir sein Unglück, Euch zu mißfallen, erzählt, ich bin ihm viel Dank schuldig.« -
»Wohlan,« versetzte gerührt der Müller, »die Bitte gewähr ich; Murmeltier heißt du, so ward denn mein Fluch erfüllet, und gehe, berühre mit den Blumen den Freund, so wird ihm geholfen. Aber er meide das Land und ziehe hinab an den Rheinstrom, nicht mehr sich mengend in sprachliche Forschung.« Nun gab er dem Murmeltier einen Sack voll Mehl statt dem Korn und entließ sie, die voll Freuden nach dem Teiche zog, um den guten Biber zu erlösen.
Als Murmeltier bei dem Biberbau am Wege anlangte, kam ihr der gute Biber mit den Worten entgegen: »Nun, mein liebes Kind! wie ist es dir ergangen?« - »Über alle Erwartung gut,« sagte Murmeltier, »und dir selbst bringe ich die freudigste Botschaft; wenn du an den Rhein ziehen und dich gar nicht mehr mit neuen Wörtern abgeben willst, so darf ich dich nur mit diesem Blumenstrauß berühren und du bist wieder der Fischer, der du warst.« -
»Mein Kind,« sagte Biber, »das ist ein hoher Preis; ich soll dich verlassen, ich soll dir die Stube nicht mehr auskehren, das Wasser nicht mehr tragen, ich soll dich in Kummer und Not wissen und dafür nur ein Mensch sein. Nein, mein liebes Murmeltier! mute mir das nicht zu; lieber bleibe ich bei dir und ein ehrlicher Biber, als daß ich dich verlasse und wieder ein Mensch werde.«
Murmeltier war über die große Güte des Bibers tief gerührt und sprach zu ihm, indem sie ihn zärtlich an ihr Herz drückte: »Lieber Biber! du bist das edelste, liebste Wesen auf Erden, das ich kenne, und es verdient meine innigste Liebe, daß du mir ein so großes Gut aufopferst; aber ich will es dir ewig gedenken, und es steht von nun an in deiner Gewalt, ein Mensch zu werden, wenn du es begehrst.« Da sprach der Biber: »Nie werd ich es begehren, wenn ich dich darum verlassen soll.« - In solchen Gesprächen nun zogen sie mit einander nach Haus.
Der Biber schlich in den Hof und den Stall und brachte alles in Ordnung. Murmeltier aber lud ihren Esel ab, stellte den Mehlsack in die Küche und trat freundlich mit ihren zwei Blumensträußen in die Stube zur Mutter; doch verbarg sie den ihrigen auf ihrer Brust, weil sie fürchtete, er möge ihr von Murxa genommen werden.
»Seht, da hat sie der Kuckuck schon wieder«, schrie Murxa; »wir dachten schon, wir wären sie los.« - »Unkraut verdirbt nicht«, schrie Frau Wirx; »wo hast du das Mehl? Du warst gewiß nicht in der Mühle.«- »Liebe Frau Mutter!« sprach Murmeltier, »in der Küche steht ein großer Sack des feinsten Mehls, und hier habt Ihr einen Strauß von lauter Edelsteinen, den mir der gütige Müller für Euch gegeben« - und nun erzählte sie von der Schönheit der Mühle und der Freundlichkeit des Müllers.
Aber Murxa sagte: »Es ist gewiß alles erlogen, wie von dem abscheulichen Birnbaum; ich war dort, er hat mir die Zweige nicht niedergesenkt; ich habe ihn geschüttelt, er hat sich nicht gerührt; ich habe mit Prügeln nach ihm geworfen, da hat der boshafte Baum einen solchen Regen von Birnen auf mich herabfallen lassen, daß sie mich voller Beulen geschlagen, und als ich sie sammelte, waren sie alle voller Flecken.
Dein schöner Herr Jäger, der mir begegnete, wollte sie nicht kaufen; da sagte ich ihm, er sei ein Schlingel, da gab er mir eine Ohrfeige, und die sollst du wieder haben, du Falsche! du Lügnerin! die mich in den Verdruß gebracht« - und nun schlug sie der armen Murmeltier ins Gesicht, die weinend entfliehen wollte; aber Murxa, die häßliche, böse, hielt sie zurück und sprach: »So kommst du nicht davon; erst kämme mir die Haare, und wenn nur ein bißchen Stroh oder Schilf herausfällt, so ermorde ich dich.«
Weinend nahm Murmeltier ihren eigenen Kamm und kämmte der bösen Murxa die Haare, und siehe da! der Kamm hatte die glückliche Wirkung, daß die roten Haare sich wie gewöhnliche Haare kämmen ließen. »Nun sage mir nochmals alles von dem Müller«, sprach Murxa, »und lüge nicht, sonst soll es dir übel gehen; denn morgen in aller Früh will ich auch zu dem Narren, dem Müller, gehen und mir Edelsteinblumen holen.«
Nun sagte ihr Murmeltier nochmals alles, was nötig sei, glücklich in die Mühle zu kommen, und ging dann ruhig mit einem Stückchen Brot auf ihr Stroh, das ihr der gute Biber recht reinlich aufgeschüttelt und mit Blumen bestreut hatte. Sie sagte ihm freundlich Dank und gute Nacht, und dann trennten sie sich.
Am folgenden Morgen ging sie zur Mutter und fragte, ob sie vielleicht heute backen solle, weil sie das Mehl gebracht. »Ist das eine Frage, dummes Murmeltier!« schrie Frau Wirx. »Wozu habe ich denn das Mehl holen lassen? Ich dachte, du hättest den Teig schon fertig geknetet, den Ofen schon geheizt; fort, du Faule! an die Arbeit und lasse mich schlafen!« Nun eilte Murmeltier an den Backtrog, da war aber Freund Biber schon da und hatte Wasser hineingetan.
»Heize den Ofen nur geschwind,« sagte er, »ich will den Teig während dem kneten« und beide arbeiteten so schnell, daß das Brot schon im Ofen war, ehe Frau Wirx aufstand, wo sich der Biber geschwind zurückzog, um nicht von ihr gesehen zu werden. Nun mußte Murmeltier der Murxa den Esel aufzäumen und beladen. Dann stand Frau Wirx auf und sah nach dem edelsteinernen Blumenstrauß, den ihr Murmeltier mitgebracht; aber er war in der Nacht an ihrer Brust schwarz wie Kohlen geworden.
Zornig eilte sie auf Murmeltier zu, die vor dem glühenden Backofen stand, und wollte sie hineinwerfen; aber der gute Biber sah sie kommen und schlug ihr mit dem Schwanz, der vom Kneten noch voll Mehlbrei war, ins Gesicht, daß sie nichts sehen konnte; worauf er wieder davonlief. Frau Wirx wurde nun bitterböse und warf den Strauß auf die Erde; aber kaum hatte ihn Murmeltier, die ihn aufhob, berührt, so war er so glänzend als vorher.
»Liebe Mutter,« sagte sie, »steckt den Strauß ins Wasser, bis Ihr ihn verkauft, so wird er immer schön bleiben.« Frau Wirx wurde durch den erneuten Strauß wieder etwas zufrieden und ging nach ihrer Stube zurück. Nun mußte Murmeltier der Murxa den Esel zäumen und ihm den Kornsack aufladen, dann gab sie ihrer Schwester einen frischgebackenen schönen Kuchen für die Hunde des Müllers, und die faule Murxa setzte sich noch zu dem schweren Sack auf den Esel, so daß das arme Tier kaum fort konnte.
Das erste, was sie unterwegs tat, war, daß sie den Kuchen rein aufaß, den sie den Hunden hätte mitbringen sollen. Als sie auf die Wiese kam, sah sie einen Hirten schlummern, der sich das Gesicht gegen die Fliegen zugedeckt hatte, und eben raubte ihm der Wolf einige Schafe. Sie weckte ihn nicht und hatte ihre Freude dran, und als der Wolf mit den Schafen weg war, nahm sie ihm leise das Tuch vom Gesichte, daß die Fliegen ihn recht stechen sollten.
Sodann kam sie in ein Wäldchen, da saß eine Jungfrau bei einem Feuer und einer schönen Quelle, und wollte Kaffee kochen, schnell sprang Murxa vom Esel und trank ihr den ganzen Topf aus und schlug ihr den blinkenden Kessel am Baume voll Beulen, und trieb ihren Esel in die Quelle, der sie mit seinen schmutzigen Füßen verunreinigte. Das Flehen der reinlichen Jungfrau machte sie nur lachen.
Sie zog nun weiter; da sah sie eine große buntscheckige Katze sitzen, die mit dem Schwanze in einem Baume eingeklemmt gewaltig lamentierte und zu ihr schrie: »Murxa! mache mich los; der vermaledeite Müller hat mich hier eingeklemmt, weil er meinen schönen Gesang nicht leiden kann; ich heiße Canzone und bin eine italienische Katze und fresse nichts als süße Orangen, und er möchte sie gerne allein essen. Mache mich los, ich helfe dir auch in die Mühle.« Sogleich machte Murxa die Katze los, die nun hinter sie auf den Esel sprang.
Als sie zur Mühle kam, kamen die Hunde auf sie los und würden sie gewiß zerrissen haben, wenn die Katze nicht von dem Esel herabgesprungen und, von ihnen verfolgt, über die Hecke in des Müllers Garten gesprungen wäre. Während dem schlug Murxa mit dem Hammer an die Türe; aber sie verbrannte sich die Finger, denn der Müller hielt ihn immer sehr heiß, damit sich die Fliegen nicht darauf setzen sollten, die er nicht leiden konnte.
Die Mühle ging auf, Murxa schrie den Müller, der an einem Pulte stand und mit den Fingern die Schläge seiner Mühle mit den Worten: dalderal, dalderal, dalderal, nachtrommlelte, an: »Was klappert ihr da? Ich wollte Euch besser sagen, wie es lautet: Es ist ein Dieb da, es ist ein Dieb da. Wer ist er? Wer ist er? Wer ist er? Der Müller, der Müller, der Mahler, der Dieb.«
Höflich fragte sie der Müller: »Schelmisches Mägdelein! du scherzest! Sage, was führet dich her auf beschwerlichem Wege zur klappernden Mühle?« - »Was mich herführt? Das ist kurios gefragt. Mehl will ich haben, ennuyanter Kleienfresser! Ihr gebt Euch ein so douces Air und wollt immer die Miene eines honnête homme annehmen, und dahinter steckt nichts als Intrigue und Filouterie.« -
»Komme, mein Töchterlein!« sagte geduldig der gütige Müller, »komm, ich tausche dein Korn dir mit zartem wohlschmeckendem Mehle und geleite zum Garten dich, Jungfrau! daß du dir brechest ein Sträußlein von edlem Gestein, zu Haus die freundliche Mutter mit köstlicher Gab zu erfreuen«- »Allons, fortgemacht!« sagte Murxa und folgte ihm in den Garten.
Aber kaum war der Müller drin, als er die Katze sah, die auf dem Baume saß und einen zahmen Vogel fraß, den er sehr liebte. Zürnend lief er der Katze nach, die von Baum zu Baum sprang, wozu Murxa nur immer lachte und währenddem sich die Taschen voll Edelsteinblumen brach und die übrigen mit ihren plumpen Füßen zertrat und verwüstete. Endlich war die Katze entflohen, und als der Müller seinen Vogel beklagte und über den fluchte, der die Katze befreit, lachte ihn Murxa aus und sagte ihm, daß sie es getan, worüber der Müller sehr erbittert wurde.
Nun trat auch der Hirt mit ganz zerstochenem Gesicht auf und klagte über sein Leid und das geraubte Vieh. Es war des Müllers Sohn. Auch Louise, seine Tochter, kam weinend und klagte, daß Murxa ihren Kessel verdorben, den Kaffee getrunken, die Quelle getrübt habe, und da Murxa sie zu allem diesem auslachte, wurde der Müller erzürnt und warf sie zur Mühle hinaus. Sie kümmerte sich aber um nichts.
Das Mehl war schon auf den Esel geladen, mit Edelsteinen war sie bepackt, und hohnlachend ritt sie nach Hause. Am Ende der Mühle sah sie zwei Männer, die sich um einen gebundenen Ring schlugen; da der Ring an der Erde lag, stieg sie ab und wollte ihn für sich stehlen. Aber die zwei Männer fielen nun über sie her und prügelten sie braun und blau, legten sie dann ohnmächtig auf den Esel, der seinen Weg nach Hause verfolgte.
Indessen war Murmeltier mit ihrer Herde schon nach Hause gekommen und stand mit ihrem Spinnrocken unter der Türe im Abendschein. Da kam der Jäger, der ihr die Birnen abgekauft, zu Pferde angeritten, stieg ab und band sein Pferd an das Fenstergitter. Geschwind lief Murmeltier hinein und sagte der Frau Wirx, wer da sei. Sie kam mürrisch heraus; aber der Gedanke daß der Mann, der die Birnen so gut bezahlt, viel Geld haben müsse, machte sie kriechend und freundlich. »Was verlangt der gnädige Herr Ritter?« sagte sie, »wer ist Er? womit kann ich dienen?« Er sprach:
Ich bin Konrad, der müde Mann,
Und sprech Euch um Nachtherberg an.
Da sagte Frau Wirx:
Um Silber und um Gold
Könnt Ihr haben, was ihr wollt.
Da stieg der Jäger ab und sprach zum Murmeltier:
Nun, Jungfrau, liebste Jungfrau mein!
Schenkt mir einen Becher kühlen Wein ein.
Da jagte Frau Wirx das Murmeltier zankend in den Keller nach Wein, den sie bald brachte und dem Jäger mit den Worten darreichte:
Ach Ritter, liebster Ritter mein!
Hier nehmt von mir den kühlen Wein.
Der Ritter aber wollte nicht zuerst trinken und reichte ihr den Becher mit den Worten zurück:
Trink erstlich ab, du roter Mund!
Dann leer ichs Glas bis auf den Grund.
Murmeltier trank ein wenig ab und gab ihm den Becher freundlich wieder, den er austrank. Die Frau Wirx aber jagte sie in die Küche und sagte, sie solle nicht so frech sein. Als der Ritter mit ihr allein war, sprach er zu Frau Wirx:
Frau Wirthin, liebe Frau Wirthin mein!
Ist dies fürwahr Euer Töchterlein?
Sie sagte:
Es ist nicht sowohl mein Töchterlein
Als mein Küchensudel, mein schmutzig Schwein.
»Nun,« sagte der Ritter, »wollt ihr sie mir heute nacht auf meine Kammer geben, so sollt ihr Geld und Gut haben, so viel Ihr wollt.« - »Ihr könnt tun, was ihr wollt«, sagte die böse Frau Wirx. »Nun, so laßt sie mir ein Fußbad machen und heraufbringen«, sprach der Ritter Konrad und ging nach seiner Stube.
Frau Wirx nahm nun eine hübsche Badewanne aus dem Schrank und gab sie dem Murmeltier mit dem Befehl, sogleich ein Fußbad mit Kräutern für den Ritter zu machen und ihm zu bringen. Als sie nun in den Garten ging, Majoran zu brechen, setzte sich auf einmal eine Amsel, die zahm im Haus herumzufliegen pflegte, vor sie auf einen Baum und sang:
In dem Badwännlein bist du hergetragen,
Darin mußt du ihm die Füße zwagen;
Dein Vater starb in Leid und Not,
Deine Mutter grämet sich zu Tod.
O weh! du armes Findelkind!
Weißt nicht, wer Vater und Mutter sind.
Aber sie verstand seine Sprache nicht und wunderte sich nur, daß der Vogel, der sonst immer geschwiegen hatte, so gesprächig geworden war; denn er wiederholte ohne Unterlaß die nämliche Weise. Nun kam der gute Biber und sagte ihr, was die Amsel gesungen, und sie verwunderten sich beide darüber, denn sie verstanden es nicht. Murmeltier aber ward sehr traurig über den Gesang und machte sich allerlei wunderliche Gedanken.
Als sie nun das heiße Wasser über die Kräuter in der Küche ins Badwännlein goß, kam die Mutter Wirx und sagte ihr: »Marsch! packe dich hinauf zu dem Gast, und daß du mir nicht wieder herunterkommst; du mußt mir heute Nacht bei ihm bleiben; er will es haben und gibt mir hundert Goldstücke dafür.« -
»Ach!« weinte Murmeltier, »er wird mich doch nicht kränken und beleidigen, er war so freundlich gegen mich!« Da flog die Amsel wieder her und sang ihr Lied, worüber sie in große Sorge geriet und nach ihrem Strauß sah, den ihr der Müller gegeben, ob er ihr irgend eine Gefahr andeute; aber der Strauß war frisch und blühend, und sie fürchtete sich nun nicht mehr; aber weinen mußte sie doch aus einer geheimen inneren Schwermut.
Als sie das Bad hinauftragen wollte, zupfte sie der Biber nochmals am Rock und sprach: »Liebes Murmeltier! vergiß mich nicht, vergiß mich nicht; es steht etwas Großes bevor, denn die Amsel singt noch immer.« Sie nahm Abschied von ihm -
Und trug nun das Badwännlein
Wohl in des Herren Kämmerlein;
Sie fühlt hinein, obs nicht zu warm
Und weint dazu, daß Gott erbarm.
Der Ritter sprach: »Warum weinst du dann,
Schein ich dir nicht ein guter Mann?«
Sie sprach: »Ihr scheint ein frommer Mann,
Ich wein über unserer Amsel Sang,
Ich war im Garten und brach das Kraut,
Da sang die Amsel hell und laut:
'In dem Badwännlein ist sie hergetragen,
Darin muß sie ihm die Füße zwagen,
Der Vater starb in Leid und Not,
Die Mutter grämte sich schier zu Tod.
Weh! Murmeltier, du Findelkind!
Weißt nicht, wer Vater und Mutter sind.'«
Da sah der Ritter das Badwännelein an
Und sah das burgundische Wappen dran,
Er sprach: »Das ist mein Wappen allein,
Wie kommt die Wanne ins Wirtshaus herein?«
Da sang die Amsel am Fensterladen:
'In dem Wännelein ist sie hergetragen.
Weh! Murmeltier, du Findelkind!
Weißt nicht, wer Vater und Mutter sind.'
Da sah Herr Konrad ihr an den Hals,
Und sah da wohl ein Muttermal.
»Gott grüß,« sprach er, »du roter Mund!
Dein Vater war König von Burgund,
Christina heißt deine treue Mutter,
Ich, Konrad, bin dein Zwillingsbruder.«
Nun knieten sie beide auf ihre Knie
Und dankten Gott bis morgens früh.
Und als nun morgens kräht der Hahn,
Fängt schon Frau Wirx zu rufen an:
»Steh auf steh auf, du faule Haut!
Kehr deiner Mutter die Stuben aus.«
Da schrie Herr Konrad überlaut:
»Sie kehrt nicht, ist keine faule Haut,
Herein, Frau Wirx! kommt nur herein
Und bringt mir meinen Morgenwein.« -
Und als Frau Wirx herein nun trat,
Herr Konrad sie gefraget hat:
»Woher habt ihr das Jungfräulein,
Die Königstochter, mein Schwesterlein?«
Frau Wirx ward bleich gleich wie die Wand,
Die Amsel verriet da ihre Schand:
»In dem Lustgarten, im grünen Gras,
Das Kind in dem Badwännlein saß
Auf einem grünen Rainelein,
Spielt mit den bunten Steinelein,
Da kam die böse Wirx ins Land
Und warf ihr hin ein seidnes Band,
So hat die böse Zigeunerin
Gestohlen das zarte Kindelein.«
Herr Konrad ward da hoch entrüst,
Sein Schwert er durch der Frau Wirx Ohrläppchen stieß
Und spießte sie fest da an die Wand
Und nahm die Schwester an der Hand
Und nahm sie an dem Gürtelschloß
Und schwang sie auf sein hohes Roß.
Das Badwännlein hing am Sattelknopf,
Die Amsel saß auf des Rosses Kopf.
So ritten sie wohl manche Stund,
Bis in das Schloß, ins Land Burgund,
Und als er in das Tor einritt,
Die Mutter ihm entgegenschritt:
»Konrad! lieber Konrad mein!
Was bringst du mir für eine Braut herein?« -
»Ich bringe keine Braut herein,
Ich bring Euch Euer Töchterlein.«
Die Tochter da vom Rosse sprang,
Die Mutter in eine Ohnmacht sank,
Und als sie wieder zu sich kam,
Ihr Kind sie in die Arme nahm.
»O laßt mir das eine Freude sein,
Ich bin Euer armes Töchterlein;
Heut sind es fürwahr achtzehn Jahr,
Daß ich der Frau Mutter gestohlen war;
Frau Wirx, die böse Zigeunerin,
Trug mich in dem Badwännlein hin.«
Und als sie sprach, die Amsel sang,
Daß laut die Stimm im Schloß erklang:
»Frau Wirx schreit jetzt: 'Mein Ohr tut weh!'
Sie will keine Kinder stehlen mehr;
Nun laßt vom Goldschmied klar und rein
Mir schmieden ein goldnes Gitterlein,
Wohl schmieden vor das Badwännlein,
Es soll der Amsel Wohnung sein.«
So schnell und wunderbar hatte sich das Unglück des armen Murmeltiers gewendet. Sie war nun eine Prinzessin von Burgund und hatte alles vollauf; die Amsel saß in der kleinen Badwanne, die ihr der Goldschmied in einen Vogelbauer verwandelt hatte; aber Murmeltier war doch nicht ganz glücklich. Immer dachte sie an die letzten Worte des guten Bibers: »Vergiß mich nicht! vergiß mich nicht!« - und wenn sie nun gedachte, daß er aus Liebe zu ihr ein Biber geblieben war, so weinte sie oft im stillen, daß sie seinen Bitten nachgegeben und ihn nicht zum Menschen verwandelt hatte.
Hierauf kam noch ein trauriger Fall: ihre Mutter, die Königin von Burgund, war durch die plötzliche Freude des Wiedersehens so erschüttert worden, daß sie krank ward und nach wenigen Wochen starb. Ihr Bruder Konrad, der nun der Herr des Landes war, fragte sie oft um ihren Kummer, sie sagte ihm endlich die Geschichte des Bibers, und er machte sich nun auf den Weg, den Biber zu suchen, und tat einen Eid, nicht eher zurückzukommen, bis er den Biber gefunden.
So war sie nun allein und betrübt auf dem Schlosse und sah alle Augenblicke zum Fenster hinaus, ob ihr Bruder nicht bald zurückkommen würde.
Ich will nun erzählen, wie's unterdessen der bösen Frau Wirx und der Murxa gegangen.
Murxa lag, wie ihr euch erinnern werdet, tüchtig abgeprügelt über dem Mehlsack auf dem Esel, der so langsam unter seiner Last nach Haus schritt, daß er erst vor der Hütte ankam, als Frau Wirx schon mit dem Ohrläppchen an die Wand gespießt und Ritter Konrad mit Murmeltier davongeritten war.
Dem Meister Langohr ward es zu lang, bis das Tor aufgemacht und ihm seine Last abgenommen wurde, er schüttelte sich daher aus Leibeskräften und warf die ohnmächtige Murxa mitsamt dem Mehlsack nieder. Da diese in die Brennesseln fiel, kam sie wieder zu sich und hörte nun ihre Mutter lamentieren. So schnell sie konnte, lief sie nun die Treppe hinauf und zog den Degen heraus, womit die Mutter angespießt war. Nun erzählten sie sich beide ihr Unglück unter beständigem Schimpfen auf Murmeltier.
Jetzt will sie der Mutter das schöne Mehl zeigen, aber kaum hat sie den Sack geöffnet, als lauter häßliche Stechfliegen heraussummen und sich ihr und der Mutter ins Gesicht setzen und sie zerstechen. Nun konnten sie sie nicht wieder loswerden, bis sie sich beide in ein Faß Wasser setzten und die Fliegen ersäuften. Nun wollte sich Murxa mit ihren Edelsteinen trösten und schmückte sich mit ihnen von oben bis unten und legte sich, so auszuruhen, ins Bett.
Kaum aber war sie eingeschlummert, als sich alle die Edelsteine in Hornissen und Wespen verwandelten und sie so zerstachen, daß sie das eine Auge drüber verlor. Die Mutter kam auf ihr entsetzliches Geschrei und wußte sich keine andere Hilfe, da die Wespen sie auch zerstachen, als daß sie ein großes Feuer auf dem Herd machten und sich beide auf den Schornstein in den Rauch setzten, wodurch sie, nachdem sie ganz schwarz geräuchert waren, endlich die beschwerlichen Tiere los wurden.
Da oben im Rauchfang sagte nun Frau Wirx: »Warte, mein Kind! jetzt fällt mir ein Mittel ein, wie wir uns an dem falschen Murmeltier rächen. Laß uns unser Haus hier verbrennen und zu ihr nach Burgund ziehen. Wir erzählen ihr unser Unglück und flehen sie höflich an; sie ist eine so dumme Gans, sie kann keinem Menschen etwas abschlagen.«
Nun begaben sich Frau Wirx und Murxa herab und verbrannten das Haus, machten ihre besten Sachen zusammen, nahmen den Rocken und den Schäferstab des Murmeltiers und das seidene Kleid, das ihr Frau Lureley gegeben, und schlugen den Weg nach Burgund ein.
Unterwegs kamen sie abends zu einer alten Base der Frau Wirx, die in einem abgebrannten Dorf auf dem Kirchhof wohnte, bei der übernachteten sie und erzählten ihr ihr Vorhaben. Da schenkte ihnen die Alte eine Wachskerze von Menschenfett mit einem roten und einem weißen Docht und sagte ihnen, wenn sie die anstecken würden, so müsse Murmeltier sterben. Vergnügt über dies Geschenk setzten sie ihren Weg fort und kamen, nachdem sie bei drei Monaten unterwegs gewesen, endlich nach Burgund vors Schloß.
Es war gerade der Ort im Lustgarten, wo Frau Wirx vor achtzehn Jahren die Prinzessin geraubt hatte, und heute war gerade der Tag und die Stunde. »Hier«, sagte Frau Wirx, »laß uns unsere Heuchelei anfangen« - und nun setzten sie sich beide in das Gras und weinten. Murmeltier wollte zum Andenken den Ort besuchen und ihr trauriges Geschick beweinen; denn immer war ihr Bruder mit dem Biber noch nicht zurückgekehrt.
Als sie nun zu der Stelle im Garten kam, sah sie Frau Wirx und Murxa an der Erde liegen und weinen. Sie stellten sich, als wenn sie Murmeltier nicht bemerkten, und schrien immer fort: »Ach! wir Unglücklichen! Ach! daß wir die arme Prinzessin so gekränkt; Gott hat uns gestraft, wir sind um alles gekommen, das Feuer hat uns alles geraubt.«
Murmeltier konnte sich der Tränen nicht enthalten. Die Frau und die Tochter, die sie so lange für Schwester und Mutter gehalten, rührten sie. »Stehet auf,« sprach sie, »ich verzeihe euch von Herzen.« - »Ach!« schrie Frau Wirx, »ist es möglich? Sieh, hier haben wir dir auch deinen Hirtenstab und Spinnrocken und dein schönes Kleid mitgebracht; alles andere ist uns verbrannt! Das haben wir allein gerettet!« Murmeltier dankte herzlich, umarmte beide und nahm sie in das Schloß, kleidete sie neu an, machte sie zur Obersthofmeisterin und Murxa zur ersten Hofdame.
Da die zwei bösen Weiber allein in ihrer Stube waren, lachten sie herzlich über die Dummheit des guten Murmeltieres - so nannten sie ihre Güte - Und Frau Wirx sagte: »Nur nichts merken lassen, Murxa! wir wollen unser Glück hier noch aufs höchste treiben.« So mißbrauchten sie heuchelnd und schmeichelnd mehrere Wochen die Güte der frommen Murmeltier.
Eines Abends ging diese allein am Rhein spazieren und spann an ihrem Rocken, und dachte an ihren Bruder, als sich auf einmal auf der entgegengesetzten Seite ein Ritter auf einem weißen Rosse ins Wasser stürzte. Murmeltier eilte mit ausgebreiteten Armen gegen den Strom und schrie: »Ach! Konrad! Konrad! bringst du meinen Biber mit?«
Aber der Biber konnte den langsamen Schritt des Rosses nicht abwarten und schwamm ihm voraus und lag zu den Füßen der jubelnden Prinzessin, die nicht länger zögern wollte und ihn mit ihrem Strauße berührte, worauf er sogleich als ein schöner junger Fischer zu ihren Füßen lag. »Gnädige Prinzessin!« rief er aus, »ach! hättet ihr mich einen Biber bleiben lassen; ein Biber darf wohl um Euch sein, ein armer, niedriger Fischer ist zu geringen Standes für Eure Würde.« -
»Ei, was Würde!« schrie Murmeltier, »Ihr seid mir der Liebste auf der Welt!« und umarmte ihn. Nun kam auch Konrad auf seinem Rosse ans Land und umarmte seine Schwester und fragte: »Ei! wo ist denn der Biber?« - »Hier ist er,« sagte Murmeltier, »hier dieser Fischer, ich habe ihn gleich wieder zum Menschen gemacht.« Konrad ließ sich alles erzählen und erzählte auch, wie er den Biber in der ganzen Welt gesucht und ihn endlich bei Biberich am Rhein gefunden.
»Ja,« sagte der Biber, »als Murmeltier fort war, wollte ich auch nicht mehr in jenem Lande bleiben und zog, nachdem ich lange vergebens sie suchend herumgeirrt war, endlich in die Gegend von Mainz und legte mir dort einen Bau an, wo er mich vor drei Tagen gefunden hat.«
Nun begaben sie sich in das Schloß, denn Konrad klagte über Frost und Nässe, weil er über den Rhein geschwommen. Sie brachten ihn auf seine Stube und pflegten ihn, der Fischer Biber blieb bei ihm. Auf einmal in der Nacht pochte etwas an Murmeltiers Stube. »Wer ist draus?« rief sie. »Geschwind, geschwind, liebe Prinzessin!« rief der Biber, »kommt zu Eurem Bruder.«
Murmeltier warf schnell einen goldnen Schlafrock um und eilte in Konrads Kammer, aber der war dem Tode schon nah. »Ach!« sagte er, »liebe Schwester! ich habe mich gestern im Rhein erkältet nach dem heftigen Ritt, und muß nun sterben.« Murmeltier weinte sehr, aber Konrad nahm ihre Hand und legte sie in des Fischers Hand und sprach: »Ich gebe euch einander, seid glücklich und regiert das Land!« und somit starb er in ihren Armen. Man begrub ihn zu der Mutter; beide hatte die Freude getötet.
Murmeltier ließ am folgenden Morgen dem Fischer prächtige Kleider anlegen, versammelte das Volk und kündete ihnen ihr Glück und Unglück an. Alles brachte seine Glückwünsche und Beileidsbezeugungen, auch Frau Wirx und Murxa heucheln und bringen ihre Wünsche dar.
Nun war die Trauerzeit verflossen, man machte Anstalt zur Hochzeit, und als der Hochzeitsabend kam, sagte Murmeltier zum Fischer: »Lieber Biber! wir wollen heute Nacht nicht in die Brautkammer gehen, wir wollen jeder in seiner Stube beten.« »Ja«, sagte der Biber, und beide gingen nach ihrer Kammer.
Frau Wirx hatte indes die garstige Murxa angeputzt und verschleiert und legte sie heimlich ins Hochzeitsbett mit der Absicht, das arme Murmeltier nachher mit ihrem Zauberlichte zu töten, und so ihre häßliche Tochter zur Königin zu machen.
Während sie dies aber tat, sah Murmeltier an ihrem Betstuhl knieend ihren Edelsteinstrauß plötzlich welk und blaß werden. Schnell fielen ihr die Worte des Müllers ein, sie lief und holte das Licht, das er ihr gegeben, und ging damit nach der Frau Wirx Kammer, wo sie das ähnliche Licht schon auf dem Leuchter stecken sah. Sie verwechselte nun die beiden Lichter und ging nach ihrem Betstuhl zurück. Da sah sie ihre Blumen wieder frisch und gesund, wofür sie Gott herzlich dankte.
Kaum hatte Frau Wirx die häßliche Murxa in das Brautbett gelegt, als sie nun das Zauberlicht ansteckte und sich zu Bett legte. Auf einmal hörte sie im Schlafe eine Stimme:
Weh! Weh! ich vergeh,
Weh! ich sterbe,
Ich verderbe;
Ganz in Schmerzen
Brenne ich gleich einer Kerzen.
Da wachte Frau Wirx auf. Als sie aber das Zauberlicht noch brennen sah, sagte sie: »Schon gut, schon gut, bald wird es aus mit dem Murmeltier sein.« Dann schlief sie ein, und nach einer Stunde hörte sie wieder:
Weh! Weh! ich vergeh,
Weh! ich sterbe,
Ich verderbe;
Schon am Herzen,
Zehret mir die Zauberkerzen.
Da wachte sie wieder auf, und als sie das Zauberlicht bis auf den letzten Docht herabgebrannt sah, sprang sie auf, warf es an die Erde und trat das Licht aus mit den Worten:
Sterbe, Licht,
Das Herz bricht
Zu dieser Frist,
Wider das du gemacht bist.
Nun war sie versichert, daß Murmeltier tot sei, und schlief ruhig wie eine Ratze schnarchend.
Am Morgen war große Versammlung am Hofe angesagt, das Ehepaar zu begrüßen. Sie als Obersthofmeisterin mußte die Herrschaft empfangen. Sie legte sich in den größten Staat und trat mit der hoffärtigsten Miene in den Audienzsaal, fest versichert, nun ihre Tochter als Königin hereintreten zu sehen.
Alles war versammelt, die Türe öffnete sich: Biber führte nach der Sitte des Landes seine Frau verschleiert herein. Die Obersthofmeisterin Wirx mußte ihr den Schleier abnehmen. Sie ging triumphierend auf sie los und, fest überzeugt, ihre Tochter als Königin zu präsentieren, hob sie den Schleier weg - und tat einen lauten Schrei, als sie Murmeltier heil und gesund fand. Wütend lief sie nach der Brautkammer, riß die Vorhänge des Brautbettes auseinander, und als sie da ihre Tochter zu Kohlen verbrannt sah, gestand sie ihre gräßliche Tat der ganzen Versammlung, die ihr gefolgt war, und sprang rasend, ehe man sie halten konnte, von dem Schloßfenster hinab in den Rhein.
Nun ging der König und die Königin und der ganze Hofstaat in die Kirche, Gott für die abgewendete Gefahr zu danken, und regierten ein Jahr lang ihr Volk ruhig.
Doch währte das nicht lange. Ein benachbarter König wollte den Biber nicht als Regenten über Burgund anerkennen und zog mit einem großen Kriegsheer ins Land, wo er eine große Partei unter dem Adel hatte. Der Aufstand ward allgemein, der Biber sagte da zu Murmeltier: »Wenn du nicht wärst, so wüßte, ich wohl, was ich täte.« - »Was würdest du denn tun?« - »Ei! ich würde«, erwiderte Biber, »zu dem närrischen Volke sagen: Laßt euch regieren, von wem ihr Lust habt, und würde weg gehn und ein Fischer sein nach wie vor.« -
»Von Herzen bin ich das zufrieden«, sagte Murmeltier und umarmte ihn und nahm ihre Spindel und ihren Schäferstab und die Amsel in dem Badwännlein, und was sie sonst hatte, und trat mit ihrem Fischer vor das Volk und sagte: »Lebt wohl, allerliebste Untertanen! Laßt euch regieren, von wem ihr wollt«, und verließ mit ihm das Land.
Anfangs bauten sie ihre Fischerhütte, wo der Biber am Rhein war wiedergefunden worden, und nannten den Ort Biberich; dann zogen sie hierher nach Mainz und lebten glücklich; der Himmel schenkte ihnen ein Töchterlein, das hieß Ameleychen.
So weit hatte Frau Marzibille erzählt, als alles schrie: »Ameleychen! Ameleychen!« und siehe da, das liebe Kind schwamm eben auf dem Kahne von Schwänen gezogen heran und eilte seiner Mutter in den Schoß, die vor Freude nicht wußte, was sie machen sollte.
Auch der Fischer Peter umarmte sein Kind zärtlich, und dann die Königin Ameley, der das Mägdlein wie auch dem Radlauf viele Grüße vom Vater Rhein mitbrachte.
Als sich die freudigen Herzen wieder ein wenig beruhigt hatten, besah Frau Marzibille ihr Kindlein von oben bis unten und sagte: »Gott sei Dank, Herzkind! Es fehlt dir nichts, du bist so frisch und gesund.« - »Ja, das bin ich,« sagte Ameleychen, »aber was macht denn Weißmäuschen und Goldfischchen?« Auf diese Worte des Kindes nahten sich Prinz Philipp und Prinz Georg und umarmten das Kind mit den Worten: »Liebes Ameleychen! sieh, wir sind nun Prinzen geworden, aber wir wollen dich immer lieben und dir Gutes tun.« Ameleychen sah sie verwundert an und küßte ihnen die Hände, worauf es zu seiner Mutter zurücklief.
»Lieber Fischer Petrus!« sagte nun der König Radlauf, »Ihr seid also der treue Biber, und ihr, Frau Marzibille, seid das treue Murmeltier!« - »Ja,« sagten beide, »das sind wir.« Da erwiderte Radlauf: »Nun, wohlan! so will ich euch euer Königreich Burgund wieder erobern, so ihr es wollt.« - »Nein, nein!« schrien beide, »wir wollen lieber hier bleiben bei Euch.«
Da sagte der König: »So schenke ich euch das Land zu Biberich, wo ihr zuerst gewohnt, und ich will euch ein Schloß hinbauen, aus dessen Fenstern ihr fischen könnt.« Dafür dankten sie nun beide schönstens, und Radlauf sagte: »Ehe wir heute morgen auseinander gehen, bestimmet mir, Frau Marzibille, wer nach Euch erzählen soll.« Da schrie ein feines Stimmchen aus der Menge: »Wartet noch ein bißchen, ich will erst dem Ameleychen sein neu Kleidchen anprobieren!«
Und siehe da, ein kleines Männchen, nicht viel länger als ein Daumen, führte einen schönen Geißbock heran, auf dessen Rücken ein allerliebstes rotes Röckchen lag. Er nahte sich der Frau Marzibille und sprach: »Liebe Frau Nachbarin! da ich Euch immer lieb gehabt, und ihr mir manches Fischchen in der Hungersnot geschenkt habt, so habe ich in den letzten Tagen Eurem Ameleychen dieses artige Kleid gemacht, daß es doch bei seiner Rückkunft eine Freude habe.«
Herzlich dankte Frau Marzibille dem guten Schneiderlein Meckerling. Sie zog ihrem Kinde das neue Röckchen an und sprach: »Zum Dank für Eure Freundschaft sollt Ihr morgen Euer Märchen erzählen und dadurch Euer Söhnlein Garnwichserchen wieder haben.«
Vor Freude sprang nun Meister Meckerling auf seine Ziege und galoppierte freudig nach Haus, daß auch das ganze versammelte Volk über das kleine närrische Kerlchen lachen mußte.
Am folgenden Morgen versammelte sich wieder alles, um den Schneider erzählen zu hören; denn alles war doch äußerst begierig, was das kleine flinke Kerlchen vorbringen würde. Alles hatte sich bereits gesetzt, als der Schneider auf der Ziege geritten kam. Er steckte seine Elle, die gegen ihn ein ziemlicher Balken schien, in die Erde und band die Ziege, die gegen ihn so groß wie ein Elephant war, daran fest und setzte sich hierauf wieder auf das Tier, auf dessen Rücken er, um besser gesehen zu werden, als Kissen ein schön gepläckeltes Nadelkissen gelegt hatte. Nun stach er die Ziege mit einer Nadel ins Ohr, daß sie meckerte, worauf alles still wurde, und er hob an zu erzählen:
.Das Märchen vom Schneider Siebentot auf einen Schlag
Clemens Brentano
DAS MÄRCHEN VOM SCHNEIDER SIEBENTOT AUF EINEN SCHLAG ...

Eines Morgens wollte es in Amsterdam gar nicht Tag werden, die Häringsfischer guckten alle Augenblick zum Fenster hinaus, ob die Sonne bald aufgehe, daß sie auf den Fang fahren konnten. Die Seelenverkäufer machten wohl zwanzigmal den Laden auf, um nach der Morgensonne zu sehen, weil sie die Seelen heraus zum Verkauf hängen wollten; denn sie nehmen sich in der Morgensonne sehr schön aus und singen dann: »Wach auf, mein Seel, und singe!« wodurch sie Käufer herbeilocken. Aber immer blieb es dunkel. Die Käshändler liefen auf die Straße und guckten nach dem Himmel; aber dunkel war es, dunkel blieb es, und kein Mensch wußte, wo er dran war.
Nun war gerade blauer Montag, an dem die Schneider sich zu belustigen pflegen; aber sieh da! es wollte der Tag nicht blau werden, und die edlen Gesellen krochen unzähligemal an die Dachfenster und sahen, ob der liebe blaue Montag nicht anbrechen wollte.
Da aber doch alle Uhren schon auf elf Uhr mittags standen, wurden die Leute fast rasend vor Angst; sie liefen auf den Gassen hin und her und stießen mit den Köpfen gegeneinander, daß es puffte. Nun war da auch ein Zahnarzt und Hühneraugenschneider; der wollte von der Versammlung der Menschen seinen Vorteil ziehen. Er spannte seinen Schimmel in seine rote Kalesche, hängte einige Laternen daran, legte seine Gerätschaften vor sich und fuhr auf den Buttermarkt, mitten unter das wehklagende Volk.
Ebenso machten es die Seelenverkäufer; sie machten ihre Boutiquen auf, hängten ihre Seelen an Nägeln heraus, stellten Laternen dazu und verkauften da manche Seele, die schon sehr abgetragen oder schmutzig war, oder ein garstiges Loch hatte, in der Dunkelheit noch für eine ganz gute saubere Seele. Andere Seelenverkäufer aber hielten es für besser, im Dunkeln einzukaufen; sie liefen auf dem Buttermarkt herum und schrien:
»Keine Seelen, keine Seelen zu verhandeln? Lustig! lustig! Wer sich noch einen guten Tag machen will, der verkaufe seine Seele um ein paar gute Stüber und gehe ins Wirtshaus und trinke sich eine Courage, denn die Welt geht unter; die Sonne ist gestern abgereist und kommt nicht wieder. Lustig! lustig! Die Seelen verkauft! Alle Stunden werden sie wohlfeiler werden; denn wenn nun die Welt zusammenfällt, sind sie doch verloren, und mancher gäbe sie dann gern gratis weg, wenn sie nur einer wollte.«
Dazwischen schrie der Zahnbrecher wieder: »Wer noch sein Zahnweh, seine Hühneraugen loswerden will, der komm heran! Stück für Stück ein Stüber; jetzt geht die Welt unter, und da kommt Heulen und Zähneklappern, da sind gute Zähne nötig. Munter! munter heran! In einer halben Stunde fahr ich weg, da geht die Welt unter, da machen wir alle die Boutiquen zu.«
Durch das Geschrei der Seelenverkäufer und des Zahnbrechers stieg die Angst des Volkes aufs höchste. Manche ließen sich die Zähne ausbrechen, eine unzählige Menge verkauften ihre Seelen um ein Spottgeld und liefen wieder zu den Buden und hofften, sich bessere einzuhandeln, aber da bekamen sie immer noch schlechtere.
Da ritten endlich die Generalstaaten auf den Markt und befahlen, von jeder Seele, die verkauft würde, müsse ein Stüber abbezahlt werden fürs Armen- und Narrenhaus, und befahlen zugleich, man solle die Judenseelen billiger geben, weil sie erst müßten eingeweiht werden; sodann fügten sie hinzu:
»Getreue Bürger der guten Stadt Amsterdam! Wir waren soeben in der Judenstadt und haben ihren Rabbinern befohlen, gegen die Erlaubnis, an dem Rathause vorüberzugehen, die wir ihnen bewilligen wollen, zum allgemeinen Besten und zur Vernichtung der nun bereits um sechs Stunden zu langen Nacht, ihren langen Tag der guten Stadt Amsterdam zum Geschenk zu machen; aber das hartnäckige Volk will nichts zu unserer Stadt Bestem tun, so daß wir uns gezwungen sehen, gewaltsame Mittel anzuwenden und ihnen den langen Tag mit gewaffneter Hand abzunehmen. Wir fordern also eine werte Bürgerschaft auf, eine Partie tapferer Leute zu diesem Zwecke abzusenden, die Judenschule zu erbrechen, den langen Tag bei den Ohren zu erwischen und zu uns auf das Rathaus zu führen.«
Kaum hatten die hochmögenden Generalstaaten dies gesagt, als ein wackerer Schneidermeister, Meckerling genannt, - es war mein Vater, liebe Mitbürger! - hervortrat und die Schneider aufrief, sich diese Gelegenheit, auf ewig berühmt zu werden nicht rauben zu lassen. Gleich versammelten sich viele um ihn, sie setzten sich auf ihre Böcke und galoppierten durch die Straßen und schrien:
»Heraus! Brüder, heraus! Auf! auf! ihr edlen Schneiderlein, auf! Es geht fürs Vaterland und den blauen Montag!« Dazu klapperten sie mit Scheren, und die Böcke meckerten dazwischen, daß es eine Lust war. Aus Türen und Fenstern hüpften sie heraus, und immer größer ward ihre Menge; es war, als wenn es Schneider regnete.
Als sie nun hörten, daß sie die Judengasse stürmen sollten, hielten sie einen Rat miteinander, wie sie zu rechter Courage kommen sollten. Da schlug mein Vater vor, sie sollten sich bessere Seelen kaufen. Nun wurden die feigherzigsten Schneiderseelen zusammengesucht und zu den Seelenverkäufern gebracht. Es waren an die neunhundert. Der Seelenverkäufer legte sie auf eine Waage und wog nun alte Matrosen- und Soldatenseelen dagegen, und sie bekamen nicht mehr als neunzig für neunmal neunundneunzig. Die schönen Seelen verfälschten sie nun im Hinterteil und wußten sie so zu zerren und zu drehen und vorteilhaft einzuteilen, daß sie vollkommen hinreichten, das ganze erste Glied mit Courage unterm linken Knopfloche zu versehen.
Mein Vater, Meister Meckerling, führte nun den Kern der Schneider gegen die Judengasse. Es waren lauter freiwillige Volontärs; sie steckten ihr Wachsstümpchen auf die Ellen und klapperten mit den Scheren, den Juden die Bärte abzuschneiden. Die Juden ihrerseits hatten ihre Gasse verrammelt mit allerlei altem Hausgeräte, altem Zinn und altem Kupfer, und als sie hörten, daß es die Schneider waren, hatten sie ihren großen alten Sündenbock aus dem Kirchhof genommen und den Schneidern hinter die Wagenburg von altem Hausrat spöttisch gegenübergestellt, sich selbst aber alle in die Judenschule gesetzt, wo sie den langen Tag eingesperrt hatten und beteten.
Mutig stürzten die edlen Krieger in die Gefahr, sie durchbrachen den jüdischen Trödelverhack; aber hier empfing sie der grausame Sündenbock, der sie als ein unvernünftiges Vieh, da sie nur einzeln herüberkonnten, niederstieß. Viele Brave verloren durch diese Bestie ihr Leben, und als der Bock endlich über die Barriere hinübersetzte und auf das ganze Corps der Edlen losging, ergriffen die Schneider die Flucht und wurden bis in ihre Herberge verfolgt, wo sie sich wieder setzten und sammelten.
Hier erfand mein Vater eine Kriegslist. Der Bock stand noch immer vor der Türe und bohrte mit seinen Hörnern dran, daß es entsetzlich anzusehen war. Nun ließ mein Vater die Kellertüre öffnen und dann die Haustüre; der Bock, der eben stark drückte, fiel, als die Türe plötzlich aufging, zum Haus hinein und die Treppe in den Keller hinab, welcher gleich hinter ihm verschlossen wurde.
»Nun«, sprach er, »wollen wir die listigen Hebräer wieder mit Tieren bekriegen«; er ließ alle Schweine, die er haben konnte, vor seinen Braven hertreiben. Die Juden, die, ihres Sieges gewiß, schon wieder aus der Schule heraus waren und ihren alten Trödelmarkt unter heftigem Gezänke, wem jedes Stück zugehöre, auseinandersuchten, schwärmten wie die Ameisen auf der Gasse herum; als plötzlich die Schweine, von den Nadelstichen der Schneider gereizt, in die Gasse einbrachen und alles niederrannten. Die Rache der Schneider war vollkommen; die Juden waren gänzlich in die Flucht geschlagen, sie flohen alle nach ihrem Kirchhof, den sie verschlossen.
Nun erbrachen die Schneider die Judenschule, in der es zu ihrem Erstaunen ganz helle war; denn da saß der lange Tag, so lang als er war, mit Zopfband an einem Pfeiler angebunden, und hatte ein großes Stück Matzekuchen in den Händen, an dem er aß, und sang mit vollem Maule ein hebräisch Lied. Er hatte einen himmelblauen Rock an, unten herum mit lauter Zimpeln behängt, und sang wie eine Nachtigall.
Die Schneider zögerten nicht lang, nähten ihm Hände und Füße zusammen, banden ihm Stricke an die Beine und schleiften ihn, in dem sie sich alle vorspannten, nach ihrer Herberge. Als sie durch die Straßen von Amsterdam den himmelblauen Labelang schleppten, ward es helle, und die Mittagssonne trat plötzlich über dem Rathaus hervor.
Der Jubel des Volks war allgemein; aber die Generalstaaten nahmen es den Schneidern sehr übel, daß sie den langen Tag auf die Herberge und nicht auf das Rathaus gebracht hatten. Sie kamen vor die Herberge geritten und forderten die Schneider auf, den langen Tag herauszugeben zum allgemeinen Besten der Republik. Aber die Schneider sagten: »Haben wir die Gefahr gehabt, so wollen wir auch den Genuß haben«, welches ihnen endlich auf unbestimmte Zeit zugestanden ward.
Nun waren die neunmal neunundneunzig Schneider gar nicht mehr zu bändigen vor Hoffart und Tapferkeit. Sie putzten sich den langen Tag mit tausend bunten Lappen und besetzten ihn mit Borten und gesponnenen Knöpfen, benähten ihn mit Steifleinwand und Kamelhaar; hierauf machten sie ein großes Netz und stellten es vor die Kellertür. Wütend stürzte der Bock herauf und verfing sich in dem Netze. Da warfen sie ihn an die Erde und vernähten ihm alle Luftlöcher des Leibes, daß er kaum atmen konnte.
Nun banden sie ihn an eine Menge Stricke, setzten den langen Tag auf ihn und führten ihn mit Triumph durch die Straßen von Amsterdam unter dem lauten Jubel der Menge. Da fiel plötzlich ein großer Schnee, und weil die Schneider gut getrunken hatten, glitten sie hie und da aus; der Bock gewann dadurch die Freiheit, nahm sich zusammen und begann in Carriere nach der Judengasse zu rennen.
Viele der Schneider, die nicht loslassen wollten, wurden erbärmlich geschleift. Mein Vater aber, der ein Stück Tuchende an den Schwanz des Bocks gebunden hatte, woran er ihn führte, wollte wenigstens seinen Teil nicht losgeben. Schnell zog er seine Schere, und schon stürzte der Bock mit den Vorderfüßen durch das Tor der Judengasse, als er ihm glücklich den Schwanz noch abschnitt und diesen, wenn er gleich darüber tüchtig auf den Hintern fiel, wenigstens doch rettete.
Der lange Tag aber war verloren, der Bock riß ihn mit durch das Pförtchen des Judentors; abstreifen konnte er ihn nicht, denn die Schneider hatten ihn an den Bock festgemacht.
Da es aber trotz seines Verlustes hell blieb und die Finsternis sich ganz verloren hatte, wollten sie es nicht noch einmal wagen, ihn zu erobern, und zogen, von den undankbaren Amsterdamern verspottet und verlacht, nach ihrer Herberge zurück. Um hier nicht den Anschein zu haben, als hätte sie der kleine Unfall gebeugt, veranlaßten sie eine Gasterei und eine Schlittenfahrt, an deren Folgen die meisten der edlen Helden zu Grunde gingen. Dieses ganze Fest habe ich in Reime gebracht und will es euch singen, liebe Mitbürger:
Als nun die Schneider zur Herberg kamen,
Da konnten sie nicht hinein;
Da krochen ihr neunzig,
Neunmal neunundneunzig
Zum Schlüsselloch hinein.
Und da sie nun versammelt waren,
Da hielten sie einen Rat,
Da saßen ihrer neunzig,
Neunmal neunundneunzig
Auf einem Kartenblatt.
Und weil sie alle hungrig waren,
Da hielten sie einen Schmaus,
Da fraßen ihrer neunzig,
Neunmal neunundneunzig
An einer gebratenen Maus.
Und weil sie alle durstig waren,
So faßten sie einen Mut
Und soffen alle neunzig,
Neunmal neunundneunzig
Aus einem Fingerhut.
Und weil der Schnee gefallen war,
So hielten sie Schlittenfahrt,
Und fuhren ihrer neunzig,
Neunmal neunundneunzig
Auf einem Geißenbart.
Und als sie wieder zur Herberg kamen,
So hielten sie einen Tanz,
Da tanzten ihrer neunzig,
Neunmal neunundneunzig
Auf einem Geißenschwanz.
Und als sie all besoffen waren,
So sahen sie nichts mehr
Und krochen ihrer neunzig
Neunmal neunundneunzig
In eine Lichtputzscheer.
Und als sie ausgeschlafen hatten,
Da konnten sie nicht heraus,
Da warf sie alle neunzig,
Neunmal neunundneunzig
Der Wirt zum Fenster hinaus.
Und als sie vor das Fenster kamen,
Da fielen sie um und um,
Da kamen ihrer neunzig,
Neunmal neunundneunzig
In einer Gosse um.
So war das unglückliche Ende dieser neunmal neunundneunzig Braven; sie, die nicht der grausame Sündenbock der alttestamentarischen Glaubensgenossen hatte besiegen können, unterlagen den Sünden des jugendlichen Übermuts, die schon manchem Helden den Helmbusch geknickt haben; sie, die den langen Tag der Juden bezwungen hatten, wurden von einem kurzen Freudentage erdrückt und erblickten das Licht nicht wieder, welches ihnen mit der Lichtputze ausgelöscht worden.
Mein Vater allein, weil er zuerst in die Lichtputze gekrochen war, fiel lebend auf die andern und machte sich nach Haus. Es war morgens gegen drei Uhr, und der Tag begann zu dämmern; er schlich nach seiner Werkstatt. Aber hier hatte er noch einen schweren Kampf zu bestehen. Er hatte für einen durchreisenden König von Polen ein Kleid zu verändern, und da es morgen fertig sein sollte und der heutige Tag im Kriegsgetümmel verloren gegangen war, so machte er sich selbst daran, es aufzutrennen. Denn seine Gesellen waren alle unter den Helden umgekommen.
Da er nun im besten Trennen war, kam ihm plötzlich aus einer Naht des Rockes ein schreckliches Ungeheuer entgegen, eine Laus; und sie protestierte dagegen, daß er den Rock auftrennte. Der Schneider, dem aus Schrecken die Schere unter den Tisch gefallen war, erholte sich bald wieder und sagte zu ihr: »Ich muß Sie bitten, meine Stube zu verlassen und nicht viel Aufhebens zu machen, sonst werde ich grob.« -
»Elender Ziegenschwanz!« sagte die Laus hohnlächelnd, »wäre ich nicht von königlichem Geblüt, ich wollte dir für deine Insolenz Nasenstüber geben.« Das Wort Ziegenschwanz, als eine Stichelei auf das unglückliche Bocksgeschlecht der Schneider, nahm mein Vater krumm und erwischte die Elle und schlug nach der Laus, die er aber verfehlte, worauf sie höchlich ergrimmt zu ihm sprach: »Notwehr hebt allen Stand und Rang auf, und ich lasse mein königliches Geblüt herab und fordere dich auf Tod und Leben heraus«, worauf sie meinen Vater auf die grimmigste Weise anfiel.
Er wehrte sich wie ein Held; aber ermattet vom Kampf ward sie Meister über ihn und warf ihn unter die Bank; doch diente ihm dies zum großen Glücke, indem er unten seine Schere wiederfand und sie so vortrefflich gegen das Ungeheuer gebrauchte, daß er ihr den Kopf damit abschnitt. Aber ermattet lag er nun unter der Bank und hatte die Kräfte nicht, sich wieder herauszuwinden, bis ihn glücklicherweise ein Floh zur Ader ließ, was ihm so wohl anschlug, daß er sich erholte und unter der Bank hervorkroch.
Nun weckte er seine Frau und mich und erzählte ihnen seine Heldentat. Diese, als ein kluges Weib, sagte: »Da die Laus von königlichem Geblüt ist, so dürfen wir die schöne Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, und somit will ich sie uns zum Frühstück zubereiten, und wenn wir sie verzehren, sind wir dann alle auch von königlichem Geblüt.« Meinen Vater und mir, der immer viel Ehrgefühl hatte, war dieser Gedanke sehr willkommen. Schnell ward das Ungeheuer an einer Nadel gebraten und auf einer Knopfform aufgetragen, und bald war sie verzehrt, und so waren wir von königlichem Geblüt. Ich aber machte folgendes Gedicht:
Der Schneider trennt des Königs Rock.
Da findet er die Laus;
Sie macht sich patzig, nennt ihn Bock
Und fordert ihn heraus.
Dem Schneider fiel vor Schreck die Scheer,
Er faßt sich einen Mut,
Er greift nach seiner Elle schwer,
Setzt auf den Fingerhut.
Sie sprach: »Ich bin von Königsblut,
Du bist ein Ziegenschwanz!«
Und packt ihn an mit grimmiger Wut;
Das ward ein böser Tanz.
Die Laus gewann die Oberhand,
Sie stellt dem Schneider ein Bein
Und drückt den Schneider an die Wand,
Wirft ihn zur Höll hinein.
Da wars für ihn ein großes Glück,
Daß er die Scheer ertappt,
Da hat der Held ihr am Genick
Den Kopf schnell abgeknappt.
Doch lag er da ermüdet sehr,
Vom Kampf ganz matt und blaß,
Zum Glück hüpft da der Floh daher,
Hilft ihm mit Aderlaß.
Er weckt den Sohn, er weckt das Weib,
Erzählt die Heldentat;
Sie sprach: »Ich schnell des Toten Leib
An einer Nadel brat.«
Dem Schneider, samt dem Weib und Kind,
Bekam das Frühstück gut;
Sie schwuren nun: »Wir dreie sind
Von königlichem Blut.«
Kaum hatte sich nun der Tag über den Türmen von Amsterdam wieder sehen lassen, als man eine neue, viel schrecklichere Not als gestern bemerkte. Alle Kanäle und Zisternen waren ausgetrocknet, kein Tropfen Wasser war in der Stadt, Tee und Kaffee konnte nicht gekocht werden, und es wußten sich die Mägde, die sonst immer die Häuser von oben bis unten mit Wasser abzuwaschen pflegten, nicht zu helfen und zu raten.
Alle Schiffe, die auf den Kanälen nach Amsterdam zu kommen pflegen, saßen auf dem Grund; die Reisenden stiegen aus und kamen zu Fuß herein in die Stadt und vermehrten mit ihren Erzählungen den Jammer. Niemand wußte den Grund, wenngleich alle Leute auf den Grund der ausgetrockneten Quellen sehen konnten. Nur war diesmal bei den Juden keine Rettung zu holen. Sie waren selbst übel daran und konnten sich nach ihrer Gewohnheit nicht baden und waschen, was sie doch so sehr bedurften, weil sie sich gestern in der Schlacht mannigfach besudelt hatten.
Als nun die Brunnenmeister überall herumliefen, und nach Wasser bohrten und immer auf dem Trockenen blieben, kam endlich ein wandernder Schneidergesell auf die Herberge, ganz blaß und erschrocken; er zitterte wie ein Espenlaub, und da die andern Gesellen ihn zu ermuntern suchten und ihm ihre gestrigen Heldentaten erzählten, sagte er:
»Ihr habt gut schwätzen; aber ich habe etwas erlebt, worüber alle andern Schneider der Welt vor Schrecken gestorben wären; ich habe zwei Meilen von der Stadt gestern einen Kerl stehen sehen, höher wie der höchste Berg; er warf einen Schatten über das Land, pechschwarz. Nun hatte ich mich niedergelegt in einem Schotenfeld, um nicht von ihm bemerkt zu werden; aber wer konnte da ruhen? Eine gewaltige Erschütterung der Erde jagte mich auf; ich sah den Riesen niedergekniet und an der Amstel trinken; er machte dabei ein Geschlürfe, als wenn er die Welt verschlingen wollte, und stellt euch vor, ein ganzes Marktschiff mit Mann und Maus, voll Bauern und Weibern und tabakrauchenden Soldaten schluckte er mit hinunter und verzog keine Miene dazu.
Da überfiel mich aber auch ein solcher Schauder, daß ich mich abermals in eine Schote verkroch. Nach einer Weile guckte ich wieder hervor und sah, daß er sich niedergelegt hatte und daß sein Kopf gar nicht weit von mir entfernt lag. Aus Angst ließ ich meinen Bündel und mein Bügeleisen liegen, um desto schneller davonzulaufen. Als ich aber an seinem Nasenloch vorüberzog und er gerade den Atem ausstieß, ergriff mich der Sturm und wehte mich bis vor die Tore der Stadt. Nun, meine Freunde!« sagte er: »Gott behüte jeden Menschen vor solchem Schreck«; und nach diesen Worten redete er keine Silbe mehr; er sank von der Bank und war maustot.
Die Schneider waren höchlich über diese Nachricht erschreckt und liefen auf das Rathaus und erzählten sie den Generalstaaten. Die merkten dann gleich, wieviel Uhr es geschlagen hatte; sie sahen leicht ein, daß die gestrige Dunkelheit nichts als der Schatten des unvernünftigen Riesen gewesen sei, der über Amsterdam hinfiel und daß der Wassermangel durch nichts veranlaßt worden wäre als durch das Trinken des großen Schlingels an der Amstel.
»Es ist keine Zeit zu verlieren«, schrie da der Gescheiteste von allen Generalstaaten; »jetzt, da der Riese sich niedergelegt hat, ist er gewiß am ehesten zu bezwingen; man rüste sich und ziehe ihm entgegen und suche ihn durch die Menge zu besiegen. Die edlen Schneider, die gestern sich schon mit Ruhm bedeckt haben, werden die Republik Holland heute auch nicht im Stiche lassen.« Da sagten mehrere Schneider:
»Ja, wir wollen gewiß das Unsrige tun, wenn wir nur einen Anführer von königlichem Geblüte hätten.« Kaum hatten sie dies gesagt, als die Amsterdamerzeitung hereinkam; das ist aber nichts anders als ein altes Häringsweib mit einer Violine, die die neuesten Neuigkeiten in Reimen absingt und dazu geigt. Sie sang nicht nur die Schrecknisse des gestrigen Tages ab, sondern auch die herrliche Standeserhebung meines Vaters, der von königlichem Geblüt geworden war. Erstaunt hörten die Generalstaaten zu; sogleich machten sie sich auf, meinen Vater zu besuchen; sie stellten ihm Wachen vor die Türe, und ließen, indem sie ihm den größten Respekt bezeigten, die Aufforderung an ihn ergehen, das Vaterland zu retten.
Mein Vater ließ sich das nicht zweimal sagen, um so mehr, da der Zeitpunkt günstig war; denn soeben hörte man den Riesen schnarchen, und alle Türme zitterten, so daß die Glocken von selbst zu läuten begannen. Eiligst begab er sich auf die Herberge, versammelte alle Schneider, die sich ihm im Leben und Tod zu folgen verschworen.
Nun ordnete er den Heerzug folgendermaßen: vor der ganzen Schar wurde der eroberte Ziegenschwanz an einer Elle als Ehrenfahne und Feldzeichen hergetragen; dann folgten die Schleuderer, Wachsknollen und Knopfformen in Schleudern von Tuchenden schwingend; dann folgten die leichten Truppen, mit Nähnadeln und Scheren bewaffnet; dann die schwere Garde, mit Stopfnadeln, Ellen und Bügeleisen und Fingerhüten gerüstet.
Mir selbst hatte mein Vater das Siegeszeichen, den Geißenschwanz, anvertraut zu tragen, weil ich auch von königlichem Geblüt war. Unser Schlachtgesang war die Hymne, die ich auf meines Vaters Heldentat gemacht; nicht darf ich vergessen, daß unter dem Geißenschwanz das blutige Hemd, worin sich mein Vater gegen die Laus geschlagen, als Fahne befestigt war mit der Inschrift: Laus deo soli atque sartori, Gloria victoria sartoria. So zogen wir unter den Glückwünschen der Amsterdamer aus der Stadt dem Riesen entgegen.
Als wir aber kaum eine kleine Meile über den Damm hingezogen waren, ließen wir rekognoszieren, und es ward gemeldet, daß ein entsetzliches Ungeheuer mit einem beinernen Haus auf dem Buckel quer über dem Damm liege. Als drei kühne Helden mit Nadeln nach ihm gestochen, habe es plötzlich ein paar ungeheure Hörner herausgestreckt, daß die drei Braven vor Schrecken niedergefallen; die andern seien sogleich zurück, um es zu melden.
Nun sendete mein Vater ein Hundert Freiwilliger voraus, um den Weg von dem Umgeheuer zu befreien, und zog ihnen dicht auf den Füßen nach. Als wir auf die Stelle kamen, war die Schnecke bereits quer über den Damm weggekrochen. Wir sahen sie unten im Grunde und ließen sie ruhig ihren Weg fortsetzen, weil man dem fliehenden Feind goldene Brücken bauen soll. Die drei Braven retteten wir; sie klebten auf dem Wege fest im zähen Schleim, mit welchem das Ungeheuer seinen Weg bezeichnet hatte. Da sie zurück in das Hospital gebracht waren, schlug man eine Brücke mit Ellen, die auf Bügeleisen ruhten, und kam glücklich über den Morast.
Nun hörte man den Riesen immer lauter schnarchen, und mein Vater hielt Kriegsrat, in dem beschlossen wurde, daß das ganze Heer sich die Ohren mit Baumwolle zustopfen solle, um den Mut nicht zu verlieren, und dann wollten sie dem schlummernden Riesen die Nasenlöcher und den Mund zunähen, daß er ersticken müßte. Aber der Himmel hatte es anders verfügt. Die treulosen Juden, um sich für ihre gestrige Niederlage zu rächen, hatten dem Riesen den verhaßten Sündenbock zum Sukkurs geschickt.
Plötzlich trat uns der Schelm am Wege meckernd entgegen, und ergrimmt, seinen Schwanz an unsrer Fahne zu sehen, stellte er sich in Positur. Das ganze Heer der Schneider ergriff die Flucht und eilte in eine tiefe Höhle, die sich ihnen glücklicherweise am Wege gegenüber darbot; mich aber nahm der Bock auf seine Hörner und schleuderte mich hoch durch die Luft, daß mir Hören und Sehen verging.
Ich fiel glücklicherweise in des Riesen Bart nieder und litt keinen Schaden; aber als ich drin zappelte, mich loszumachen, erwachte der Bursche, richtete sich auf, nahm sein Schwert, das wie ein Strom von blankem Stahl neben ihm im Grase lag, griff dann nach der Scheide, die auf der andern Seite lag, und stieß es hinein, wobei der Degen etwas knirschte. Da er dies bemerkte, sagte er:
»Was Kuckuck! da ist mir Dreck in die Scheide gekommen«, und zog den Degen wieder heraus. Aber Himmel! welch jämmerlichen Anblick hatte ich da! Die beiden Seiten des verfluchten Schwertes hingen voll Blut und zerquetschten Leichnamen: es war die Scheide jene unglückliche Höhle gewesen, in die das tapfere Heer der Schneider sich gerettet hatte, welches Blut nun aber, durch des Riesen Schwert jämmerlich vergossen, um Rache schrie.
»Hum,« sagte der Riese, »das ist eine kuriose Schmiere!« und da der Bock dastand, ließ er ihn den Säbel ablecken. Mir tat dieser Anblick so jämmerlich weh im Herzen, daß ich laut aufschrie: »O barmherziger Himmel! welch gräßliches Schauspiel!« Der Riese bemerkte mich und sagte: »Ei, du kurioses kleines Kerlchen! wie kommst du in meinen Bart?« Worauf ich niederkniete in sein Ohr und ihm alles erzählte, was gestern und heute in Amsterdam vorgefallen sei und wie er das unüberwindliche Heer der Schneider zerquetscht.
Als er mich vom langen Tag erzählen hörte, fing er heftig an zu weinen, und wäre ich nicht in seinem Ohr gesessen, so wäre ich verloren gewesen; denn die Tränen liefen ihm in zwei ungeheuren Wasserströmen aus den Augen nieder. »Ach,« sagte er, »so habe ich denn meinen lieben Bräutigam gefunden! Nun rate mir, mein teurer, einziger Freund! wie kriege ich ihn am schnellsten, und ohne noch ferner Menschenblut zu vergießen, was meinem zärtlich liebenden Herzen ungemein schwerfällt, aus den Händen der Juden?
Denn du mußt wissen, daß ich ein zärtlich liebendes Jungfräulein bin, welches seinen Bräutigam als Mann verkleidet sucht; ich bin die lange Nacht, und der berühmte Zauberer Rabbi Süß Openheimer Mayer Löb Rothschild Schnapper Pobert hat mir ihn durch seine Beschwörungen am Hochzeitsabend aus den Armen entführt, weil er aus den Sternen gelesen, daß aus der Ehe der langen Nacht und des langen Tages der Jüngste Tag sollte geboren werden.
Er senkte mich in einen tausendjährigen Schlaf, aus dem ich vor hundert Jahren erwacht bin, seit welchen ich nun nach meinem lieben Bräutigam suche. O wie traurig ich bin, daß ihn die Juden gefangen halten; sie haben mir aus meinem süßen Bräutigam gewiß auch einen Juden gemacht; überhaupt sind die Schelme meinem Geschlechte blutfeind: sie haben mir meine Brüder Goliath und Holofernes vernichtet und wollen auch mich ruinieren.«
Nun antwortete ich der Jungfrau folgendermaßen: »Verehrte Demoiselle! mein Rat wäre dieser, daß Ihr den Sündenbock hier festhieltet und mich nach Amsterdam als einen Gesandten zurückließet, von den Juden den langen Tag dagegen zur Auswechslung zu fordern.« - Dieser Rat gefiel der Dame ungemein; sogleich nahm sie den Sündenbock und steckte ihn in den Busen und blies mich, mit vollkommener Vollmacht versehen, von ihrem Finger sanft auf einen Heuwagen in Amsterdam vor das Rathaus nieder.
Als mich das Volk erblickte, zerrissen sie mich fast um Neuigkeiten von der Armee; aber ich eilte zuerst zu den Generalstaaten, meine Gesandtschaft auszurichten. So groß die Trauer der Hochmögenden über den schrecklichen Untergang so vieler Helden, so groß war auch die allgemeine Wut gegen die Juden, welche durch ihr Gefangenhalten des langen Tages die zärtliche Riesenbraut ins Land gelockt und durch ihren Sündenbock die Schneider ins Verderben gestürzt hatten.
Nach langem Überlegen ergriffen die Generalstaaten folgenden Entschluß: Die Riesin muß aufs schleunigste befriedigt werden, damit sie sich aus dem Lande begiebt; die Juden sind daher durch die schnellsten Maßregeln zur Freilassung des langen Tages anzuhalten, welchen sie wohlgekleidet und geschmückt ausliefern sollen, wofür ihnen ihr Bock bis auf weitere Untersuchung zurückgegeben wird.
Der Riesin aber wird allein unter der Bedingung ihr Bräutigam zurückgegeben, daß sie als Jungfrau die vereinigten Niederlande verlasse und erst über der Grenze ihre Hochzeit feire, weil allerdings zu befürchten wäre, daß, sollte sie auf diesem meerentrissenen Lande, das auf Dämmen und Pfählen ruhe, ihren Brauttag halten, sie einige Provinzen als Löcher in den Grund des Meeres treten könnte. Mit diesen Vorschlägen ward ich zurückgesendet.
Ich stellte der Riesin, die noch immer auf der Erde lag, diese Wünsche der Generalstaaten vor, und sie, als eine sehr gutmütige Person, willigte ein und blies mich mit diesem Auftrage wieder in die Stadt. Nun hatte man während dem sich des langen Tages bemächtigt, ihn schön ausgeschmückt und ihn auf einem Floß, das auf sechzig Schiffen erbaut war, eingeschifft und so ins weite Meer gefahren. Der langen Nacht ward nun angezeigt, ihr Bräutigam sei bereits unterwegs und erwarte sie zwischen Dover und Calais. Schnell warf sie den Sündenbock nieder, der in die Stadt auf den Judenkirchhof zurückgaloppierte, und begab sich mit Riesenschritten hin, wo ihr Bräutigam eben ans Land stieg.
Ich hatte ihn auf der Flotte begleitet, um alles mit anzusehen; aber es bekam uns schlecht. Der Fleck Landes, wo der lange Tag die lange Nacht zum erstenmale wieder umarmte, war eine Landenge, welche Frankreich und England vereinigte. Soeben war das englische Einhorn und der französische Hahn dort in einem Streite begriffen; als die Riesenjungfrau aber zwischen sie trat, machten sie Waffenstillstand miteinander, um ihr Artigkeiten zu machen.
Der Hahn lief um sie herum, krähte, schlug mit den Flügeln und kokettierte; das englische Einhorn aber legte ihr sein Haupt in den Schoß. Als der Bräutigam ans Land stieg, war er über diesen Handel sehr erfreut, weil er wußte, daß das Einhorn die Gewonheit hat, sich nur vor tugendhaften Jungfrauen zu demütigen. Er umarmte nun seine Braut im Angesichte der holländischen Flotte, und beide luden den Hahn und das Einhorn zu Zeugen ihrer Verbindung ein. Die Braut nannte sich mit ihrem Taufnamen Continent, der Bräutigam aber Marinus.
Sie überhäuften sich mit Liebkosungen; nun gaben sie den beiden Zeugen folgende Geschenke: Continent sagte zu dem Hahn: »Du sollst mächtig sein auf Erden«, und Marinus sagte zu dem Einhorn: »Du sollst mächtig sein auf dem Wasser und den Inseln.« Hierüber wurden beide eifersüchtig und begannen wieder zu streiten. Aber die Brautleute hießen sie nach Hause gehen und begannen so heftig zu tanzen, daß die Landenge zu reißen begann.
Als aber auf der einen Seite der Halm eine Menuette krähte und das Einhorn auf der andern Seite einen englischen Tanz sang, kamen sie aus dem Takt und zerrten sich so herum, daß Marinus seiner Braut einen Ärmel ausriß; zu gleicher Zeit brach die Landenge entzwei, das Meer strömte zwischen England und Frankreich durch und trennte den Hahn und das Einhorn auf ewige Zeit.
Was aus den Brautleuten geworden ist, weiß ich nicht, da das Wasser, das durch das zerrissene Land durchströmte, unsere Flotte mit solcher Geschwindigkeit zurücktrieb, daß wir, ehe wir uns versahen, wieder in Amsterdam waren. Der neuentstandene Kanal wurde, weil er entstanden, als der Ärmel der Braut ausgerissen wurde, Canal de la Manche, Ärmelkanal, genannt, und der Ärmel, welchen die Flut des Meeres weit, weit hinweggeschwemmt, heißt seitdem Ermelland.
Als wir unsere Nachrichten den Generalstaaten hinterbrachten, dankte alles dem Himmel, daß die Hochzeit auf unserem Grund und Boden war vermieden worden, und dachte nun daran, wie man nun die Juden bei der ersten Gelegenheit für ihren mannigfach bewiesenen Starrsinn strafen sollte. Diese Gelegenheit ereignete sich bald.
Die Kirchhofmauer der Juden war, als sie sich alle hineingeflüchtet vor den Schneidern, beschädigt worden, und sie hatten sie einem Maurer wieder herzustellen verakkordiert. Als dieser eines Mittags von seinem Gerüste herunterstieg und, auf einem Grabsteine sitzend, seinen Käs und Häring als Mittagsbrot aß, kam der vorwitzige Sündenbock, dem wegen des vielen geleckten Schneiderbluts das Fell juckte, und scheuerte sich so stark an einem Pfahle des Gerüstes, daß es über ihm zusammenstürzte und ihn maustot schlug.
Die Juden, von dem Getöse herbeigelockt, begannen ein großes Geschrei und fingen den Maurer, schleppten ihn auf das Rathaus und wollten ihren Bock, den sie auf zweihundert Taler schätzten, von ihm bezahlt haben. Das Recht ward ihnen zugesprochen; der Maurer mußte die zweihundert Taler bezahlen. Weil er aber das Geld nicht hatte, fragten ihn die Generalstaaten: ob er ihnen alle seine Rechte abtreten wolle? »Von Herzen gern«, sagte der Maurer und begab sich weg.
Die Generalstaaten zahlten den Juden nun die zweihundert Taler, und sie gingen zufrieden nach ihrer Gasse zurück. Wie erstaunten sie aber, als nach einer Stunde der Scharfrichter von Amsterdam in ihre Gasse mit seinem Karren kam und den Bock im Namen der Generalstaaten mit Gewalt als ihr erkauftes Eigentum abholte. Sie waren in Verzweiflung, ihr geheiligtes Tier in so unehrlichen Händen zu sehen, und bezahlten nun den Generalstaaten eine ungeheure Summe, um ihn wiederzuerhalten und zu begraben.
Allein dies war noch nicht genug. Man hatte erfahren, daß sie dem langen Tag ein Stückchen abgeschnitten und es als ihren langen Tag zurückbehalten hatten. Dies mußten sei nun mit dem Magistrate teilen, welcher es in der Schneiderherberge aufhängen ließ zu einem ewigen Gedächtnisse, wie herrlich sich die Schneider um den Staat verdient gemacht. Auf Ansuchen der vielen zurückgelassenen traurigen Schneiderwitwen wurde es blau gefärbt und der blaue Montag, der Schneider ewiger Feier- und Spieltag, genannt.
Dieser Tag, als ein Ehrentag der Schneider, ward nun durch die ganze Welt ausgerufen und lockte eine große Menge von Gesellen nach Amsterdam, welche, die Witwen heiratend, Meister wurden und die große Schneiderlücke, welche der Bock gerissen hatte, bald wieder ausfüllten. Ich aber, der so früh schon so gewaltige Taten getan und der das adeliche Blut in allen seinen Adern fühlte, wollte nicht mehr in Amsterdam, welches mir nach meines Vaters Tod ein Ort der Trauer war, bleiben, und machte mich fort auf die Wanderschaft.
Nachdem ich viele Städte durchzogen, gefiel es mir hier in Mainz ziemlich wohl; doch wurde ich immer wegen meiner kleinen Figur geneckt, weil hier die Schneider viel größer waren; und überhaupt war die kleine Rasse meiner Handwerksbrüder in Amsterdam ziemlich ausgestorben. Erzählte ich nun meine Heldentaten, so lachte mich meine hiesige Meisterin aus. Das zog ich mir, der von königlichem Geblüt war, sehr zu Herzen und wünschte herzlich, daß meine Zeit um sein möchte, und daß ich weiterwandern könnte, die Erstaunung der Welt durch meine Heldentaten zu erregen.
Nun gab uns der Meister alle Tage, die der liebe Gott geschaffen, zweimal Kraut zu essen, welches mich sehr erbitterte.
Ich machte ihm daher Vorstellungen; aber er ließ mit seinem Kraut nicht nach, welches mich sehr melancholisch machte. Als ich nun eines Tages am Fenster saß und nähte, ging eine hübsche Jungfer vorbei. Sie trug einen Korb voll rotbackiger Äpfel, ich winkte ihr, und sie schenkte mir einen, und ich schenkte ihr dafür ein Nadelkissen in Gestalt eines Herzens, das ihr viel Vergnügen machte.
Der Apfel stand nun neben mir, und ich sah ihn mit unbeschreiblicher Freude an; denn er erinnerte mich immer an das schöne Kind, das ihn mir gegeben hatte. Ich fühlte durch seinen Anblick mein königliches Geblüt von neuem erwachen, welches durch das ewige Krautessen ganz matt geworden war, und nahm mir nun vor, mich heftig gegen das Kraut zu empören. Als nun der Meister mittags wieder Kraut auftrug, sang ich ihm folgendes Lied vor:
Ich habe mein Vertrauen
Auf Fleisch und Wurst gebaut
Und soll schon wieder hauen
Ins Kraut, ins ewge Kraut.
Ach Kraut, vor dem mirs graut!
Soll zweimal 's Tags dich kauen
In meine zarte Haut.
Du, Meister, bist ein Krauter,
Der leicht das Kraut verdaut,
Mich überläuft ein Schauder,
Wenn mich das Kraut anschaut;
Ach! alle Tag zwei Kraut,
Macht jährlich zu verdauen
Siebenhundert dreißig Kraut.
Als ich dies laut sang, wurde der Meister zornig und schlug mit der Elle nach mir; aber ich schlüpfte unter den Fingerhut. Er suchte mich überall, und ich entwischte ihm immer. Bald war ich in einer Ritze, bald in einem Knopfloch, bald unter den Lappen, und er konnte mich nie erwischen, bis er sich endlich niedersetzte, aus Furcht, sein Kraut möchte kalt werden, und es zornig in sich hinein aß, worüber er gewaltige Leibschmerzen bekam und sich nun niederlegte, um sich den Leib mit einem warmen Bügeleisen plätten zu lassen.
Kaum war er zur Türe hinaus, als ich meinen Entschluß faßte, ihn zu verlassen. Ich sah meinen geliebten roten Apfel an, und bemerkte zu meinem großen Verdruß, daß sieben Fliegen darauf saßen! Schnell nahm ich eine Fliegenklappe und schlug sie glücklich auf einen Schlag tot. Nach diesem gewaltigen Sieg erwachte mein Heldengefühl in seinem ganzen Umfange, und ich entschloß mich, als ein Ritter auf Abenteuer auszugehen. Ich sang das Kriegslied, das ich auf meinen Vater gemacht, ohn Unterlaß, nachdem ich mir auf einen roten Lappen mit schwarzer Seide die Worte nähte »Sieben auf einen Schlag«. Dann packte ich meinen Bündel zusammen und schrieb mit Kreide dem fatalen Krauter an die Tür:
Kraut und Rüben
Haben mich vertrieben,
Hättst du, Krauter! Fleisch gekocht,
So wär ich länger blieben.
Und nun nahm ich meinen Apfel und ging zum Haus hinaus in die Fremde auf Paris los.
Als ich einstens abends in einen Wald kam und nicht wußte, wo ich mich hin verkriechen sollte, damit nicht etwa ein wildes Eichhorn mich fressen möchte, sah ich plötzlich einige Schritte von mir im Grase etwas glänzen. Ich nahte mich, und sieh da! es war ein ganzer schöner Harnisch. Ich ging erstens in einiger Entfernung rund um ihn herum, dann warf ich mit kleinen Steinen nach ihm, und als sie in ihn hineinrasselten, bemerkte ich, daß er hohl sei und leer.
Nun war ich vergnügt; denn wenn ich in den Harnisch hineinstieg, hatte ich ja das schönste stählerne Haus auf diese Nacht, und das tat ich auch die alle Umstände. Ich stieg durch das Visier hinein, das ich hinter mir zuschloß, spazierte vom Kopf bis zu den Füßen darin herum und fand ihn überall schön ausgepolstert und legte mich ruhig drin zu Bette, nachdem ich erst meinen Lappen mit den Worten »Sieben auf einen Schlag« zu dem Visier herausgehängt hatte.
Kaum hatte ichs mir aber ein wenig bequem gemacht, so sah ich einen Mann im Hemde ankommen. Er sagte: »Das Bad war angenehm«, und griff mit der rechten Hand in das Visier des Helmes, um ihn aufzuheben; aber ich klappte es mit solcher Gewalt zu, daß ich ihm die Finger einklemmte, und als er schrie:
Wer, Kuckuck, ist in meinem Helm?
Schrie ich wieder:
Ich beiß die Hand dir ab, du Schelm;
Ich bin der Ritter Siebentot,
Freß sieben auf ein Abendbrot.
Er sprach:
Ach teurer, lieber Held!
Erbarmt Euch mein und laßt mich los,
Ich zahle Euch ein Lösegeld,
Soviel ihr wollt, wärs noch so groß.
Ich sprach:
Erst sagt mir, wer ihr seid,
Und ob es nach Paris noch weit?
Er sprach:
Ich bin der Prinz Burgund,
Der hier auf Wache stund,
In einem Schloß, nicht weit von hier,
Ist jetzt des Königs Hofquartier;
Das englisch Einhorn tobt im Land,
Drum hat der Hof sich hergewandt;
Ich mußte hier auf Wache stehn,
Und wollt ein wenig baden gehn;
Nun kam ich wieder in dem Hemd,
Da habt ihr mich so eingeklemmt.
Ich sprach:
Ihr haltet schlechte Wacht,
Nehmt Euren Posten schlecht in acht.
Doch tut mir einen Schwur und Eid,
So helf ich Euch aus Euerm Leid.
Geht, sagt dem König: im Walde ruht
Ein Held von königlichem Blut,
Er tötet meistens alle Tag
Wohl sieben Helden auf einen Schlag,
Er heißt der Ritter Siebentot;
Sein Wappen ist ein Apfel rot,
Er bietet seinen Feinden Trutz
Und nimmt den König in den Schutz;
Er will vom Renntier ihn befrein,
Wenn er ihm giebt sein Töchterlein;
Und daß die Jungfrau nicht erschrickt,
Wenn sie den großen Held erblickt,
Will er in zierlichster Gestalt
Sich geben ganz in ihre Gewalt;
Er will eine Puppe fein,
Ihr Freund und artig Spielwerk sein.
Kaum hatte der Prinz diese Worte gehört, als er hoch und teuer schwur, alles zu tun, was ich befehle, wenn ich ihm die Hand nicht abbeißen wollte. Ich sagte ihm: »Wohlan, mein teurer Prinz von Burgund, so ziehet Eure Hand zurück; ich will, weil Ihr Euch billig finden lasset, Euch auch nicht entehren, ich will gleich meine artige kleine Gestalt annehmen und vor Euch hintreten, wie ich die Rettung von Frankreich vornehmen will; ziehet Euern Harnisch wieder an, gehet an den Hof und saget: daß ich Euch besiegt, daß ich aber, weil Ihr Euch so brav gehalten, Euch freigelassen und zu meinem Abgesandten zum König gemacht, dem ich meine Hülfe durch Euch anbiete.«
Nun ließ ich seine Hand los und sprang mit gleichen Beinen aus dem Harnische heraus, wo er sich dann überaus über meine kleine artige Gestalt erfreute und mir sagte, daß ich ihn hier wieder erwarten sollte, worauf er sich an den Hof begab.
Ich saß nun im Gras und dankte Gott, daß er mir so herrliche Gesinnungen eingeflößt. Mit meinen Verheißungen wird es sich auch schon finden, dachte ich und sah nur immer meinen lieben roten Apfel recht an, welcher meinen Mut ungemein stärkte.
Sieh! da kam alsbald eine schöne Gesandtschaft von vornehmen Hofkavalieren, den Prinzen von Burgund an ihrer Spitze, zu mir her und luden mich von Seiten Ihrer Majestät sehr höflich ein, in das Schloß zu kommen. Sie hatten einen goldenen Sessel bei sich, ich sprang sogleich mit meinem Apfel darauf und ließ mich an den Hof tragen.
Noch am Abend ward ich dem König und der Prinzessin vorgestellt, die sich sehr über meine Gestalt wunderte und einmal über das anderemal sagte: »O le petit drôle, qu'il est joli! qu'il est petit-maître!« Das schmeichelte mir sehr, und der König versprach mir noch am Abend seine Tochter, wenn ich das Einhorn erlegen würde. »Ich kenne das Einhorn, Euer Majestät!« sprach ich, »ich habe es gesehen, als ich auf der Hochzeit der langen Nacht und des langen Tages war, welche zwischen Calais und Dover gefeiert wurde, wo jetzt der Kanal de la Manche ist. Saget mir doch, wodurch hat sich denn der Streit mit ihm entsponnen?« -
»Das ist ein sehr kritischer Fall,« sagte der König, »den alle Juristen nicht entscheiden könnten. Das Einhorn hatte einen schönen Garten auf seiner Seite, Bretagne genannt; als nun plötzlich die Erde zwischen den zwei Ländern brach und das Meer sich durchstürzte, riß das Meer jenen Garten hinweg und führte ihn herüber auf meine Seite, wo mein Hahn seine Wohnung hatte, und so ist das Einhorn morgens auf dieser Seite erwacht in seinem Garten. Da aber mein Hahn morgens in seinen Garten gehen wollte, fand er ihn nicht mehr. Das Land hatte sich verwandelt, der Garten des Einhorns lag auf seinem Garten.
Nun begann ein Streit, wer hier der Herr sei. Der Hahn sagte: 'Hier habe ich immer gewohnt, hier ist meine Grenze, hier ist mein Himmel.' Das Einhorn sagte: 'Dieser Garten ist mein, diese Bäume hab ich gepflanzt, diese Felder hab ich gesäet.' Der Hahn sagte: 'Trage deinen Garten hinweg!' Das Einhorn sagte: 'Ich habe ihn nicht hergetragen und brauche ihn auch nicht wegzutragen.' Nun entstanden Prozesse, die kein Ende nahmen, und endlich Krieg. Das Einhorn wütete durch das ganze Gallien und hat mich schon bis hieher vertrieben. Täglich erwarte ich die traurige Nachricht, daß es sich meinem Hoflager nähere und ich mich von neuem zurückziehen müsse.«
Kaum hatte der König diese Worte erzählt, als ein Kurier hereintrat und die Nachricht brachte, daß das Einhorn sich nahen müsse; denn schon nahe sich das ungeheure Wildschwein, welches immer vor ihm herlaufe und das Land verwüste. »Ach!« sprach der König, »wenn wir das abscheuliche Wildschwein nur los wären, mit ihm muß der Anfang gemacht werden, es ist der stärkste Bundesgenoß des Einhorns.« Worauf ich ihm erwiderte: »Ihro Majestät, ich habe mich zwar allein anheischig gemacht, das Einhorn für die Hand Eurer reizenden Tochter zu bezwingen; so aber Ihro Majestät mir versprechen, mir Prinzessin Lilie morgen abend zur Frau zu geben, so will ich morgen schon diesen Eber zu Ihren Füßen legen.«
Der König lächelte und sagte: »Mein teurer Ritter Siebentot! ohne einen Zweifel in Eure Tapferkeit zu setzen, kommt es mir doch immer sehr kurios vor, wenn Ihr von solchen Heldentaten sprecht. Doch sei Euer Begehren bewilligt: so Ihr das Schwein tötet, soll Euch die Prinzessin gegeben werden.«
Dies war unsere Unterredung am ersten Abend, worauf ich zu Bette ging und vortrefflich schlief. Am folgenden Morgen machte ich mich auf, um mein Heil mit dem Wildschweine zu versuchen. Kaum war ich eine Stunde weit in den Wald gegangen, als ich das Grunzen des Schweines hörte. Mich ergriff eine unbeschreibliche Angst, als es im Gebüsche hinter mir rasselte. Schnell lief ich in eine Kapelle, die im Walde stand, und machte die Türe zu; aber siehe da! das entsetzliche Schwein sprang zu mir durch das Fenster herein.
Als ich es ankommen sah, sprang ich zur Tür hinaus und hielt sie zu; da sprang das Schwein wieder zum Fenster heraus gegen mich, und ich sprang wieder zu der Türe hinein. Kaum fand das Schwein die Türe abermals verschlossen, als es wieder zum Fenster hineinsprang und ich wieder zur Türe hinaus, und so ging dies Raus und Rein und Rein und Raus über sechs Stunden lang, bis das Schwein, welches immer den schweren Sprung über das Fenster machen mußte, so müde ward, daß es in der Kapelle beinahe tot an die Erde fiel. Nun warf ich mit Steinen nach ihm, und als ich sah, daß es sich kaum mehr regen konnte, nähte ich ihm die Nasenlöcher und das Maul zu und schnitt ihm den Schwanz ab, worauf ich die Kapelle verschloß und mit meinem Schweineschwanz nach Hof zurückeilte.
Ich legte ihn dem Könige zu Füßen und begehrte Ketten und Jäger, um das Schwein abzuholen. Dies ward mir sogleich bewilligt. Ich zog mit allem versehen hinaus; wir fanden das Schwein bereits erstickt und schleiften es an einer Kette gebunden nach Hof vor den König. Der Prinz von Burgund ward bleich vor Verdruß, mich als Held zu sehen; denn er hätte die Prinzessin Lilie selbst gern geheiratet, auch die Prinzessin wollte nicht daran, ein so kleines Herrchen zu heiraten. Aber der König, der ein Mann von Wort war, ließ sich nichts einreden; ich wurde sogleich mit Lilie zusammen getraut und saß beim Abendschmaus zwischen ihr und dem König.
Da gab mir der Prinz von Burgund einen Trunk, der ein wenig stark war, und ich ward so berauscht, daß ich den andern Morgen auf meinem Hochzeitsbette erwachte. Die Prinzessin Lilie saß auf einem Lehnstuhl neben mir und sprach, als ich die Augen öffnete: »Gott sei Dank! Ihr lebt noch, mein Herr und Gemahl! Ich zitterte schon für Euch. Was habt Ihr denn nur gehabt? Die ganze Nacht sagtet ihr: 'Wichst mir das Garn', oder 'Manchester', oder 'Kamelhaar', und dabei fuhrt ihr mit den Händen aus wie ein Schneider, der näht!« - »Ei!« sagte ich, »geliebte Prinzessin! ich träumte, daß ich in Manchester in Großbritannien ein Kamel in einem Garn gefangen hätte.« Damit ließ sie sich zufriedenstellen, und wir begaben uns zum König.
Aber der war schon wieder in großer Not. Ein Kurier hatte ihm gemeldet, daß das Einhorn Paris eingenommen und auf die Nachricht von dem Tod des Schweines einen Riesen abgeschickt habe, den König tot oder lebendig zu fangen. Nun hetzte alles an mir, und die Prinzessin sagte, ich müsse den Riesen besiegen, oder sie hielte mich nach meinen Träumen für einen elenden Schneider. Alles lachte laut, als sie dies sagte, und ich mußte, da ich mich einmal in den Handel eingelassen hatte, meinen zweiten Heldengang tun. Ich zog an drei Stunden durch den Wald; da hörte ich einen gewaltigen Tritt, daß die Erde zitterte, und kletterte in meiner Herzensangst auf einen hohen Kirschbaum, welcher vor einem kleinen Försterhaus stand.
Aber wie erschrak ich, als der Riese an den Baum trat, an dem die Kirschen ganz bequem hingen; er aß bald hier, bald dort, und als er mich sah, sagte er: »Ei! du garstige Spinne auf den schönen Kirschen!« und nun gab er mir einen Schneller mit dem Finger, daß ich in den Rauchfang des Försterhauses flog und in einen großen Topf voll Buttermilch fiel, der auf dem Herde stand. Kaum war ich drin, als der Riese auch das Dach des Hauses abhob, nach der Milch griff und sie mitsamt dem Topf hinunterschluckte. Aber ich stemmte mich in seiner Kehle, daß er mich nicht herauf- und herunterbringen konnte, und fing an, ihm mit meiner Schere von innen den Hals aufzuschneiden, daß er wie ein Löwe brüllte und endlich tot niederfiel.
Da spazierte ich aus dem Loche heraus und lief eilends, blutig wie ich war, nach Hof; der König und meine Prinzessin waren nicht wenig erschrocken, mich so wiederzusehen; aber ich schrie Victoria! und legte ihnen den Schurrbart des Riesen, den ich mit vieler Mühe mitgeschleift hatte, zu Füßen. Nun zogen gleich Stallknechte mit zwanzig Pferden mit mir zurück, und wir schleiften den Riesen vor das Schloß.
Abermal hielt man da eine große Gasterei und trank meine Gesundheit mit Pauken und Trompeten, und ich ward abermals so sehr berauscht, daß ich, ohne zu wissen, wie ich hineingekommen war, morgens in der Brautkammer erwachte. Prinzessin Lilie saß wieder auf dem Lehnstuhl und begrüßte mich mit bittern Tränen.
»Mein teuerster Gemahl und Held Siebentot!« sagte sie, »wie war mir wieder angst um Euch. Ihr schriet wieder im Traume: 'Was Kraut und immer Kraut!' und dann sagtet ihr: 'Zwei Ellen Futterbarchent 1 fl. 30 kr., für Façon 3 fl. 45 kr., für Steifleinwand in den Kragen 1 fl. 12 kr., für Nähseide und Kamelhaare 3 fl. 26 kr.', und so immer fort eine ganze Schneiderrechnung; auch habe ich Eure Finger besehen und finde sie so gewaltig verstochen, daß ich in großer Angst bin, daß ihr ein Schneider seid.«
Ich sagte ihr, sie solle sich dergleichen aus dem Sinne schlagen, ein Traum sei ein Schaum. Aber sie weinte immer fort und wollte mir keinen Kuß geben, bis ich das englische Einhorn gefangen hätte. Verdrießlich über ihren Eigensinn stand ich auf und sagte ihr, daß ich ihr das Einhorn bringen wollte.
So marschierte ich wieder in den Wald, wo mir bald allerlei flüchtige Leute begegneten, die mir sagten, das Einhorn sei in vollem Anmarsch. Ich ließ mich nicht stören und vertraute auf gut Glück. Bald hörte ich es heranrasseln durch das Gebüsch. Ich aber trat mitten vor dasselbe hin, und wenn es mich mit seinem Horn spießen wollte, sprang ich immer hinter einen Baum, und so neckte ich es lange, bis es ganz toll und blind mit seinem Horn dermaßen in das Astloch einer Eiche rannte, daß es sich selbst fing und nicht rückwärts konnte. Nun war ich gleich bei der Hand und vernähte ihm dermaßen die Nasenlöcher und das Maul mit einer Kettennaht, daß es kaum Atem holen konnte, worauf es demütig ward wie ein Lamm und sich von mir an einer Halfter von Tuchenden ruhig in das Schloß führen ließ.
Als ich ankam, wollte der König eben mit Sack und Pack flüchten. Aber wie war die Verwunderung groß, mich mit dem Einhorn zu sehen. Es neigte sich vor dem Könige und seufzte; dann führte ich es zu der Prinzessin, daß es ihr das Haupt in den Schoß legen sollte. Aber es schüttelte den Kopf und wollte nicht. Nun ward es gefesselt und in einen Turm gesperrt. Der König konnte mir nicht genug danken, daß ich ihm seinen Feind gefangen; aber die Prinzessin war sehr verdrießlich, daß sich das Einhorn nicht vor ihr geneigt; und als der König sie bei Tisch fragte, warum sie trauere, sagte sie:
»Was helfen mich alle die Siege des Helden Siebentot? Ich werde ihn doch immer für einen Schneider halten, der mein Gemahl nicht sein kann, bis er öffentlich vor meinen Augen einen Kampf mit einem Geißbock besteht.« Dieser boshafte Vorschlag ärgerte mich tief in der Seele, und ich erwiderte ihr: »Und ich werde Euch so lange für keine tugendhafte Jungfrau halten, als Euch das Einhorn den Kopf nicht in den Schoß legt.«
Sie wurde rasend darüber und warf mir ihren Handschuh hin. Da er aber von Ziegenleder war, sprang ein Geißbock, welcher Schloßgärtner war, hervor und hob ihn auf »Wohlan,« sagte der König, »Ihr, der Sieger über das Wildschwein, den Riesen und das Einhorn, werdet bald mit dem Geißbock fertig sein; beginnt den Kampf auf Leben und Tod!« Aber du mein Gott! wie schlimm stand es mit mir! denn kaum hatte der König ausgeredet, als mich der Geißbock auch schon mit den Hörnern im Hosenbund ergriff, mich ein paarmal hin und her schwenkte und mich dann mit unbeschreiblicher Gewalt über die Bäume hinaus in den wilden Wald schleuderte.
Ich fiel ganz sanft auf einen Bund Heu nieder, an dem einige Esel fraßen, und da sie mit ihren Männern noch ziemlich weit von mir entfernt waren, hatte ich noch keine Sorge und überlegte mein trauriges Geschick. Der Undank des Königs und der Prinzessin kränkte mich tief; aber indem ich meinen roten Apfel ansah, dachte ich wieder: »Es geschah dir doch recht! Warum konntest du das schöne Mägdlein vergessen, das dir mit diesem Apfel allein deinen Mut eingeflößt?«
Nun sah ich mich um und bemerkte, daß ich unter einer Schar von Räubern war, die soeben überlegten, wie sie des Königs Schatzkammer bestehlen wollten. »Potz Bügeleisen!« dachte ich, »da kannst du dich für den Undank rächen!« und als mir nun die Esel mit ihren Mäulern zu nahe kamen, stach ich sie mit einer großen Stopfnadel tüchtig in die Nase, worüber sie laut schrieen und davon liefen.
Nun sprangen die Räuber auf und fingen sie ein und als sie wieder nachsahen, was die Esel von dem Heu verjagt hatte, sahen sie mich kleinen Helden auf dem Heu sitzen, der sie folgendermaßen anredete: »Meine Herren und Freunde! ich bin der Held Siebentot, ich habe dem König das Wildschwein, den Riesen und das Einhorn besiegt; er hat mich mit Undank belohnt, ich will mich an ihm rächen; ich habe gehört, daß ihr seine Schatzkammer berauben wollt, laßt mich euer Bruder und Gehülfe sein, ich weiß alle Schliche und Wege im Schloß. Stellt euch nur unter die Fenster der Schatzkammer in der Nacht, und wenn ihr gut fangen könnt, will ich euch Taler genug herauswerfen.« Die Diebe willigten ein.
Mit der Abenddämmerung stellten sie sich unter die Fenster der Schatzkammer: ich aber nahm ein grünes Krautblatt auf den Rücken und hüpfte wie ein Frosch zwischen den Wachen in das Schloß hinein. Die eine Schildwache wollte nach mir stechen, die andere aber sagte: »Laß den Grünhösler hüpfen, er zeigt uns gut Wetter auf morgen an.« So entkam ich glücklich dem Tod und schlich nun nach der Türe der Schatzkammer, wo ich wußte, daß alle Abend der Schatzmeister hineinging und Geld auf morgen holte. Er kam auch bald, und ich schlüpfte mit ihm hinein; da er wieder fort war, begann ich meinen Kameraden einen Taler nach dem anderen hinabzuwerfen und so arbeiteten wir die ganze Nacht.
Den folgenden Abend kam der Schatzmeister wieder und wunderte sich, daß der Haufe Taler so abgenommen. Doch ging er wieder fort, nachdem er alle Schlösser und Fenster noch wohl verwahrt gefunden. Nun warf ich wieder die ganze Nacht die Taler einzeln hinunter, und als der Schatzmeister sah, daß fast alles Geld verschwunden war, so begann er überall zu suchen. Nun versteckte ich mich unter einem Taler und rief ihm zu:
»Hier bin ich!« Wenn er aber hergelaufen kam, saß ich schon wieder unter einem andern Taler und schrie: »Hier bin ich!« So neckte ich den Schatzmeister so lange herum, bis ihm das Licht ausging. Da fing ich nun wieder an, Taler hinunterzuwerfen, und er suchte die Türe, um davonzulaufen. Als er aber mit dem König und mehreren Menschen wiederkam, saß ich eben auf dem letzten Taler und hüpfte mit den Worten: »Adieu, Herr Schwiegervater! ich habe mir meine Bezahlung geholt«, zum Fenster hinunter. Schnell eilte ich nun mit meinen Kameraden in den Wald, wo wir unsere Beute teilten, wobei ich aber nur einen Kreuzer kriegte, weil ich schon an meinem Apfel genug zu schleppen hatte.
Ich steckte den Kreuzer in den Apfel, und sie ernannten mich zu ihrem Hauptmann, und ich nannte mich Rinaldo Rinaldini und tat viele große Taten, von welchen ein ganzes Buch geschrieben ist. Was half mir alles? Als ich einstens auf einer Wiese spazierend mich in edlen Gedanken von meinen Kameraden entfernt hatte, wurde gerade Gras gemäht von einer dicken starken Bauernmagd. Ich sah nach ihren roten Strümpfen und dachte an die Jungfrau in Mainz, die auch rote Strümpfe angehabt. In solch schönen Jugenderinnerungen blieb ich wie versteinert stehen. Da faßte mich die Bauernmagd mitsamt dem Gras, in dem ich stand, und schnitt es mir unter den Füßen weg und steckte mich in ihre Schürze.
Die Überraschung, die Macht der Erinnerung und der betäubende Heudunst hatten mich berauscht. Ich entschlummerte, und sie warf mich ihrer Geiß vor, welche mich samt dem Heu gierig hinunterfraß; da ich erwachte, war ich in dem Bauche der Geiß, wo es mir gewaltig widerwärtig zu Mute war. Ich kniff die Geiß und quälte sie so, daß die Bäuerin, der sie gehörte, glaubte, die Geiß wolle toll werden, und sich entschloß, sie zu schlachten.
Als sie in den Stall kam und die Geiß schlachten wollte, schrie ich immer: »Hier bin ich! hier bin ich!« Aber sie hörte mich nicht, schlachtete die Geiß und hackte eine Wurst aus ihr. Unter dem Hacken war ich in Todesangst und schrie immer: »Ich bin hier! ich bin hier! hackt nicht zu tief!« Aber sie hörte mich während dem Geklapper der Hackmesser nicht und füllte mich in die Wurst und hing mich in den Rauch. Da kam aber eine Eule nach einiger Zeit und stahl die Wurst, und als sie daran fraß, bekam ich Luft und lief von neuem fort auf die Wanderschaft.
Vor allem lief ich auf die Wiese, wo ich meinen Apfel hatte liegen lassen, und fand ihn auch wieder gesund und rot, was mir ein gutes Zeichen schien für das Wohlsein meiner Liebsten. Da ich aber bereits mit meinem Apfel wieder in der Nähe von Mainz war, erwischte mich ein Fuchs und fraß mich mitsamt dem Apfel in einem Schluck hinunter.
Nun rief ich immer: »Herr Fuchs! ich bin hier!« Er fragte: »Wo?« Ich sagte: »In Eurem Bauch; o laßt mich frei!« - »Ja!« sagte er, »wenn du mich in einen guten Hühnerhof bringen willst.« - »Ja!« sagte ich; und nun sagte ich ihm den Weg nach meiner Liebsten Wohnung; er schlich sich nachts in ihren Hühnerstall; da sie aber gerade darin war, mit einer Mistgabel den Stall zu reinigen, stach sie ihn damit in den Hals, und als der Fuchs tot war, schrie ich immer:
Liebstes Röschen! ich bin hier, Ich bin hier!
Ich bringe dir den Apfel rot;
Ach, helfe mir aus meiner Not!
Da schnitt sie den Fuchs auf, und ich fiel ihr zu Füßen, und sie heiratete mich, und ich ward Meister hier in Mainz, und sie gebar mir ein Söhnlein, genannt Garnwichserchen.
Clemens Brentano
DIE TRAUMBUCHE ...
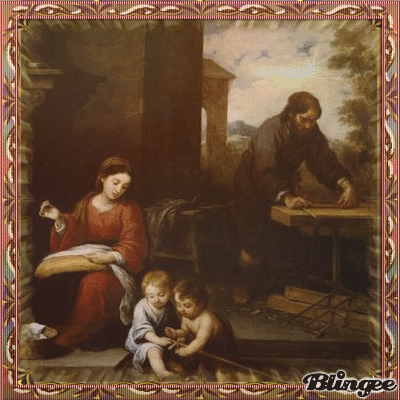
Hundert Jahre oder mehr ist's wohl her, daß der Blitz in sie einschlug und sie von oben bis unten auseinanderspellte, und eben so lange schon geht der Pflug über die Stätte; früher aber stand einige hundert Schritte vor dem ersten Hause des Dorfes auf dem grünen Rasenhügel eine alte mächtige Buche; so ein Baum, wie jetzt gar keine mehr wachsen, weil Tiere und Menschen, Pflanzen und Bäume immer kleiner und erbärmlicher werden.
Die Bauern sagten, sie stamme noch aus der Heidenzeit und ein heiliger Apostel sei unter ihr von den falschen Heiden erschlagen worden. Da hätten die Wurzeln des Baumes Apostelblut getrunken, und wie es ihm in den Stamm und in die Äste gefahren, sei er davon so groß und kräftig geworden. Wer weiß, ob's wahr ist? Eine eigene Bewandtnis aber hatte es mit dem Baum; das wußte jeder, klein und groß; im Dorf.
Wer unter ihm einschlief und träumte, des Traum ging unabweislich in Erfüllung. Deshalb hieß er schon seit undenklichen Zeiten die Traumbuche, und niemand nannte ihn anders. Eine besondere Bedingung war jedoch dabei: wer sich zum Schlaf legte unter die Traumbuche, durfte nicht daran denken, was er wohl träumen würde. Tat er es doch, so träumte er nichts wie Krimskrams und verworrenes Zeug, aus dem kein vernünftiger Mensch klug werden konnte.
Das war nun allerdings eine sehr schwere Bedingung, weil die meisten Menschen viel zu neugierig sind, und so mißlang es denn auch den allermeisten, die es versuchten; und zu der Zeit, wo die folgende Geschichte sich zutrug, war im Dorf wohl kein einziger, weder Mann noch Weib, dem's auch nur ein einziges Mal gelungen wäre. Aber seine Richtigkeit hatte es mit der Traumbuche, das war sicher. –
Eines heißen Sommertages also, da kein Lüftchen sich regte, kam auch einmal ein armer Handwerksbursche die Straße daher gewandert, dem war es in der Fremde viele Jahre hindurch weh und übel gegangen. Als er vor dem Dorfe anlangte, drehte er zum Überfluß noch einmal alle seine Taschen um, doch sie waren sämtlich leer. Was fängst du an? dachte er bei sich. Todmüde bist du; umsonst nimmt dich kein Wirt auf, und das Fechten ist ein beschwerliches Handwerk.
Da erblickte er die herrliche Buche mit dem grünen Rasenhügel davor; und da sie nur wenige Schritte abseits vom Wege stand, legte er sich unter sie ins Gras, um etwas auszuruhen. Doch der Baum hatte ein seltsames Rauschen, und wie er seine Zweige leise bewegte, ließ er bald hier, bald da einen feinen glitzernden Sonnenstrahl durchfallen und bald hier, bald da ein Stückchen blauen Himmel durchscheinen: da fielen ihm die Augen zu, und er schlief ein.
Als er eingeschlafen war, warf die Buche einen Zweig mit drei Blättern herab, der fiel ihm gerade auf die Brust. Da träumte er, er säße in einer gar heimlichen Stube am Tisch, und der Tisch wäre sein, und die Stube auch, und ebenso das Haus. Und vor dem Tisch stände eine junge Frau, stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch und sähe ihn gar freundlich an, und das wäre seine Frau.
Und auf seinen Knien säße ein Kind, dem fütterte er seinen Brei, und weil er zu heiß wäre, bliese er immer auf den Löffel. Und da sagte die Frau: "Was du doch für eine gute Kindermuhme bist, Schatz!" und lachte darüber. In der Stube aber spränge noch ein anderes Kind herum, ein dicker, pausbäckiger Junge, und er hätte an eine große Mohrrübe einen Bindfaden gebunden und zöge sie hinter sich her und riefe immer hü und hott, als wär's der beste Fuchs.
Und alle beide Kinder wären ebenfalls sein. So träumte er; und der Traum mußte ihm wohl sehr gefallen, denn er lachte im Schlaf übers ganze Gesicht. Als er aufwachte, war es schon fast Abend geworden, und vor ihm stand der Schäfer mit seinen Schafen und strickte. Da sprang er erquickt auf, dehnte und reckte sich und sagte: "Lieber Himmel, wem's so wüchse! Es ist aber doch hübsch, daß man nun wenigstens weiß, wie's ist."
Da trat der Schäfer an ihn heran und fragte ihn, woher er käme und wohin er wollte und ob er schon etwas von dem Baume gehört habe. Nachdem er sich überzeugt, daß er so unschuldig war wie ein neugeborenes Kind, rief er aus: "Ihr seid ein Glückspilz! Denn daß Ihr etwas Gutes geträumt habt, war ja doch auf Eurem Gesicht zu lesen; habe ich Euch doch schon lange betrachtet, wie Ihr so da lagt!"
Darauf erzählte er ihm, was es für eine Bewandtnis mit dem Baume habe: "Was Ihr geträumt habt, geht in Erfüllung; das ist so sicher als wie, daß das hier ein Schaf und das dort ein Bock ist. Fragt nur die Leute im Dorf, ob ich nicht recht habe! Nun sagt aber auch einmal, was Ihr geträumt habt!" "Alterchen", erwiderte der Handwerksbursche schmunzelnd, "so fragt man die Bauern aus. Meinen schönen Traum behalte ich für mich; das könnt Ihr mir nun schon gar nicht verdenken. Aber daraus werden tut doch nichts!"
Und das sagte er nicht bloß so, sondern es war sein Ernst; denn als er nun auf das Dorf zuging, sprach er vor sich hin: "Papperlapapp, Schäferschnack! Möchte wohl wissen, wo der Baum die Wissenschaft herhaben sollte." Als er in das Dorf kam, ragte am dritten Haus vom Giebel eine lange Stange heraus, an der hing eine goldene Krone, und unten vor der Haustüre stand der Kronenwirt. Der war gerade sehr guter Laune, denn er hatte schon zur Nacht gegessen und war rundherum satt, und das war sein beste Stunde. Da zog er höflich den Hut und fragte, ob er ihn nicht um einen Gotteslohn zur Nacht behalten wolle.
Der Kronenwirt besah sich den schmucken Burschen in seinen staubigen, abgerissenen Kleidern von oben bis unten. Dann nickte er freundlich und sagte: "Setz dich nur gleich hier in die Laube neben die Tür; es wird wohl noch ein Stück Brot und ein Krug Wein übrig geblieben sein. Unterdessen können sie dir eine Streu machen." Darauf ging er hinein und schickte seine Tochter, die brachte Brot und Wein, setzte sich zu ihm und ließ sich erzählen, wie es in der Fremde aussähe.
Dann erzählte sie ihm auch wieder alles, was sie wußte, aus dem Dorf: wie der Weizen stände, und daß des Nachbars Frau Zwillinge bekommen hätte, und wann das nächste Mal in der Krone zu Tanz gespielt würde. Auf einmal aber stand sie auf, bog sich zu dem Handwerksburschen über den Tisch hinüber und sagte: "Was hast du denn da für drei Blätter am Latz?"
Da sah der Handwerksbursche hin und fand den Zweig mit den drei Blättern, der während des Schlafes auf ihn herabgefallen war. Er stak ihm gerade im Latz. "Die müssen von der großen Buche dicht vorm Dorfe sein", erwiderte er, "unter der ich einen kleinen Nick gemacht habe." Da horchte das Mädchen neugierig auf und wartete, was er wohl weiter sagen würde.
Als er schwieg, begann sie ihn gar vorsichtig auszukundschaften, bis sie sicher war, daß er wirklich unter der Traumbuche geschlafen; und dann ging sie so lange wie die Katze um den heißen Brei, bis sie sich überzeugt zu haben glaubte, daß er nichts von der sonderbaren Kraft und Eigenschaft der Traumbuche wisse; denn er war ein Schalk und tat so, als wüßte er gar nichts.
Als sie auch damit fertig war, holte sie noch einen Krug Wein, sprach ihm freundlich zu, daß er noch trinken möge, und erzählte ihm alles Mögliche, was sie geträumt hätte und wie es doch gar schade wäre, daß nie etwas in Erfüllung ginge. Indem kam der Schäfer vom Felde zurück und trieb die Schafe durch die Dorfstraße. Als er an der Krone vorbeikam und das Mädchen mit dem Handwerksburschen in eifrigem Gespräch in der Laube sitzen sah, blieb er einen Augenblick stehen und sagte: "Ja, ja, Euch wird er schon den hübschen Traum erzählen; mir will er nichts sagen!" Darauf trieb er seine Schafe weiter.
Da ward das Mädchen noch neugieriger, und wie er immer noch nichts von seinem Traume sagte, konnte sie es nicht mehr verwinden und fragte ihn ganz offen, was er denn, während er unter der Buche geschlafen, geträumt habe. Da machte der Handwerksbursche, der ein arger Schalk und durch den schönen Traum übermütig fröhlich gestimmte war, ein schlaues Gesicht, zwinkerte mit den Augen und sagte: "Einen herrlichen Traum habe ich gehabt, das muß wahr sein; aber ich getraue mich nicht zu sagen, wie er war."
Aber sie drang immer weiter in ihn und quälte, er möchte es doch sagen. Da rückte er ganz nahe an sie heran und sagte ernsthaft: "Denkt nur, mir hat geträumt, ich würde noch einmal des Kronenwirts Töchterlein heiraten und später selbst Kronenwirt werden!" Da wurde das Mädchen erst kreideweiß und dann purpurrot und ging ins Haus. Nach einer Weile kam sie wieder und fragte, ob er das wirklich geträumt habe und es sein Ernst sei. "Gewiß, gewiß", sagte er, "gerade wie Ihr sah die aus, die mir im Traum erschienen ist!"
Da ging das Mädchen abermals ins Haus und kam nicht wieder. Sie ging in ihre Kammer, und die Gedanken liefen ihr übers Herz wie Wasser übers Wehr: immer neue und immer andere, und immer wieder die selben, so, daß es gar kein Ende hatte. "Er weiß nichts von dem Baume", sagte sie. "Er hat's geträumt. Ich mag wollen oder nicht, es wird schon so kommen. Es ist nichts daran zu ändern." Darauf legte sie sich zu Bett, und die ganze Nacht träumte sie von dem Handwerksburschen.
Als sie am anderen Morgen aufwachte, kannte sie sein Gesicht ganz auswendig, so oft hatte sie es über Nacht im Traum gesehen – und ein schmucker Bursche war's, das ist wahr. Der Handwerksbursche aber hatte auf seiner Streu wundervoll geschlafen; Traumbuche, Traum und was er am Abend zu der Wirtstochter gesagt, längst vergessen. Er stand in der Wirtsstube an der Tür und wollte eben dem Kronenwirt die Hand reichen zum Abschied. Da trat sie herein, und wie sie ihn reisefertig da stehen sah, überfiel sie eine sonderbare Angst, als dürfe sie ihn nicht fortlassen.
"Vater", sagte sie, "der Wein ist immer noch nicht gezapft, und der junge Bursch hat nichts zu tun; könnte er einen Tag hierbleiben, so möchte er sich seine Zeche verdienen und ein Stückchen Reisegeld obendrein." Und der Kronenwirt hatte nichts dagegen, denn er hatte schon seinen Morgentrunk gemacht und gefrühstückt und war so satt, so daß es seine beste Stunde war. Doch das Zapfen ging sehr langsam, und das Mädchen hatte immer dies oder jenes, weshalb der Handwerksbursche einmal aus dem Keller heraufgeholt werden mußte.
Als das Faß endlich leer und die Flaschen gefüllt waren, meinte sie, es wäre doch ganz gut, wenn er erst noch etwas im Feld hülfe; und als er damit auch fertig war, fand sich noch mancherlei im Garten zu tun, woran vorher niemand gedacht hatte. So verging Woche um Woche, und jedwede Nacht träumte sie von ihm. Am Abend aber saß sie mit ihm in der Laube vor dem Haus, und wenn er erzählte, wie es ihm weh und übel unter den fremden Leuten ergangen sei, kam ihr immer eine Schnake ins Auge oder ein Haar, so daß sie sich die Augen mit der Schürze reiben mußte.
Und nach einem Jahr war der Handwerksbursche immer noch im Hause; und alles war gescheuert, weißer Sand in allen Zimmern gestreut und darauf kleine grüne Tannenzweige, und das ganze Dorf hielt Feiertag. Denn der junge Handwerksbursch hielt Hochzeit mit dem Kronenwirtskind, und alle Leute freuten sich; und wer sich nicht freute, weil er ein Neidhammel war, der tat wenigstens so.
Bald darauf hatte der Kronenwirt auch wieder einmal seine beste Stunde, weil er nämlich rundherum satt war, und saß, die Tabaksdose auf dem Schoß, im Lehnstuhl und schlief. Als er gar nicht wieder erwachte, wollten sie ihn wecken; da war er tot – mausetot. Da war nun der junge Handwerksbursch wirklich Kronenwirt, wie er es im Scherze gesagt, und sonst traf alles ein, wie er es unter der Buche geträumt.
Denn sehr bald hatte er auch zwei Kinder, und wahrscheinlich nahm er auch einmal das eine von ihnen auf den Schoß und fütterte es und blies dabei auf den Löffel, und sicher fuhr gleichzeitig der andere Knabe mit der Mohrrübe im Zimmer umher, obwohl der, von dem ich diese Geschichte weiß, mir es nicht gesagt hat und ich es selbst vergessen habe, ihn express danach zu fragen.
Aber es wird schon so gewesen sein, weil das, was man unter der Traumbuche träumte, stets aufs Haar eintraf. Eines Tages nun, es mochten wohl an die vier Jahre seit der Hochzeit verflossen sein, saß der junge Kronenwirt – denn das war er ja jetzt – auch einmal in der Wirtsstube. Da kam seine Frau herein, stellte sich vor ihn hin und sagte: "Denke dir, gestern unter Mittag ist einer von unsern Mähern unter der Traumbuche eingeschlafen und hat nicht daran gedacht. Weißt du, was er geträumt hat?
Er hat geträumt, er wäre steinreich. Und wer ist's? Der alte Kaspar, der so dumm ist, daß er einen dauert, und den wir nur aus Mitleid behalten. Was der wohl mit dem vielen Gelde anfangen wird?" Da lachte der Mann und sagte: "Wie kannst du nur an das dumme Zeug glauben und bist sonst eine so kluge Frau? Überlege dir doch selbst, ob ein Baum, und wenn er noch so schön und alt ist, die Zukunft wissen kann."
Da sah die Frau ihren Mann mit großen Augen an, schüttelte den Kopf und sprach ernsthaft: "Mann, versündige dich nicht! Über solche Dinge soll man nicht scherzen." "Ich scherze nicht, Frau!" erwiderte der Mann. Darauf schwieg die Frau wieder eine Weile, als wenn sie ihn nicht recht verstünde, und sagte dann: "Wozu das nur alles ist! Ich dächte, du hättest alle Ursache, dem alten heiligen Baume dankbar zu sein. Ist nicht alles so eingetroffen, wie du es geträumt?"
Als sie dies gesagt, machte der Mann das freundlichste Gesicht der Welt und entgegnete: "Gott weiß es, daß ich dankbar bin, Gott und dir. Ja, ein schöner Traum war's! Ist mir's doch, als wenn es erst gestern gewesen wäre, so genau erinnere ich mich noch daran. Und doch ist alles noch tausendmal schöner geworden, als ich es geträumt; und du bist auch noch tausendmal lieber und hübscher als die junge Frau, die mir damals im Traume erschienen war."
Und die Frau sah ihn wieder mit großen Augen an; darauf fuhr er fort: "Was nun aber den Baum anbelangt und den Traum, Herzensschatz, so denke ich: wer gern tanzt, dem ist leicht gepfiffen; und: wie man in den Wald schreit, so schallt es wieder heraus. War es mir die vielen Jahre weh und übel gegangen, so war's wohl kein Wunder, wenn ich auch einmal von was Liebem träumte."
"Daß du aber gerade geträumt hast, du würdest mich heiraten!" "Das hab' ich nie geträumt! Bloß eine junge Frau sah ich mit zwei Kindern, und sie war lange nicht so hübsch wie du und die Kinder auch nicht." "Pfui", erwiderte die Frau. "Willst du mich verleugnen oder den Baum? Hast du mir nicht am ersten Tag, wo wir uns sahen – es war schon Abend und draußen in der Laube –, hast du mir da nicht gleich gesagt, du hättest geträumt, du würdest mich heiraten und Kronenwirt werden?"
Da fiel dem Manne zum ersten Male wieder der Scherz ein, den er sich damals mit seiner jetzigen Frau erlaubt hatte, und er sagte: "Es kann nichts helfen, liebe Frau! Ich habe wirklich damals nicht von dir geträumt; und wenn ich es gesagt, so war es nur ein Scherz. Du warst so neugierig; da wollte ich dich necken!" Da brach die Frau in heftiges Weinen aus und ging hinaus.
Nach einer Weile ging er ihr nach. Sie stand im Hof am Brunnen und weinte immer noch. Er versuchte sie zu trösten, doch vergeblich. "Du hast mir meine Liebe gestohlen und mich um mein Herz betrogen!" sagte sie. "Ich werde nie wieder froh werden!" Da fragte er sie, ob sie ihn denn nicht lieb hätte, so lieb wie keinen anderen Menschen auf der Welt, und ob sie nicht zufrieden und glücklich miteinander gelebt hätten wie niemand weiter im Dorf.
Sie mußte alles zugeben, aber sie blieb traurig wie zuvor, trotz allem Zureden. Da dachte er: Laß sie ausweinen! Über Nacht kommen andere Gedanken; morgen ist sie die alte. Doch er täuschte sich; denn am anderen Morgen weinte die Frau zwar nicht mehr, aber sie war ernst und traurig und ging ihrem Mann aus dem Wege. Jeder Versuch, sie zu trösten, scheiterte wie am Abend zuvor. Den größten Teil des Tages saß sie in einer Ecke und grübelte, und wenn ihr Mann hereintrat, schrak sie zusammen. Als dies mehrere Tage gedauert, ohne daß eine Änderung eintrat, befiel auch ihn eine große Traurigkeit; denn er fürchtete, er hätte die Liebe seiner Frau auf immer verloren.
Er ging still im Hause umher und sann auf Abhilfe, doch es wollte ihm nichts einfallen. Da ging er eines Mittags zum Dorfe hinaus und schlenderte durchs Feld. Es war ein heißer Julitag; keine Wolke am Himmel. Die reife Saat wogte wie ein goldner See, und die Vögel sangen; doch sein Herz war voller Bekümmernis. Da sah er von fern die alte Traumbuche stehen: wie eine Königin der Bäume ragte sie hoch in den Himmel hinein. Es kam ihm vor, als wenn sie ihm mit ihren grünen Zweigen zuwinkte und wie eine alte Freundin zu sich riefe.
Er ging hin und setzte sich unter sie und dachte an die vergangene Zeit. Fünf Jahre waren ziemlich genau verflossen, seit er als ein armer Teufel zum ersten Male unter ihr geruht und so schön geträumt hatte. Ach so wunderschön! Und der Traum hatte fünf Jahre gedauert. – Und nun? Alles vorbei! Alles vorbei? Auf immer? –
Da fing die Buche wieder zu rauschen an, wie vor fünf Jahren, und bewegte ihre mächtigen Zweige. Und wie sie die selben bewegte, ließ sie wie damals bald hier, bald dort einen feinen glitzernden Sonnenstrahl durchfallen und bald hier, bald da ein Stückchen blauen Himmel durchscheinen. Da wurde sein Herz stiller, und er schlief ein; denn er hatte vor Sorge die vorhergehenden Nächte nicht geschlafen.
Und nicht lange, so träumte er denselben Traum wie vor fünf Jahren, und die Frau am Tisch und die spielenden Kinder hatten die alten, lieben Gesichter von seiner Frau und von seinen Kindern. Und die Frau sah ihn so freundlich an – ach, so freundlich. Da wachte er auf, und als er sah, daß es nur ein Traum war, ward er noch trauriger. Er brach sich einen grünen Zweig ab von der Buche, ging nach Haus und legte ihn ins Gesangbuch.
Als die Frau am nächsten Tage – es war gerade Sonntag – in die Kirche gehen wollte, fiel der Zweig heraus. Da wurde der Mann, der daneben stand, rot, bückte sich und wollte ihn in die Tasche stecken. Doch die Frau sah es und fragte, was es für ein Blatt sei. "Es ist von der Traumbuche; sie meint es besser mit mir wie du!" erwiderte der Mann. "Denn als ich gestern draußen war und unter ihr saß, schlief ich ein. Da wollte sie mich wohl trösten; denn mir träumte, du wärst wieder gut und hättest alle vergessen. Aber es ist nicht wahr! Es ist nichts mit der alten guten Buche. Ein schöner herrlicher Baum ist sie schon, aber von der Zukunft weiß sie nichts."
Da starrte ihn die Frau an, und dann ging es wie ein Sonnenschein über ihr Gesicht: "Mann, hast du das wirklich geträumt?" "Ja!" entgegnete er fest, und sie merkte, daß es die Wahrheit war; denn er zuckte mit dem Gesicht, weil er nicht weinen wollte. "Und ich war wirklich deine Frau?" Als er auch dies bejahte, fiel ihm die Frau um den Hals und küßte ihn so oft, daß er sich ihrer gar nicht erwehren konnte.
"Gelobt sei Gott", sagte sie, "nun ist alles wieder gut! Ich habe dich ja so lieb –so lieb, wie du es gar nicht weißt! Und ich habe die Tage solche Angst gehabt, ob ich dich denn auch wirklich liebhaben dürfte, und ob mir nicht Gott eigentlich einen anderen Mann bestimmt hatte. Denn mein Herz gestohlen hast du mir doch, du böser Mann, und ein bißchen Betrug war doch dabei! – Ja, gestohlen hast du mir's; aber nun weiß ich doch, daß es dir nichts geholfen hat und daß es auch ohnedem so gekommen wäre."
Darauf schwieg sie eine Weile und fuhr dann fort: "Nicht wahr, du sprichst nie wieder schlecht von der Traumbuche?" "Nein, niemals; denn ich glaube an sie; vielleicht etwas anders wie du, aber darum doch nicht weniger fest. Verlaß dich darauf! Und den Zweig wollen wir vorn ins Gesangbuch heften, damit er nicht verloren geht."
Richard von Volkmann-Leander
DAS HARTE GELÜBDE ...
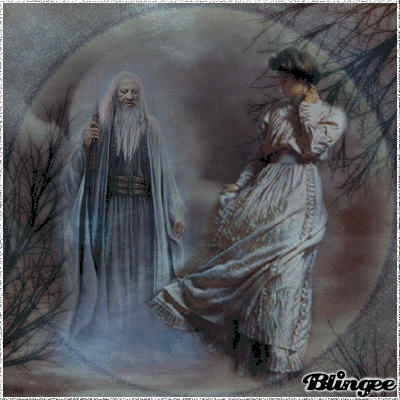
In einem wilden, wüsten Walde verirrte sich eine Frau. Als nun die dunkle Nacht hereinbrach, überkam die Frau eine große Angst, so dass sie seufzend sprach: "Weh! Wie komme ich zu Haus! Wenn doch wer käme und mir den Weg wiese aus dieser Wildnis!" Da trat aus dem Gesträuch ein graues Männchen.
"Wenn du mir versprichst, Frau, was du jetzt unter deinem Herzen trägst, so will ich dich hinausgeleiten, dass du bald zu Hause bist." Das versprach die Frau in ihrer Angst, und als sie es
versprochen hatte, lachte das Männchen mit Hohn laut auf und rief: "Der Knabe unter deinem Herzen ist mein! Nach zwölf Jahren bringst du ihn mir zu dieser selben Stunde, zu dieser selben Stelle,
oder ich fordere ihn selbst. Dann will ich ihm drei Fragen aufgeben; kann er die beantworten, so habe ich keine Macht über ihn; sonst gehört er mir für alle Ewigkeit."
Darauf brachte das graue Männchen die Frau bald aus dem Walde, dass sie wieder zu Hause kam.
Eine Zeit danach kriegte die Frau einen kleinen Jungen, der war ein stilles gutes Kind, wuchs heran und war so gelehrig, dass sich alle Leute darüber verwundern mußten. Seine Mutter aber hatte keine frohe Stunde mehr; immer und immer mußte sie daran denken, dass sie ihr liebes gutes Kind dem Bösen versprochen hatte. Wenn sie dann dem Knaben sein Brot schnitt, so sah sie ihn immer so traurig dabei an und konnte das Weinen nicht lassen.
Da faßte das Kind ihre Hand und sagte: "Mutter, warum seid Ihr nur so traurig und weint in einem fort? Gebt Ihr mir das Brot nicht gern, oder bin ich nicht gut und folgsam, dass Ihr immer weinen müßt, wenn Ihr mir das Brot gebt? Das sagt mir doch!" Aber sie weinte nur immer mehr und mochte es ihm nicht sagen, was ihr das Herz so schwer machte; bis der Knabe so lange bittend in sie drang, dass sie es doch endlich erzählte, wie sie sich in dem wilden Walde verirrt habe, wie das graue Männchen gekommen sei und dass sie ihm das Kind unter ihrem Herzen versprochen habe.
"Mutter", sagte da der Knabe, "das war hart! Doch laßt das Weinen und seid nur wieder froh; mit Gottes Hülfe mag noch endlich alles gut werden." Darauf ist der Knabe noch lerneifriger geworden als vorher, und in der Schule haben ihm seine Lehrer alle Fragen, die nur zu erdenken gewesen sind, aufgeben müssen, und als er nun sein zwölftes Jahr erreichte, da hat er alle und alle Fragen beantworten können.
Zu der bestimmten Stunde brachte die Frau den Knaben in den Wald, und gingen auch die Lehrer und viele Leute mit. Als sie nun bald zu der Stelle kamen, mußten sie alle zurückbleiben; da ging der Knabe allein freimütig in den Busch, und ob ihm gleich durch des Bösen Anstiften allerlei feurige Gespenster begegneten, auch ein Fuder Heu mit Ochsen bespannt auf ihn zukam, ihn zu schrecken, so ließ er sich doch nicht wirren, ging weiter und kam zur Stelle, wo das graue Männchen ihn erwartete.
"Es ist dein Glück, dass du gekommen bist!" sprach er; "nun gib mir Antwort auf drei Fragen; kannst du sie nicht lösen, so greif ich dich." "Sag her!" erwiderte mit ruhigem Mute das Kind. Da fragte das Männchen: "Was ist härter als ein Stein?" Das Kind antwortete: "Mutterherz." "Was ist weicher als ein Daunenbett?" Das Kind antwortete: "Mutterschoß." "Was ist süßer als Milch und Honig?" Das Kind antwortete: "Mutterbrust." Da ist das Männchen verschwunden und abgesunken.
Als nun das Kind unversehrt heraustrat, sahen die, welche zurückgeblieben waren, dass ihm der Arge nichts hatte anhaben können, und freuten sich, denn alle hatten das Kind lieb, weil es so klug war und so gut; da hat auch seine Mutter wieder frohe Tage erlebt.
Wilhelm Busch
DAS MÄRCHEN VON DER GRÜNEN SCHLANGE UND DER WEISSEN LILIE ...
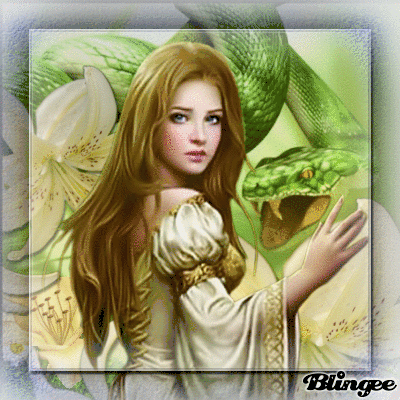
An dem großen Fluße, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, müde von den Anstrengungen des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen. Er hörte, dass Reisende übergesetzt sein wollten.
Als er vor die Tür hinaus trat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, dass sie große Eile hätten und schon an jenem Ufer zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr, mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit, quer über den Strom, indes die Fremden in einer unbekannten, sehr behänden Sprache gegeneinander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin- und wiederhüpften.
"Der Kahn schwankt!" rief der Alte, "und wenn Ihr so unruhig seid, kann er umschlagen. Setzt euch, Ihr Lichter!" Sie brachen über diese Zumutung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld, und stieß bald am jenseitigen Ufer an.
"Hier ist für Eure Mühe!" riefen die Reisenden, und es fielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den feuchten Kahn. "Um Himmels willen, was macht ihr?" rief der Alte. "Ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dies Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben, und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde! Nehmt euer Geld wieder zu euch!"
"Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt haben", versetzten jene.
"So macht ihr mir noch die Mühe", sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Mütze las, "dass ich sie zusammensuchen, ans Land tragen und vergraben muss."
Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der Alte rief: "Wo bleibt nun mein Lohn?"
"Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten!" riefen die Irrlichter. -
"Ihr müßt wissen, dass man sich nur mit den Früchten der Erde bezahlen kann." - "Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen sie, und haben sie nie genossen." - "Und doch kann ich euch nicht loslassen, bis ihr mir versprecht, dass ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln liefert."
Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen, allein sie fühlten sich auf eine unbegreifliche Weise an den Boden gefesselt; es war die unangenehmste Empfindung die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen seine Forderung nächstens zu befriedigen. Er entließ sie und stieß ab.
Er war schon weit hinweg, als sie ihm nach riefen: "Alter! hört Alter! Wir haben das Wichtigste vergessen!" Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluss hinab treiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurück.
In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlaf geweckt wurde. Sie sah die kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang, und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsritzen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte.
Kaum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, dass sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, dass diese Erscheinung möglich sei.
Weil sie aber zweifelhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicherzustellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Geld herein gestreut haben könnte. Sie fand niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hin kroch, und ihr anmutiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern.
Alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das herrlichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildnis; desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. "Find' ich doch endlich meinesgleichen!" rief sie aus und eilte nach der Gegend zu.
Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit durch Sumpf und Rohr zu kriechen; denn ob sie gleich auf trockenen Bergwiesen, in hohen Felsritzen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoss und mit zartem Tau und frischem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieben Goldes willen und in Hoffnung des herrlichen Lichtes alles unternommen, was man ihr auferlegte.
Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem feuchten Ried, wo unsere beiden Irrlichter hin- und widerspiegelten. Sie schoss auf sie los, begrüßte sie, und freute sich so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise.
"Frau Muhme", sagten sie, "wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt, denn sehen sie nur (hier machten beide Flammen indem sie ihre ganze Breite aufopferten, sich so lang und spitz als möglich) wie schön uns Herren von der vertikalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie es uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich des rühmen? So lang es Irrlichter gibt, hat noch keines weder gesessen noch gelegen."
Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich, denn sie mochte den Kopf so hoch heben als sie wollte, so fühlte die doch, dass sie ihn wieder zur Erde biegen musste, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunklen Hain außerordentlich wohl gefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, dass er endlich gar verlöschen werde.
In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor kurzem in die Felskluft gefallen sei. Sie vermute, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träufle. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die Schlange fuhr schnell danach sie zu verschlingen.
"Lasst es Euch schmecken, Frau Muhme", sagten die artigen Herren, "wir können noch mit mehr aufwarten." Sie schüttelten sich noch einige Male mit großer Behändigkeit, so dass die Schlange kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich fing ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs herrlichste, indes die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das mindeste zu verlieren.
"Ich bin euch auf ewig verbunden", sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war, "fordert von mir was ihr wollt. Was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten." "Recht schön!" riefen die Irrlichter, "sage, wo wohnt die schöne Lilie? Führ uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie, wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen."
"Diesen Dienst", versetzte die Schlange mit einem tiefen Seufzer, "kann ich euch sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leider jenseits des Wassers." - "Jenseits des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen! Wie grausam ist der Fluss, der uns nun scheidet! Sollte es nicht möglich sein, den Alten wieder herzurufen?"
Sie würden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange, denn wenn Sie ihn ach selbst an dem diesseitigen Ufer anträfen, so würde er Sie nicht einnehmen. Er darf jedermann herüber, niemand hinüber bringen. "Da haben wir uns schön gebettet! Gibt es denn kein anderes Mittel, über das Wasser zu kommen?" -
"Noch einige, nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde." - "Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen." - "So können Sie abends auf dem Schatten des Riesen hinüberfahren." - "Wie geht das zu?" -
"Der große Riese, der nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts. Seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein Reisblatt tragen. Aber sein Schatten vermag viel, ja alles. Deswegen ist er beim Aufgang und Untergang der Sonne am mächtigsten, und so darf man sich abends nur auf den Nacken seines Schattens setzen, der Riese geht als dann sachte gegen das Ufer zu und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber.
Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldecke einfinden, wo das Gebüsch dicht ans Ufer stößt, so kann ich Sie übersetzen und der schönen Lilie vorstellen. Scheuen Sie hingegen die Mittagshitze, so dürfen Sie nur gegen Abend in jener Felsenbucht den Riesen aufsuchen, der sich gewiss recht gefällig zeigen wird."
Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden von ihnen loszukommen, teils um sich in ihrem eignen Lichte zu erfreuen, teils eine Neugierde zu befriedigen, von der die schon lange auf eine sonderbare Weise gequält wird.
In den Felsklüften, in denen sie oft hin- und wiederkroch, hatte sie an einem Orte eine seltsame Entdeckung gemacht. Denn ob sie gleich durch diese Abgründe ohne ein Licht, zu kriechen genötigt war, so konnte sie doch durch Gefühl, die Gegenstände recht wohl unterscheiden. Nur unregelmäßige Naturprodukte war sie gewohnt überall zu finden.
Bald schlang sie sich zwischen den Zacken großer Kristalle hindurch, bald fühlte sie die Haken und Haare des gediegenen Silbers, und brachte ein und den anderen Edelstein mit ans Licht hervor. Doch hatte sie zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum verschlossenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche die bildende Hand des Menschen verrieten.
Glatte Wände, an denen sie nicht aufsteigen konnte, scharfe regelmäßige Kanten, wohlgebildete Säulen und, was ihr am sonderbarsten vorkam, menschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte, und die für Erz oder äußerst polierten Marmor halten musste. Alle diese Erfahrungen wünschte sie noch zuletzt durch den Sinn des Auges zusammenzufassen und das, was sie nur mutmaßte, zu bestätigen.
Sie glaubte sich nun fähig durch ihr eigenes Licht, dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten und hoffe auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig bekannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Weg bald die Ritze, durch sie in das Heiligtum zu schleichen pflegte.
Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Neugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildnis eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war.
Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt nach aber, das Bildnis eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebildeter Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben, und ein Eichenkranz hielt seine Haare zusammen.
Kaum hatte die Schlange dieses ehrwürdige Bildnis angeblickt, als der König zu reden anfing und fragte: "Wo kommst du her?" - "Aus den Klüften", versetzte die Schlange, "in denen das Gold wohnt." - "Was ist herrlicher als Gold?" fragte der König. - "Das Licht", antwortete die Schlange. - "Was ist erquicklicher als Licht?" fragte jener. - "Das Gespräch", antwortete diese.
Sie hatte unter diesen Reden beiseite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild gesehen. In der selben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt. Sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Edelsteinen geschmückt. Er hatte die Heiterkeit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der normalen Wand eine Ader, die dunkelfarbig hindurch lief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete.
Bei diesem Licht sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranz geschmückt war, und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entfernung vor ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Ader wie ein Blitz zuckte und verschwand.
Ein Mann von mittlere Größe, der heraustrat, zog die Aufmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleidet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hinein sah, und die auf eine wundersame Weise, ohne auch nur einen Schatten zu werfen, den ganzen Dom erhellte.
"Warum kommst du, da wir Licht haben?" fragte der goldene König. - "Ihr wisst, dass ich das Dunkle nicht erleuchten darf." - "Endigt sich mein Reich?" fragte der silberne König. - "Spät oder nie", versetzte der Alte.
Mit einer starken Stimme fing der ehernen König an zu fragen: "Wann werde ich aufstehen?" - "Bald", versetzte der Alte. - "Mit wem soll ich mich verbinden?" fragte der König. - "Mit deinen älteren Brüdern", sagte der Alte. - "Was wird aus dem jüngsten werden?" fragte der König. - "Er wird sich setzen", sagte der Alte. "Ich bin nicht müde", rief der vierte König mit einer rauen stotternden Stimme.
Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise herum geschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden.
Genau genommen war eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammen geschmolzen zu sein; goldne und silberne Adern liefen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch, und gaben dem ganzen ein unangenehmes Ansehen.
Indessen sagte der goldne König zum Manne: "Wie viel Geheimnis weißt du?" - "Drei", versetzte der Alte. - "Welches ist das wichtigste?" fragte der silberne König. - "Das offenbare", versetzte der Alte. - "Willst du es auch uns eröffnen?" fragte der eherne. - "Sobald ich das vierte weiß", sagte der Alte. - "Was kümmert es mich!" murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin.
"Ich weiß das vierte", sagte die Schlange, näherte sich dem Alten und zischte ihm etwas ins Ohr. - "Es ist an der Zeit!" rief der Alte mit gewaltiger Stimme. Der Tempel schallte wider, die metallenen Bildsäulen klangen, und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüfte der Felsen.
Alle Gänge, durch die der Alte hindurch wandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit Gold, denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, tote Tiere in Edelsteine zu verwandeln, und alle Metalle zu vernichten. Diese Wirkung zu äußern, musste sie aber ganz allein leuchten. Wenn ein anderes Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen Schein, und alles Lebendigkeit ward immer durch sie erquickt.
Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge angebaut war, und fand sein Weib in der größten Betrübnis. Sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. "Wie unglücklich bin ich", rief sie aus, "wollt' ich dich heute doch nicht fortlassen!" - "Was gibt es denn?" fragte der Alte ganz ruhig.
"Kaum bist du weg", sagte sie mit Schluchzen, "so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Türe. Unvorsichtig lasse ich sie herein, es schienen ein paar artige rechtliche Leute. Sie waren in leichte Flammen gekleidet, man hätte sie für Irrlichter halten können: kaum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine unverschämte Weise, mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, dass ich mich schäme daran zu denken."
"Nun", versetzte der Mann lächelnd, "die Herren haben wohl gescherzt. Denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben." "Was Alter!" rief die Frau. "Soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich denn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß doch was ich weiß. Und sieh dich nur um, wie die Wände aussehen. Sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe.
Alles Gold haben sie heruntergeleckt, du glaubst nicht mit welcher Behändigkeit, und sie versicherten immer, es schmecke viel besser als gemeines Gold. Als sie die Wände rein gefegt hatten, schienen sie sehr guten Mutes, und gewiss, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzender geworden. Nun fingen sie ihren Mutwillen von neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich und eine Menge Goldstücke sprangen herum.
Du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten. Aber welch ein Unglück! Unser Mops fraß einige davon und sieh, da liegt er am Kamine tot. Das arme Tier! Ich kann mich nicht zufrieden geben. Ich sah es erst, da sie fort waren, denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen." - "Was sind sie schuldig?" fragte der Alte. - "Drei Kohlhäupter", sagte die Frau, "drei Artischocken und drei Zwiebeln: wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluss zu tragen." "Du kannst ihnen den Gefallen tun", sagte der Alte. "Denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen." "Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und beteuert haben sie es."
Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt, der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke beiseite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein, in dem schönen Glanze, die Mauern überzogen sich mit Gold und der Mops war zu dem schönsten Onyx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.
"Nimm deinen Korb", sagte der Alte, und stelle den Onyx hinein. "Alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln, lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag lass dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lilie, bring ihr den Onyx, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tötet. Sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauern, ihre Erlösung sei nahe, das größte Unglück könne sie als das größte Glück betrachten, denn es sei an der Zeit."
Die Alte packte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf den weg. Die aufgehende Sonne schien hell über den Fluss herüber, der in der Ferne glänzte. Das Weib ging mit langsamem Schritt, denn der Korb drückte sie aufs Haupt, und es war doch nicht der Onyx, der so lastete. Alles Tote was sie trug fühlte sie nicht, vielmehr hob sich alsdann der Korb in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte.
Aber ein frisches Gemüs oder ein kleines lebendiges Tier zu tragen, war ihr äußerst beschwerlich. Verdrießlich war sie eine Zeitlang hingegangen, als sie auf einmal, erschreckt, stille stand. Denn sie hätte beinahe auf den Schatten des Riesen getreten, der sich über die Ebene bis zu ihr hin erstreckte. Und nun sah sie erst den gewaltigen Riesen, der sich im Fluss gebadet hatte, aus dem Wasser heraussteigen, und sie wusste nicht, wie sie ihm ausweichen sollte.
Sobald er sie gewahr war, fing er an sie scherzhaft zu begrüßen, und die Hände seines Schattens griffen sogleich in den Korb. Mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen sie ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten sie dem Riesen zum Munde, der sodann weiter den Fluss hinauf ging und dem Weibe den Weg frei ließ.
Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersetzen sollte, und ging unter diesen Zweifeln immer weiter vorwärts, so dass sie bald an dem Ufer des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herüberschiffen sah. Ein junger, edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne.
"Was bringt ihr?" rief der Alte. - "Es ist das Gemüse, das Euch die Irrlichter schuldig sind", versetzte die Frau und wies ihre Ware hin. Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, dass er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, dass sie jetzt nicht nach Hause gehen könne und dass ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei.
Er blieb bei seiner abschlägigen Antwort, indem er ihr versicherte, dass es nicht einmal von ihm abhänge. "Was mir gebührt, muss ich neun Stunden zusammen lassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluss ein Dritteil übergeben habe." Nach vielem Hinundwiderreden versetzte endlich der Alte: "Es ist noch ein Mittel. Wenn Ihr Euch gegen den Fluss verbürgt und Euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir, es ist aber einige Gefahr dabei." -
"Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich doch keine Gefahr?" - "Nicht die geringste. Steckt Eure Hand in den Fluss", fuhr der Alte fort, "und versprecht, dass Ihr in vierundzwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt."
Die Alte tat es, aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog. Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, dass ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären, und dass sie, ungeachtet der harten Arbeit, diese edlen Gemüter weiß und zierlich zu erhalten gewusst habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweiflungsvoll aus: "Das ist noch schlimmer! Ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere."
"Jetzt scheint es nur so", sagte der Alte. "Wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne dass ihr den Gebrauch derselben entbehrt. Ihr werdet alles damit verrichten können, nur dass sie niemand sehen wird." -
"Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man sähe es mir es nicht an", sagte die Alte. "Indessen hat das nichts zu bedeuten, ich werde mein Wort halten, um, diese schwarze Haut und diese Sorge bald los zu werden." Eilig nahm sie darauf den Korb, der sich von selbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen Manne nach, der sachte und in Gedanken am Ufer hin ging. Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich der Alten tief eingedruckt.
Seine Brust war mit einem glänzenden Harnisch bedeckt, durch den alle Teile seines schönen Leibes sich durch bewegten. Um seine Schultern hing ein Purpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken. Sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schön gebauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz schien alle äußeren Eindrücke abzustumpfen.
Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen, allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so dass sie endlich, ungeachtet seiner schönen Augen, müde war ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: "Ihr geht mir zu langsam, mein Herr, ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluss zu passieren und der schönen Lilie das vortreffliche Geschenk von meinem Manne zu überbringen."
Mit diesen Worten schritt sie eilends fort und ebenso schnell ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. "Ihr geht zur schönen Lilie!" rief er aus, "Da gehen wir einen Weg. Was ist das für ein Geschenk, das ihr tragt?"
"Mein Herr", versetzte die Frau dagegen, "es ist nicht billig, nachdem ihr meine Fragen so einsilbig abgelehnt habt, Euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und Eure Schicksale erzählen, so will ich Euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht." Sie wurden bald einig. Die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes, und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenk betrachten.
Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme. "Glückliches Tier!" rief er aus, "du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt dass Lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig! Ist es nicht viel betrübter und bänglicher durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde von ihrer Hand zu sterben!"
"Sieh mich an", sagte er zu der Alten. "In meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muss ich erdulden. Diesen Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jene als eine unnötige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg, ich bin im übrigen so nackt und bedürftig, als jeder andere Erdensohn, denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, dass sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen, und dass diejenigen, die ihre berührende Hand nicht tötet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen."
So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem inneren als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Vaters noch seines Königreiches. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichts und schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprechen.
Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem Ufer zum anderen hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das wunderbarste schimmern. Beide erstaunten, denn sie hatte dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. "Wie!" rief der Prinz, "war sie nicht schön genug, als sie vor unseren Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muss man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmutigsten Mannigfaltigkeit zusammengesetzt erscheint?"
Beide wussten nicht die Veränderung, die mit der Schlange vorgegangen war: denn die Schlange war es, die sich jeden Mittag über den Fluss hinüber bäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke dastand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrfurcht und gingen schweigend hinüber.
Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen anfing, in kurzem die Oberfläche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigentümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubnis auf ihrem Rücken über den Fluss zu setzen gedankt, als sie bemerkten, dass außer ihnen dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müssten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten.
Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete. Sie horchten auf und konnten endlich folgendes vernehmen: "Wir werden", sagten ein paar wechselnde Stimmen, "uns erst inkognito in dem Park der schönen Lilie umsehen, und ersuchen Euch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Seen werdet Ihr uns antreffen." "Es bleibt dabei", antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Luft.
Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wollten, denn so viele Personen auch um sie sein konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden sollten.
Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur Harfe sang. Die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberfläche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung.
Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigfaltiger Bäume, saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs neue die Augen, das Ohr und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigen Mädchen Gruß und Lob zu.
"Welch ein Glück Euch anzusehen, welch einen Himmel verbreitet Eure Gegenwart um Euch her! Wie die Harfe so reizend in Eurem Schoße lehnt, wie Eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach Eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung Eurer schlanken Finger so zärtlich klingt! Dreifach glücklicher Jüngling, der du ihren Platz einnehmen konntest!"
Unter diesen Worten war sie näher gekommen. Die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte: "Betrübe mich nicht durch ein unzeitiges Lob, ich empfinde nur desto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel tot, der sonst meine Lieder auf das angenehmste begleitete. Er war gewöhnt auf meiner Harfe zu sitzen, und sorgfältig abgerichtet mich nicht zu berühren.
Heute, indem ich vom Schlaf erquickt, ein ruhiges Morgenlied anstimme, und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören lässt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin. Das arme kleine Tier, erschrocken, flüchtet in meinen Busen und in dem Augenblick fühl' ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getroffen schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin, aber was kann mir seine Strafe helfen, mein Liebling ist tot, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren."
"Ermannt Euch, schöne Lilie!" rief die Frau, indem sie selbst eine Träne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gelockt hatte, "nehmt Euch zusammen, mein Alter lässt Euch sagen, Ihr sollt Eure Träne mäßigen, das größte Unglück als Vorbote des größten Glücks ansehen; denn es sei an der Zeit."
"Und wahrhaftig", fuhr die Alte fort, "es geht bunt in der Welt zu. Seht nur meine Hand wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig sie ist schon um vieles kleiner, ich muss eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum musste ich den Irrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen, warum musste ich dem Riesen begegnen und warum meine Hand in den Fluss tauchen? Könnt Ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel geben? So bring ich sie dem Flusse und meine Hand ist weiß wie vorher, so dass ich sie fast neben die Eurige halten könnte."
"Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden: aber Artischocken suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüten noch Früchte. Aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisken dieser Zypressen, die Kolosse von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt."
Die Alte hatte auf diese Rede wenig acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, dass sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setzte ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.
"Mein Mann", sagte sie, "schickt Euch dieses Andenken. Ihr wisst, dass Ihr diesen Edelstein durch Eure Berührung beleben könnt. Das artige treue Tier wird Euch gewiss viel Freude machen, und die Betrübnis, dass ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden, dass Ihr ihn besitzt."
Die schöne Lilie sah das artige Tier mit Vergnügen und, wie es schien, mit Verwunderung an. "Es kommen viele Zeichen zusammen", sagte sie, "die mir einige Hoffnung einflößen. Aber ach! Ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, dass wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden das Beste sei nah."
"Was helfen mir die vielen guten Zeichen?
Des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand?
Der Mops von Edelstein, hat er wohl seinesgleichen?
Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt?
Entfernt vom süßen menschlichen Genusse,
Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut.
Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse!
Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut!"
Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harfe begleitete und er jeden anderen entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Mut ein.
"Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt!" rief sie aus. "Fragt nur diese gute Frau wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Japsis, was nur eine Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig."
"Ich wünsche Euch Glück dazu", sagte die Lilie, "allein verzeiht mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube. Über den hohen Bogen Eurer Brücke können nur Fußgänger hinüber schreiten und es ist uns versprochen, dass Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber und hinüber wandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?"
Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach hier das Gespräch und empfahl sich. "Verweilt noch einen Augenblick", sagte die schöne Lilie, "und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit. Bittet die Lampe, dass sie ihn in einen schönen Topas verwandle, ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit Eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein. Aber eilt was ihr könnt, denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Fäulnis das arme Tier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig."
Die Alte legte den kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in den Korb und eilte davon.
"Wie dem auch sei", sagte die Schlange, indem sie das abgebrochene Gespräch fortsetzte, "der Tempel ist erbaut." "Er steht aber noch im Flusse", versetzte die Schöne. "Noch ruht er in
den Tiefen der Erde", sagte die Schlange. "Ich habe die Könige gesehen und gesprochen." "Aber wann werden sie aufstehen?" fragte Lilie.
Die Schlange versetzte: "Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen: es ist an der Zeit."
Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. "Höre doch", sagte sie, "die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Mal. Wann wird der Tag kommen, an dem ich sie
dreimal höre?"
Sie stand auf und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser folgte eine andre, die den elfenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange etwa ihrer bedürfe. Über allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen musste, dass sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.
Mit Gefälligkeit hatte indes die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn und in dem Augenblick sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wider und eilte zuletzt seine Wohltäterin auf das freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. "So kalt du bist", rief sie aus, "und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen. Zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln, und fest dich an mein Herz drücken."
Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm in dem Grase herum, dass man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und teil daran nehmen musste, so wie kurz vorher ihre Trauerndes Herz zum Mitleid gestimmt hatte.
Diese Heiterkeit, diese anmutigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen, nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemartert zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ.
"Es ist nicht freundlich", rief Lilie ihm entgegen, "dass du mir das verhasste Tier vor die Augen bringst, das Ungeheurer, das meinen kleinen Sänger heute getötet hat." "Schilt den unglücklichen Vogel nicht!" versetzte darauf der Jüngling. "Klage vielmehr dich an und das Schicksal, und vergönne mir, dass ich mit dem Gefährten meines Elends Geschäfte mache."
Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichen Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen. Dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen. Sie suchte ihn zu haschen, wenn er floh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte.
Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Verdrusse zu. Aber endlich, da sie das hässliche Tier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küsste, verging ihm alle Geduld und er rief voller Verzweiflung aus:
"Musste ich, der durch ein trauriges Geschick vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich alles, auch mich selbst, verloren habe, muss ich vor deinen Augen sehen, dass eine so widernatürliche Missgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung fesseln und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin- und wieder geben? und den traurigen Kreis den Fluss herüber und hinüber abmessen? Nein, es ruht noch ein Funke des alten Heldenmutes in meinem Busen. Er schlage in diesem Augenblick zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an deinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden. Wenn deine Berührung tötet, so will ich in deinen Händen sterben."
Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung. Der Habicht flog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los, sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten und berührte ihn nur desto früher. Das Bewusstsein verließ ihn, und mit Entsetzen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde. Das Unglück war geschehen!
Die süße Lilie stand unbeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam. Das Herz schien ihr im Busen zu stocken und ihre Augen waren ohne Tränen. Vergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen. Die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweiflung sah sich nach Hilfe nicht um, denn sie kannte keine Hilfe.
Dagegen regte die Schlange desto emsiger. Sie schien auf Rettung zu sinnen, und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf eine Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, fasste das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.
Nicht lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elfenbeinernen Feldstuhl, und nötigte, mit freundlichen Gebärden, die Schöne sich zu setzen. Bald darauf kam die zweite, die einen feuerfarbigen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte als bedeckte. Die dritte übergab ihr die Harfe, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt, und einige Töne aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurückkam, sich der Schönen gegenüber stellte, ihre Blicke auffing und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu finden war, darstellte.
Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ihre Anmut, und so sehr man hoffte ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, festzuhalten. Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte die bald schmelzende Töne aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam mit ihrem Jammer.
Einige Mal eröffnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, doch bald löste sich ihr Schmerz in Tränen auf, zwei Mädchen, fassten sie hilfreich in die Arme, die Harfe sank aus
ihrem Schoße, kaum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es beiseite.
"Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne untergeht?" zischte die Schlange leise, aber vernehmlich.
Die Mädchen sahen einander an, und Liliens Tränen vermehrten sich. In diesem Augenblicke kam atemlos die Frau mit dem Korbe zurück. "Ich bin verloren und verstümmelt!", rief sie aus. "Seht wie meine Hand beinahe ganz weg geschwunden ist. Weder der Fährmann noch der Riese wollten mich übersetzen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin. Vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu finden."
"Vergesst Eure Not", sagte die Schlange, "und sucht hier zu helfen. Vielleicht kann Euch zugleich mitgeholfen werden. Eilt was ihr könnt, die Irrlichter aufzusuchen. Es ist noch zu hell, sie zu sehen, aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluss, und sie können den Mann mit der Lampe finden und schicken."
Das Weib eilte so viel sie konnte, und die Schlange schien ebenso ungeduldig als Lilie die Rückkunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese. Die Schlange bewegte sich ungeduldig und Lilie zerfloss in Tränen.
In dieser Not sah die Schlange sich überall um, denn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulnis den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unaufhaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüften, mit purpurroten Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne auffing. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht. Denn kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schlittschuhen ginge.
Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu: "Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen?" "Der Geist meiner Lampe", versetzte der Alte, "treibt mich und der Habicht führt mich hierher. Sie spratzelt wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüften nach einem Zeichen um.
Irgendein Vogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Ob ich helfen kann weiß ich nicht, ein einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit vielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hoffen." "Halte deinen Kreis geschlossen", fuhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hinsetzte und den toten Körper beleuchtete.
"Bringt den artigen Kanarienvogel auch her und legt ihn in den Kreis!" Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchtem dem Manne.
Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsternis zunahm, fing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch
ein sanftes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröte ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmut färbte. Man sah sich wechselweise mit stiller Betrachtung an,
Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoffnung gemildert.
Nicht unangenehm erschien daher das alte Weib in Gesellschaft der beiden munteren Flammen, die zwar zeither sehr verschwendet haben mussten, denn sie waren weder äußerst mager geworden, aber sich nur desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen, besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete.
Bescheiden schlugen die Frauenzimmer ihre Augen nieder und das Lob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich. Jedermann war zufrieden und ruhig bis auf die Alte. Ungeachtet der Versicherung ihres Mannes, dass ihre Hand nicht weiter abnehmen könne solange sie von seiner Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als einmal, dass, wenn es so fortgehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde.
Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, dass Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen man wusste nicht wie. Der Alte sah nach den Sternen und fing darauf zu reden an: "Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen, jeder verrichte sein Amt, jeder tue seine Pflicht und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt."
Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle gegenwärtigen Personen sprachen für sich und drückten laut aus was sie zu tun hätten, nur die drei Mädchen waren stille. Eingeschlafen war die eine neben der Harfe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken, denn es war spät.
Die flammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden Höflichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zuletzt nur an Lilien, als die Allerschönste, gehalten.
"Fasse", sagte der Alte zum Habicht, "den Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchtete die Schläferinnen und weckte sie mit zurückgeworfenem Lichte aus der Höhe."
Die Schlange fing nunmehr an sich zu bewegen, löste den Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und der Mann ergriffen den Korb, dessen sanftes Licht man bisher kaum bemerkt hatte, sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender, sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust, der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten und sie folgte den Irrlichtern auf dem Fuße.
Die schöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten, der Mann mit der Lampe beschloss den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das sonderbarste erhellt. Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohltätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetzt schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichkeit.
Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunklen Himmel ab, aber unterwärts zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der von ferne aus seiner Hütte hervor sah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber zogen.
Kaum waren sie an dem anderen Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern anfing. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land, der
Korb setzte sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aufs neue ihren Kreis umher, der Alte neigte sich vor ihr und sprach: "Was hast du beschlossen?"
"Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde", versetzte die Schlange. "Versprich mir, dass du keinen Stein am Lande lassen willst."
Der Alte versprach es und sagte darauf zur schönen Lilie: "Rühre die Schlange mit der linken Hand an und deinen Geliebten mit der rechten." Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen, er bewegte sich im Korbe, ja er richtete sich in die Höhe und saß. Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat.
Der Jüngling stand, der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter, es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt. Der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er alles ohne Teilnehmung anzusehen, und kaum hatte sich die Verwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte.
Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen. Unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greifen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.
Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Korb zu fassen, wozu ihm seine Frau behilflich sein musste. Beide trugen darauf den Korb gegen das Ufer an einen erhabenen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, der gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluss. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder unter sanken.
"Meine Herren", sagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern, "nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang, aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligtums öffnen, durch die wir einmal eingehen müssen und die außer Ihnen niemand aufschließen kann." Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück.
Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm auftat. Der Jüngling folgte ihm, gleichsam mechanisch. Still und ungewiss hielt sich Lilie in einiger Entfernung hinter ihm. Die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten könne, nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spitzen ihrer Flammen zusammenneigten und miteinander zu sprechen schienen.
Sie waren nicht lange gegangen, als der Zug sich vor einem großen ehernen Tore befand, dessen Flügel mit einem goldenen Schloss verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Irrlichter herbei, die sich nicht lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spitzesten Flammen Schloss und Riegel aufzehrten.
Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligtum die würdigen Bilder der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern, besonders ließen es die Irrlichter an krausen Verbeugungen nicht fehlen.
Nach einiger Pause fragte der goldene König: "Woher kommt ihr?" - "Aus der Welt", antwortete der Alte. "Wohin geht ihr?" fragte der silberne König. - "In die Welt", sagte die Alte. - "Was wollt ihr bei uns?" fragte der eherne König. - "Euch begleiten", sagte der Alte.
Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der goldne zu den Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: "Hebt euch weg von mir, mein Gold ist nicht für euren Gaumen." Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an ihn, sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein.
"Ihr seid mir willkommen", sagte er, "aber ich kann euch nicht ernähren. Sättigt euch auswärts und bringt mir euer Licht." Sie entfernten sich und schlichen, bei dem ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den zusammengesetzten los. "Wer wird die Welt beherrschen?" rief dieser mit stotternder Stimme. - "Wer auf seinen Füßen steht", antwortete der Alte. - "Das bin ich!" sagte der gemischte König. - "Es wird sich offenbaren", sagte der Alte, "denn es ist an der Zeit."
Die schöne Lilie fiel dem Alten um den Hals und küsste ihn aufs herzlichste. "Heiliger Vater", sagte sie, "tausendmal danke ich dir, denn ich höre das ahnungsvollste Wort zum dritten Mal." Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt, denn der Boden fing unter ihnen an zu schwanken, die Alte und der Jüngling hielten sich auch aneinander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts.
Man konnte deutlich fühlen, dass der ganze Tempel sich bewegte, wie ein Schiff das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm
aufzutun als er hindurch zog. Er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg.
Wenige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Öffnung der Kuppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie fester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel.
Nicht lange darauf glaubten sie still zu stehen, doch sie betrogen sich: der Tempel stieg aufwärts.
Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balken, in ungestalter Verbindung, begannen sich zu der Öffnung der Kuppel krachend hereinzudrängen. Lilie und der Alte sprangen zur Seite, der Mann mit der Lampe fasste den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns, denn sie war es, die der Tempel, im Aufsteigen, vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte, sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.
Die Weiber schrien laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermutet ans Land stößt. Ängstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die Hütte, die Türe war verschlossen und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu klingen anfing.
Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt; denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken, und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des großen, oder wenn man will, ein Altar des Tempels würdig.
Durch eine Treppe, die von innen herauf ging, trat nunmehr der edle Jüngling in die Höhe, der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein silbernes Ruder in der Hand hielt. Man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte.
Die schöne Lilie stieg die äußeren Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten, aber noch immer musste sie sich von ihrem Geliebten entfernt halten. Die alte, deren Hand, solange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief: "Soll ich doch noch unglücklich werden?" Ihr Mann deutete nach der offenen Pforte und sagte: "Siehe, der Tag bricht an, eile und bade dich im Fluse." -
"Welch ein Rat!" rief sie, "ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden, habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt." - "Gehe", sagte der Alte, "und folge mir! Alle Schulden sind abgetragen."
Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel, der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: "Drei sind die da herrschen auf Erden: die Weisheit, der Schein und die Gewalt." Bei dem ersten Worte stand der goldne König auf, bei dem zweiten der silberne und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte.
Wer ihn sah, konnte sich, ungeachtet des feierlichen Augenblicks, kaum des Lachens enthalten, denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war förmlich zusammengesunken.
Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite. Sie schienen, obgleich blass beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen. Sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Adern des kolossalen Bildes mit ihren spitzen Zungen bis aufs innerste herausgeleckt.
Die unregelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeitlang offen und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Äderchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen und leider gerade an den Stellen, die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setzt. Dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen sollen, steif. Wer nicht lachen konnte, musste seine Augen wegwenden. Das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzusehen.
Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hinblickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert, in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. - "Das Schwert an der Linken, die Rechte frei!" rief der gewaltige König.
Sie gingen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: "Weide die Schafe!" Als sie zum goldenen König kamen, drückte er mit väterlich segnender Gebärde den Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach: "Erkenne das Höchste!"
Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgürteten Schwert hob sich seine Brust, seine Arme regten sich und seine Füße traten fester auf. Indem er den Zepter in die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden. Als aber der Eichenkranz seine Locken zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Mundes war Lilie.
"Liebe Lilie!" rief er, als ihr die silbernen Treppen hinauf entgegeneilte; denn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehen: "liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestattet mit allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entgegenbringt?"
"O! mein Freund", fuhr er fort, indem er sich zu der Alten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansah, "herrlich und sicher ist das reich unserer Väter, aber du hast die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht, die Kraft der Liebe." Mit diesen Worten fiel er dem schönen Mädchen um den Hals. Sie hatte den Schleier weggeworfen und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten unvergänglichen Röte.
Hierauf sagte der Alte lächelnd: "Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr."
Über dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, dass der Tag völlig angebrochen war, und nun fielen auf einmal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände
der Gesellschaft in die Augen.
Ein großer mit Säulen umgebender Platz machte den Vorhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluss hinüber reichte. Sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingefunden hatten, und emsig hin- und wiedergingen.
Der große Weg in der Mitte war von Herden und Maultieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin- und herflossen. Sie schienen sich alle über die Bequemlichkeit und Pacht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Volkes so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.
"Gedenke der Schlange in Ehren", sagte der Mann mit der Lampe, "du bist ihr das Leben, deine Völker sind ihr die Brücke schuldig, wodurch diese nachbarlichen Ufer erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und leuchtenden Edelsteine, die Reste ihrer aufgeopferten Körpers, sind die Grundpfeiler dieser herrlichen Brücke, auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten."
Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harfe, dem Sonnenschirm und dem Feldstuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens, aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinanstieg.
"Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib?" sagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen. "Wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Fluse badet!" Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig war, umfasste mit belebten jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm.
"Wenn ich dir zu alt bin", sagte er lächelnd, "so darfst du heute einen anderen Gatten wählen. Von heute an ist keine Ehe gültig, die nicht aufs neue geschlossen wird." "Weißt du denn nicht", versetzte sie, "dass du auch jünger geworden bist?" - "Es freut mich, wenn ich in deinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme deine Hand von neuem an, und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben."
Die Königin bewillkommte ihre neue Freundin und stieg mit ihren und den übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indes der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und aufmerksam das Gewimmel des Volks betrachtete.
Aber nicht lange dauerte seine Zufriedenheit, denn er sah einen Gegenstand, der ihm einen Augenblick Verdruss erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war, wie gewöhnlich schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden.
Anstatt derselben fand er festes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen angestaunt, doch von niemand gefühlt. Als ihm aber die Sonne in die Augen schien, und er die Hände aufhub sie auszuwischen, fuhr der Schatten seiner ungeheuren Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter der Menge hin und wider, dass Menschen und Tiere in großen Massen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr liefen in den Fluss geschleudert zu werden.
Der König, als er diese Untat erblickte, fuhr mit einer unwillkürlichen Bewegung nach dem Schwerte, doch besann er sich und blickte erst ruhig sein Zepter, dann die Lampe und das Ruder seiner Gefährten an. "Ich errate deine Gedanken", sagte der Mann mit der Lampe, "aber wir und unsere Kräfte sind gegen die Ohnmächtigen ohnmächtig." "Sei ruhig! Er schadet zum letzten Mal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt."
Indessen war der Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwunderung über das, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, tat keinem Schaden mehr, und trat gaffend in den Vorhof herein. Gerade ging er auf die Türe des Tempels zu, als auf einmal in der Mitte des Hofes auf dem Boden festgehalten wurde. Er stand als eine kolossale mächtige Bildsäule, von rötlich glänzendem Steine, da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf dem Boden um ihn her, nicht in Zahlen, sondern in edlen und bedeutenden Bildern, eingelegt waren.
Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nützlicher Richtung zu sehen. Nicht wenig verwundert war die Königin, die als sie mit größer Herrlichkeit geschmückt aus dem Altare, mit ihren Jungfrauen, heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast zudeckte.
Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er still stand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Menge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien und drängte nach der Tür.
In diesem Augenblicke schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, fing das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altar stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Begleiter erschienen in dem dämmernden Gewölbe des Tempels, von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Volk fiel auf sein Angesicht.
Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verborgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen, und das Volk zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Ehrfurcht, aber es ward desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Nische für ein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hin gebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen darf wegzuheben.
Das Volk hätte kein Ende seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden, und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre nicht ihre Aufmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz gelenkt worden.
Unvermutet fielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten, die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen, einzeln wiederholte sich dies Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreift wohl, dass die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine lustige Weise vergeudeten.
Begierig lief das Volk noch eine Zeitlang hin und wider, drängte und zerriss sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herab fielen. Endlich verlief es sich allmählich, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.
Johann Wolfgang von Goethe
DAS GESCHENK DER FEEN ...
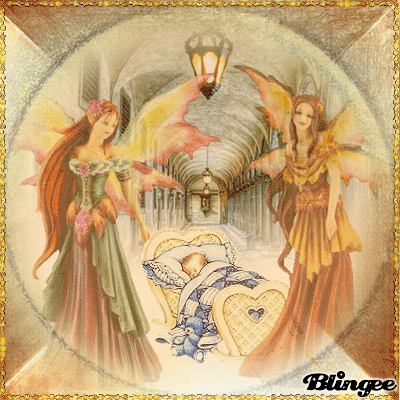
Zu der Wiege eines jungen Prinzen, der in der Folge einer der größten Regenten seines Landes wurde, traten zwei wohltätige Feen.
"Ich schenke diesem meinem Liebling", sagte die eine, "den scharfsichtigen Blick des Adlers, dem in seinem weiten Reich auch die kleinste Mücke nicht entgeht."
"Das Geschenk ist schön", unterbrach sie die zweite Fee. "Der Prinz wird ein einsichtsvoller Monarch werden. Aber der Adler besitzt nicht allein Scharfsichtigkeit, die kleinsten Mücken zu bemerken, er besitzt auch eine edle Verachtung, ihnen nicht nachzujagen. Und diese nehme der Prinz von mir zum Geschenk!"
"Ich danke dir, Schwester, für diese weise Einschränkung", versetzte die erste Fee. "Es ist wahr; viele würden weit größere Könige gewesen sein, wenn sie sich weniger mit ihrem durchdringenden Verstand bis zu den kleinsten Angelegenheiten hätten erniedrigen wollen."
Gotthold Ephraim Lessing
DER HAMSTER UND DIE AMEISE ...

"Ihr armseligen Ameisen", sagte ein Hamster. "Verlohnt es sich der Mühe, dass ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so Weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Vorrat sehen solltet!"
"Höre", antwortete eine Ameise, "wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es schon recht, dass die Menschen dir nachgraben, deine Scheuern ausleeren und dich deinen räuberischen Geiz mit dem Leben büßen lassen!"
Gotthold Ephraim Lessing
KLEINE FABEL ...
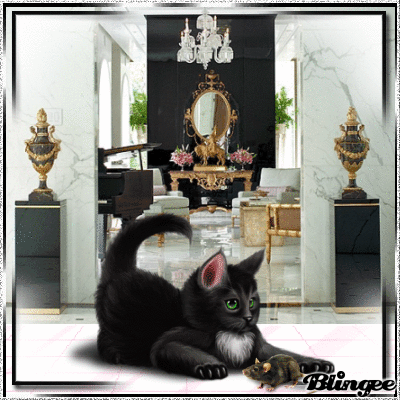
"Ach", sagte die Maus, " die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte, ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah, aber diese langen Mauern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin, und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe." -
"Du musst nur die Laufrichtung ändern", sagte die Katze und fraß sie.
Franz Kafka
DIE DANKBARE MAUS ...

Wo heute die große Stadt Dortmund liegt und die Hämmer der Arbeit dröhnen, war vor Zeiten weiter und wilder Wald.
Einst musste ein Kaufmann durch ihn hindurch. Er war ein armer Tropf, hatte zudem auf seiner Reise noch schlechte Geschäfte gemacht und saß da, müde des Weges und bekümmert über seine Not, auf einem Stein, dachte der Seinen daheim, die auf seine Rückkehr und auf das mitgebrachte Geld warteten, um Brot zu kaufen. Er wagte kaum, den eigenen Hunger, der ihn überfiel, zu stillen, zog dann aber doch das letzte Stückchen trockenen Brotes heraus und verzehrte es.
Da kam ein Mäuslein vorbei, sah zu ihm auf, als erwarte es ein Bröcklein von ihm. Den Mann dauerte das Tier, dem es hier im weiten, wilden Walde wohl noch schlechter erging als ihm. Er brach ein Stücklein ab, warf es hin und sagte: "Lass es dir schmecken, Graupelzchen!" Dann stand er auf, um sich an der Quelle zu laben, die dort unter dem Gebüsch hervor sprudelte.
Da aber lief das Mäuslein hin und her, brachte aus einem Loche ein Goldstück, dann ein zweites und noch eins und legte jedes seinem Wohltäter vor die Füße. Der wusste vor Verwunderung nicht, was er denken sollte. Das Tierlein aber kroch in das Erdloch hinein, verschwand aber nicht darin, sondern saß dort und blickte ihn an, als wolle es ihn einladen, näher zu kommen und hier zu suchen.
Der Mann tat endlich so und fand in der Erde einen Schatz vergraben, der aller seiner Not mit einem Schlage ein Ende machte.
Deutsche Sage
EIN BAUER WIRFT EINEN PFLEGER IN DEN BACH ...
Ein Verwalter oder Pfleger, der seines Edelmannes Bauern tapfer schinden helfen und nach Wohlgefallen dieselbe gekämplet, kam endlich auch in Ungnaden, also, daß er seines Dienstes entlassen worden.
Wie er sich nun auf den Weg gemachet, um andere Dienste umzuschauen, kam er in ein Dorf, so seinem gewesenen Herren zugehörig. Daselbst war ein Bach, daß er zu Fuß nicht wohl durch konnte, bat er demnach einen Bauern, er möchte ihn doch hindurch tragen, er wolle ihm anderwärts wiederum einen Dienst erweisen.
Der Bauer war hierzu gar ehrerbietig. Wie er aber mitten in den Bach gekommen und den Pfleger auf dem Rücken getragen, so fragte er den selben, wo er denn hin wolle. Der Pfleger gab zur Antwort: »Ich muß sehen, daß ich anderen Dienst bekomme.«
Der Bauer sagt: »Wie, seid Ihr nicht mehr bei unseren Edelmann und Herrschaft?«
Der Pfleger sagte: »Nein.«
Darauf sagte der Bauer: »So trag Dich der Teufel«, und warf ihn darmit in den Bach und lief davon.
Diejenige, so allzuhart mit dem armen Bauersmann verfahren, verdienen nicht allein der gleichen Dinge, sondern haben andere Strafe von Gott zu erwarten.
Abraham a Sancta Clara
DIE ALTEN UND DIE JUNGEN FRÖSCHE ...
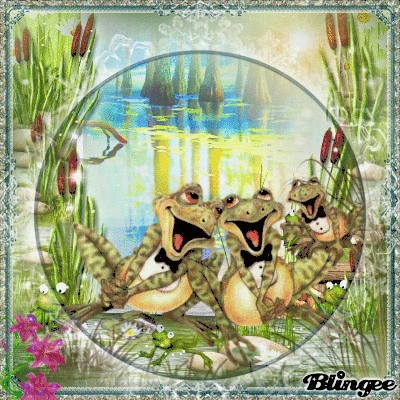
Die jungen Frösche haben einmal bei warmer Sommerzeit nächst einer Lache über allen Maßen gequackt und geschrien, also zwar, daß ein alter Frosch selbst über diese abgeschmackte Musik verdrüssig geworden und die Jungen nicht wenig ausgefilzt hat.
"Schamt euch, ihr grünhosenden Fratzen!" sagte er, "ihr wilden Lachendrescher, ihr hupfenden Spitzbuben, schamt euch, daß ihr so ein verdrießlich Geschrei vollführt! Wenn ihr aber doch wollt lustig sein und frohlocken, so singt aufs wenigst' wie die Nachtigall, welche auf diesem nächsten Ast sitzt. Ihr großmaulenden Narren, könt ihr denn nichts anderes als nur das Qua-Qua-Qua?"
"Vater", antworteten die Frösche, "das haben wir von dir gelernt."
Abraham a Sancta Clara
DER RIESE BALDERICH ...

In der westlichen Spitze der Insel Rügen in der Ostsee an der Feldscheide der Dörfer Rothenkirchen und Götemitz, etwa eine Viertelmeile von dem Kirchdorfe Rambin, liegen auf flachem Felde neun kleine Hügel oder Hünengräber, welche gewöhnlich die Neun Berge oder die Neun Berge bei Rambin genannt werden, und von welchen das Volk allerlei Märchen erzählt. Diese entstanden weiland durch die Kühnheit eines Riesen, und seitdem die Riesen tot sind, treiben die Zwerge darin ihr Wesen.
Vor langer Zeit lebte auf Rügen ein gewaltiger Riese (ich glaube, er hieß Balderich), den verdroß es, daß das Land eine Insel war und daß er immer durch das Meer waten mußte, wenn er nach Pommern auf das feste Land wollte. Er ließ sich also eine ungeheure Schürze machen, band sie um seine Hüften und füllte sie mit Erde; denn er wollte sich einen Erddamm aufführen von der Insel bis zur Feste.
Als er mit seiner Tracht bis über Rothenkirchen gekommen war, riß ein Loch in die Schürze, und aus der Erde, die heraus fiel, wurden die Neun Berge. Er stopfte das Loch zu und ging weiter; aber als er bis Gustow gekommen war, riß wieder ein Loch in die Schürze, und es fielen dreizehn kleine Berge heraus. Mit der noch übrigen Erde ging er ans Meer und goß sie hinein. Da ward der Prosnitzer Hafen und die niedliche Halbinsel Drigge.
Aber es blieb noch ein schmaler Zwischenraum zwischen Rügen und Pommern, und der Riese ärgerte sich darüber so sehr, daß er plötzlich von einem Schlagfluß hinstürzte und starb. Und so ist denn sein Damm leider nie fertig geworden.
Von demselben Riesen Balderich erzählt man ein Kraftstück, das er bei Putbus bewiesen hat. Er hatte schon mehrmals mit Ärger gesehen, daß dem Christengotte zu Vilmnitz, eine halbe Meile von Putbus, eine Kirche erbaut ward, und da hat er bei sich gesprochen: »Laß die Würmer ihren Ameisenhaufen nur aufbauen; den werfe ich nieder, wann er fertig ist.«
Als nun die Kirche fertig und der Turm aufgeführt war, nahm der Riese einen gewaltigen Stein, stellte sich auf dem Putbusser Tannenberge hin und schleuderte ihn mit so ungeheurer Gewalt, daß der Stein wohl eine Viertelmeile über die Kirche weg flog und bei Nadelitz niederfiel, wo er noch diesen Tag liegt am Wege, wo man nach Posewald fährt, und der Riesenstein genannt wird.
Sage von Ernst Moritz Arndt
DIE UNTERIRDISCHEN IN DEN NEUN BERGEN BEI RAMBIN ...

In den Neun Bergen bei Rambin wohnen nun die Zwerge und die kleinen Unterirdischen und tanzen des Nachts in den Büschen und Feldern herum und führen ihre Reigen und ihre Musiken auf im mitternächtlichen Mondschein, besonders in der schönen und lustigen Sommerzeit und im Lenze, wo alles in Blüte steht; denn nichts lieben die kleinen Menschen mehr als die Blumen und die Blumenzeit.
Sie haben auch viele schöne Knaben und Mädchen bei sich; diese aber lassen sie nicht heraus, sondern behalten sie unter der Erde in den Bergen, denn sie haben die meisten gestohlen oder durch einen glücklichen Zufall erwischt und fürchten, daß sie ihnen wieder weglaufen möchten.
Denn vormals haben sich viele Kinder des Abends und des Morgens locken lassen von der süßen Musik und dem Gesange, der durch die Büsche klingt, und sind hin gelaufen und haben zugehorcht; denn sie meinten, es seien kleine singende Waldvögelein, die mit solcher Lustigkeit musizierten und Gott lobten - und dabei sind sie gefangen worden von den Zwergen, die sie mit in den Berg hinab genommen, daß sie ihnen dort als Diener und Dienerinnen aufwarteten.
Seitdem die Menschen nun Wissens daß es da so hergeht und nicht recht geheuer ist, hüten sie sich mehr, und geht keiner dahin. Doch verschwindet von Zeit zu Zeit noch manches unschuldige Kind, und die Leute sagen dann wohl, es hab's einer der Zwerge mitgenommen; und oft ist es auch wohl durch die Künste der kleinen braunen Männer eingefangen und muß da unten sitzen und dienen und kann nicht wiederkommen.
Das ist aber ein uraltes Gesetz, das bei den Unterirdischen gilt, daß sie je alle fünfzig Jahre wieder an das Licht lassen müssen, was sie eingefangen haben. Und das ist gut für die, welche so gefangen sitzen und da unten den kleinen Leuten dienen müssen, daß ihnen diese Jahre nicht gerechnet werden, und daß keiner da älter werden kann als zwanzig Jahre, und wenn er volle fünfzig Jahre in den Bergen gesessen hätte.
Und es kommen auf die Weise alle, die wieder herauskommen, jung und schön heraus. Auch haben die meisten Menschen, die bei ihnen gewesen sind, nachher auf der Erde viel Glück gehabt: entweder, daß sie da unten so klug und witzig und anschlägisch werden, oder daß die kleinen Leute, wie einige erzählen, ihnen unsichtbar bei der Arbeit helfen und Gold und Silber zutragen.
Die Unterirdischen, welche in den Neun Bergen wohnen, gehören zu den braunen, und die sind nicht schlimm. Es gibt aber auch schwarze, das sind Tausendkünstler und Kunstschmiede, geschickt und fertig in allerlei Werk, aber auch arge Zauberer und Hexenmeister, voll Schalkheit und Trug, und ist ihnen nicht zu trauen. Sie sind auch Wilddiebe, denn sie essen gern Braten. Sie dürfen aber das Wild mit keinem Gewehr fällen, sondern sie stricken eigene Netze, die kein Mensch sehen kann; darin fangen sie es.
Darum sind sie auch Feinde der Jäger und haben schon manchem Jäger sein Gewehr behext, daß er nicht treffen kann. Das glauben aber bis diesen Tag viele Leute, daß nichts eine größere Gewalt über diese Schwarzen hat als Eisen, worüber gebetet worden, oder was in Christenhänden gewesen ist. Solche Schwarzen wohnen hier aber gar nicht.
In zwei Bergen wohnen von den weißen, und das sind die freundlichsten, zartesten und schönsten aller Unterirdischen, fein und anmutig von Gliedern und Gebärden und ebenso fein und liebenswürdig drinnen im Gemüte. Diese Weißen sind ganz unschuldig und rein und necken niemand, auch nicht einmal im Scherze, sondern ihr Leben ist licht und zart, wie das Leben der Blumen und Sterne, mit welchen sie auch am meisten Umgang halten.
Diese niedlichen Kleinen sitzen den Winter, wann es auf der Erde rauh und wüst und kalt ist, ganz still in ihren Bergen und tun da nichts anderes, als daß sie die feinste Arbeit wirken aus Silber und Gold, daß die Augen der meisten Sterblichen zu grob sind, sie zu sehen; die sie aber sehen können, sind besonders feine und zarte Geister.
So leben sie den trüben Winter durch, wann es da draußen unhold ist, in ihren verborgenen Klausen. Sobald es aber Frühling geworden und den ganzen Sommer hindurch, leben sie hier oben im Sonnenschein und Sternenschein sehr fröhlich und tun dann nichts als sich freuen und anderen Freude machen. Sobald es auch im ersten Lenze zu sprossen und zu keimen beginnt an Bäumen und Blumen, sind sie husch aus ihren Bergen heraus und schlüpfen in die Reiser und Stengel und von diesen in die Blüten und Blumenknospen, worin sie gar anmutig sitzen und lauschen.
Des Nachts aber, wann die Menschen schlafen, spazieren sie heraus und schlingen ihre fröhlichen Reihentänze im Grünen um Hügel und Bäche und Quellen und machen die aller lieblichste und zarteste Musik, welche reisende Leute so oft hören und sich verwundern, weil sie die Spieler nicht sehen können.
Diese kleinen Weißen dürfen auch bei Tage immer heraus, wann sie wollen, aber nicht in Gesellschaft, sondern einzeln, und sie müssen sich dann verwandeln. So fliegen viele von ihnen umher als bunte Vögelein oder Schmetterlinge oder als schneeweiße Täubchen und bringen den kleinen Kindern oft Schönes und den Erwachsenen zarte Gedanken und himmlische Träume, von welchen sie nicht wissen, wie sie ihnen kommen.
Das ist bekannt, daß sie sich häufig in Träume verwandeln, wenn sie in geheimer Botschaft reisen. So haben sie manchen Betrübten getröstet und manchen Treuliebenden erquickt. Wer ihre Liebe gewonnen hat, der ist im Leben besonders glücklich, und wenn sie nicht so reich machen an Schätzen und Gütern als die anderen Unterirdischen, so machen sie reich an Liedern und Träumen und fröhlichen Geschichten und Phantasien. Und das sind wohl die besten Schätze, die ein Mensch gewinnen kann.
Sage von Ernst Moritz Arndt
DAS SILBERGLÖCKCHEN ...

Ein Schäferjunge zu Patzig, eine halbe Meile von Bergen, wo es in den Hügeln auch viele Unterirdische hat, fand eines Morgens ein silbernes Glöckchen auf der grünen Heide zwischen den Hünengräbern und steckte es zu sich.
Es war aber das Glöckchen von einer Mütze eines kleinen Braunen, der es da im Tanze verloren und nicht sogleich bemerkt hatte, daß es an dem Mützchen nicht mehr klingelte. Er war nun ohne das Glöckchen heruntergekommen und war sehr traurig über diesen Verlust. Denn das Schlimmste, was den Unterirdischen begegnen kann, ist, wenn sie die Mütze verlieren, dann die Schuhe. Aber auch das Glöckchen an der Mütze und das Spänglein am Gürtel ist nichts Geringes. Wer das Glöckchen verloren hat, der kann nicht schlafen, bis er es wiedergewinnt, und das ist doch etwas recht Betrübtes.
Der kleine Unterirdische in dieser großen Not spähte und spürte umher; aber wie sollte er erfahren, wer das Glöcklein hatte? Denn nur wenige Tage im Jahr dürfen sie an das Tageslicht hinaus, und dann durften sie auch nicht in ihrer wahren Gestalt erscheinen. Er hatte sich schon oft verwandelt in allerlei Gestalten, in Vögel und Tiere, auch in Menschen, und hatte von seinem Glöckchen gesungen und geklungen und gestöhnt und gebrüllt und geklagt und gesprochen; aber keine kleinste Kunde oder nur Spur von einer Kunde war ihm bis jetzt zugekommen.
Denn das war das Schlimmste, daß der Schäferjunge gerade den Tag, nachdem er das Glöckchen gefunden, von Patzig weg gezogen war und jetzt zu Unrow bei Gingst die Schafe hütete. Da begab es sich erst nach manchem Tag durch ein Ungefähr, daß der arme kleine Unterirdische wieder zu seinem Glöckchen und zu seiner Ruhe kommen sollte.
Er war nämlich auf den Einfall gekommen, ob auch ein Rabe oder Dohle oder Krähe oder Uglaster das Glöckchen gefunden und etwa bei seiner diebischen Natur, die sich in das Blanke vergafft, in sein Nest getragen habe. Und er hatte sich in einen angenehmen, kleinen bunten Vogel verwandelt und alle Nester auf der ganzen Insel durchflogen und den Vögeln allerlei vorgesungen, ob sie ihm verraten möchten, daß sie den Fund getan hätten, und er so wieder zu seinem Schlaf käme.
Aber die Vögel hatten sich nichts merken lassen. Als er nun des Abends flog über das Wasser von Ralow her über das Unrower Feld hin, weidete der Schäferjunge, welcher Fritz Schlagenteuffel hieß, dort eben seine Schafe. Mehrere der Schafe trugen Glocken um den Hals und klingelten, wenn der Junge sie durch seinen Hund in den Trab brachte.
Das Vögelein, das über sie hin flog, dachte an sein Glöcklein und sang in seinem traurigen Mut:
Glöckelein, Glöckelein.
Böckelein, Böckelein,
Schäflein auch du,
Trägst du mein Klingeli,
Bist du das reichste Vieh,
Trägst meine Ruh.
Der Junge horchte nach oben auf diesen seltsamen Gesang, der aus den Lüften klang, und sah den bunten Vogel, der ihm noch viel seltsamer vorkam. Er sprach bei sich: »Potztausend, wer den Vogel hätte! Der singt ja, wie unsereiner kaum sprechen kann. Was mag er mit dem wunderlichen Gesange meinen? Am Ende ist es ein bunter Hexenmeister. Meine Böcke haben nur tonbackene Glocken, und er nennt sie reiches Vieh, aber ich habe ein silbernes Glöckchen, und von mir singt er nichts!«
Und mit den Worten fing er an, in der Tasche zu fummeln, holte sein Glöckchen heraus und ließ es klingen. Der Vogel in der Luft sah sogleich, was es war, und freute sich über die Maßen; er verschwand aber in der Sekunde, flog hinter den nächsten Busch, setze sich, zog sein buntes Federkleid aus und verwandelte sich in ein altes Weib, das mit kümmerlichen Kleidern angetan war.
Die alte Frau, mit einem ganzen Sack voll Seufzer und Ächzer versehen, stümperte sich quer über das Feld zu dem Schäferbuben hin, der noch mit seinem Glöcklein klingelte und sich wunderte, wo der schöne Vogel geblieben war, räusperte sich und tat einige Huster aus hohler Brust und bot ihm dann einen freundlichen guten Abend und fragte nach der Straße zu der Stadt Bergen.
Dann tat sie, als ob sie das Glöcklein jetzt erst erblickte, und rief: »Herrje, welch ein niedliches, kleines Glöckchen! Hab' ich doch in meinem Leben nichts Feineres gesehen! Höre, mein Söhnchen, willst du die Glocke verkaufen? Und was soll sie kosten? Ich habe ein kleines Enkelchen, für den wäre sie mir eben ein bequemes Spielgerät.« -
»Nein, die Glocke wird nicht verkauft!« antwortete der Schäferknabe kurz abgebissen; »das ist eine Glocke, so eine Glocke gibt's in der Welt nicht mehr: wenn ich nur damit anklingele, so laufen meine Schafe von selbst hin, wohin ich sie haben will; und welchen lieblichen Ton hat sie! Hört mal, Mutter«, (und er klingelte) »ist eine Langeweile in der Welt, die vor dieser Glocke aushalten kann? Dann kann ich mir die längste Zeit weg klingeln, daß sie in einem Hui fort ist.«
Das alte Weib dachte: »Wollen sehen, ob er Blankes aushalten kann?« und hielt ihm Silber hin, wohl drei Taler; er sprach: »Ich verkaufe aber die Glocke nicht.« Sie hielt ihm fünf Dukaten hin; er sprach: »Das Glöckchen bleibt mein.« Sie hielt ihm die Hand voll Dukaten hin; er sprach zum dritten Mal: »Gold ist Quark und gibt keinen Klang.«
Da wandte die Alte sich und lenkte das Gespräch anderswohin und lockte ihn mit geheimen Künsten und Segenssprechungen, wodurch sein Vieh Gedeihen bekommen könnte, und erzählte ihm allerlei Wunder davon. Da ward er lüstern und horchte auf.
Das Ende vom Liede war, daß sie ihm sagte: »Höre, mein Kind, gib mir die Glocke; siehe, hier ist ein weißer Stock« (und sie holte ein weißes Stäbchen hervor, worauf Adam und Eva sehr künstlich geschnitten waren, wie sie die paradiesischen Herden weideten, und wie die feistesten Böcke und Lämmer vor ihnen hintanzten; auch der Schäferknabe David, wie er ausholt mit der Schleuder gegen den Riesen Goliath), »diesen Stock will ich dir geben für das Glöckchen, und solange du das Vieh mit diesem Stäbchen treibst, wird es Gedeihen haben, und du wirst ein reicher Schäfer werden; deine Hämmel werden immer vier Wochen früher fett werden als die Hämmel aller anderen Schäfer, und jedes deiner Schafe wird zwei Pfund Wolle mehr tragen, ohne daß man ihnen den Segen ansehen kann.«
Die alte Frau reichte ihm den Stock mit einer so geheimnisvollen Gebärde und lächelte so leidig und zauberisch dazu, daß der Junge gleich in ihrer Gewalt war. Er griff gierig nach dem Stock und gab ihr die Hand und sagte: »Topp, schlag ein! Die Glocke ist dein für den Stock.« Und sie schlug ein und nahm die Glocke und fuhr wie ein leichter Wind über das Feld und die Heide hin. Und er sah sie verschwinden, und sie deuchte ihm wie ein Nebel hinzufließen und sanft fortzulaufen, und alle seine Haare richteten sich zu Berge.
Der Unterirdische, der ihm die Glocke in der Verkleidung einer alten Frau abgeschwatzt, hatte ihn nicht betrogen. Denn die Unterirdischen dürfen nicht lügen, sondern das Wort, das sie von sich geben oder geloben, müssen sie halten; denn wenn sie lügen, werden sie stracks in die garstigsten Tiere verwandelt, in Kröten, Schlangen, Mistkäfer, Wölfe und Luchse und Affen, und müssen wohl Jahrtausende in Abscheu und Schmach herumkriechen und herumstreichen, ehe sie erlöst werden. Darum haben sie ein Grauen davor.
Fritz Schlagenteuffel gab genau acht und versuchte seinen neuen Schäferstab, und er fand bald, daß das alte Weib ihm die Wahrheit gesagt hatte, denn seine Herde und all sein Werk und seiner Hände Arbeit geriet ihm wohl und hatte ein wunderbares Glück, so daß alle Schafherren und Oberschäfermeister diesen Jungen begehrten.
Er blieb aber nicht lange Junge, sondern schaffte sich, ehe er noch achtzehn Jahre alt war, seine eigene Schäferei und ward in wenigen Jahren der reichste Schäfer auf ganz Rügen, so daß er sich endlich ein Rittergut hat kaufen können: und das ist Grabitz gewesen hier bei Rambin, was jetzt den Herren vom Sunde gehört.
Da hat mein Vater ihn noch gekannt, wie aus dem Schäferjungen ein Edelmann geworden war, und hat er sich auch da als ein rechter, kluger und frommer Mann aufgeführt, der bei allen Leuten ein gutes Lob hatte, und der hat seine Söhne wie Junker erziehen lassen und seine Töchter wie Fräulein, und es leben noch davon und dünken sich jetzt vornehme Leute. Und wenn man solche Geschichten hört, möchte man wünschen, daß man auch mal so etwas erlebte und ein silbernes Glöcklein fände, das die Unterirdischen verloren haben.
Sage von Ernst Moritz Arndt
DER ALTE VON GRANITZ ...

Nicht weit von der Aalbeck liegt ein kleiner Hof namens Granitz unter der großen waldigen Uferforst, welche auch die Granitz genannt wird. Auf diesem Höfchen lebte vor nicht langen Jahren ein Herr von Scheele. Dieser war in seinen späteren Tagen in Trübsinn gesunken und sah fast keinen Menschen mehr, da er früher ein sehr munterer und geselliger Mann und ein gewaltiger Jäger gewesen war.
Diese Einsamkeit des alten Mannes, sagen die Leute, kam daher, daß ihm drei schöne Töchter, die man die drei schönen Blonden hieß, und die hier in des Waldes Einsamkeit unter Herden und Vögeln aufgewachsen waren, mit einem Male alle drei in einer Nacht davon gegangen waren und nie wiedergekommen sind. Das hatte der alte Mann sich zu Gemüt gezogen und sich von der Welt und ihren lustigen Freuden abgewendet.
Er hatte vielen Umgang mit den kleinen Schwarzen und war auch mancher Nacht außer dem Hause, und kein Mensch wußte, wo er gewesen war; wenn er aber um die Morgendämmerung heimkam, flüsterte er seiner Haushälterin zu: »Pst! Pst! Ich habe heint an hoher Tafel geschmaust.«
Dieser alte Herr von Scheele pflegte seinen Freunden zu erzählen und bekräftigte es wohl mit einem tüchtigen husarischen und weidmännischen Fluche, in den Granitzer Tannen um die Aalbeck und an dem ganzen Ufer wimmele es von Unterirdischen. Auch hat er Leute, die er dort herum spazieren führte, oft eine Menge kleiner Spuren gezeigt, wie von den allerkleinsten Kindern, die da im Sande von ihren Füßchen einen Abdruck hinterlassen hätten, und ihnen plötzlich zugerufen: »Horch! Wie es da wieder wispert und flüstert!«
Ein anderes Mal, als er mit guten Freunden längs dem Meeresstrand gegangen, ist er wie in Bewunderung plötzlich still gestanden, hat auf das Meer gezeigt und gerufen: »Da sind sie meiner Seele wieder in voller Arbeit, und viele Tausende sind um ein paar versunkene Stückfässer Wein beschäftigt, die sie ans Ufer wälzen. Was wird das die Nacht ein lustiges Gelage werden!«
Dann hat er ihnen erzählt, er könne sie sehen bei Tage und bei Nacht, und ihm tun sie nichts, ja sie seien seine besonderen Freunde, und einer habe sein Haus einmal von Feuersgefahr errettet, da er ihn nach Mitternacht aus tiefem Schlafe aufweckte und ihm einen Feuerbrand zeigte, der vom Herde gefallen und schon anderes Holz und Stroh, das auf der Flur lag, anzünden wollte.
Man sehe beinahe alle Tage einige von ihnen am Ufer; bei hohen Stürmen aber, wo das Meer sehr tobe, seien sie fast alle da und lauern auf Bernstein und Schiffbrüche, und gewiß vergehe kein Schiff, von welchem sie nicht den besten Teil der Ladung bergen und unter der Erde in Sicherheit bringen. Und wie herrlich da unter den Sandbergen bei ihnen zu wohnen sei, und welche kristallene Paläste sie haben, davon habe auch kein Mensch eine Vorstellung, der nicht da gewesen sei.
Dieser alte Mann galt sonst für einen guten und freundlichen Mann, und kein Mensch hat ihm nachgesagt, daß er etwas tue, was einen Bund mit bösen Geistern verrate. Aber der Umgang mit den kleinen Schwarzen ist nicht immer so unschuldig. Davon gibt es auch eine Geschichte.
Sage von Ernst Moritz Arndt
DER FALSCHEID ...

Bei dem Kirchdorfe Lancken unweit der Granitz wohnte ein Bauer namens Matthes Pagels, ein sinniger, fleißiger Mann, der sehr einsam und still lebte, und den die Leute für sehr reich hielten. Einige munkelten auch, er sei ein Hexenmeister. Aber mancher wird für einen Hexenmeister gehalten, der sein Geld durch die natürlichste Hexerei erwirbt, daß er fleißig ist und gut aufpaßt.
Dieser Pagels war aber kein guter Mensch. Er bekam Streit mit einem seiner Nachbarn, weil dieser ihn beschuldigte, er pflüge ihm an einer Seite den Acker ab. Und der Bauer Pagels tat das wirklich; er fluchte und schwur aber, das ganze Ackerstück gehöre ihm in seiner ganzen Breite, soweit er gepflügt hatte, und noch zehn Schritte weiter bis zu der hohen Buche, die oben an dem Rain stand; und das wollte er durch Eid und Schriften beweisen. Und er hat es bewiesen durch Eid und Urkunden und ein Papier vorgebracht, wodurch der Acker sein geworden ist.
Die Leute sagen aber, zwei von den kleinen Schwarzen, die ihm auch das Geld in das Haus getragen, haben das falsche Papier geschmiedet und in der großen höllischen Staatskanzlei des Teufels geschrieben und besiegelt. Matthes Pagels aber hat schon bei seinem Leben die Strafe dafür gehabt, daß er weder Kraft noch Ruhe hatte vor seinen kleinen Geistern: jede Nacht um zwölf Uhr mußte er mit aller Gewalt aus dem Bette und auf dem Ackerstück rund wandeln und auf die hohe Buche klettern und dort zwei volle Glockenstunden aushalten und frieren.
Noch sieht man ihn zuweilen da als einen kleinen Mann im grauen Rocke mit einer weißen Schlafmütze auf dem Kopfe; gewöhnlich sitzt er aber wie eine schneeweiße Eule auf dem Baume, sobald die Mitternacht vorbei ist, und schreit ganz jämmerlich. Und kein Mensch kommt dem Baume gern zu nahe, und kein Pferd ist da auf dem Wege vorbeizubringen, sondern sie schnauben und blasen und bäumen sich und gehen auch mit dem besten Reiter durch und querfeldein.
Als meine selige Mutter, die in Lancken geboren war, noch ein Kind war, sangen die Leute noch vom Matthes Pagels und seiner Buche:
Pagels mit de witte Mütz,
Wo koold un hoch is din Sitz!
Up de hoge Bök
Un up de kruse Eek
Un achter'm hollen Tuun;
Worüm kannst du nich ruhn?
Darüm kann ick nich rasten:
Dat Papier liggt im Kasten,
Un mine arme Seel
Brennt in de lichte Höll.
Sage von Ernst Moritz Arndt
DE KRÖGER VAN POSERITZ ... (Mundart)

Im Lande Rügen nich wiet van de Olde Fähr etwa eene Mil vam Sunde is een Karkdörp, dat het Poseritz. Då wahnde mal een riker Smitt, un de hedd ook eenen swarten Pudel, de kunn afsünnerlichste Künste. Dat Deerd was to sinen Künsten so klook und haselierig, datt de Smitt, de mit siner Smed eenen Krog helt, dat Hus jümmer vull Lüd hedd.
De Pudel was so god, as hedde de Mann alle Dag Poppenspill edder eene heele Bande Kumödiganten im Huse hett. Dat gaff schöne Penning un klung hell in den Büdel herin; äwerst o weh! wo hett et toletzt för de arme Seel klungen! De Kröger wurd een riker Mann dör sinen Pudel, denn alle Lüde drögen ein dat Geld to un wullen den Pudel sine Künste spelen sehn. Se seggen, de Pudel wahnde nich egentlich bi dem Smitt.
Denn des Dags hett man em då nich sehn; man in der Schummering kam he un bleef bet in deepste Nacht. He was äwerst een van de höllischen Schatzwächters ut den Bargen bi Gustow, worunner de olden Heiden mit ehren Schätzen begrawen liggen. Un då müßt he des Dags unner der Erd liggen un um de Middnacht as Wächter herumwedeln. Un he mag dem Kröger woll jeden Awend een paar Dukaten in den Poten mitbröcht hebben. Denn de Kröger wurd in weinigen Jåhren een steenriker Mann un buwede sick sinen Krog torecht as de Poseritzer Propost un Eddelmann un köfde sick eenen Morgen Land äwer den annern.
Äwerst wo leep ditt lustige Spill toletzt henut? So rückt alle vörbadene Lust der Minschenkinder to Anfang as Liljen un Rosen; äwerst ehr Ende het Gestank. De swarte Nachtwächter bleef weg un kam nich mehr in't Hus. Un de Smitt was ängstlich un verstürt, un de Gäste fragden nah dem Hund. Denn sede de Smitt: »Man mütt mi den Hund stahlen hebben edder ook hett en Deef en doodslagen un ingrawen.« Doch was dem armen Kerl nich woll um't Hart, un he sach går nüsterbleek un bedröwt ut, so datt de Lüde nich begripen kunnen, wo een vernünftig Minsch sick äwer een unvernünftig Deerd so grämen künn, un allerlei bunt Gerede drut entstund.
So weren een paar Weken vörleden, un eenen Sündagawend, as de Kröger mit veelen Gästen üm den Disch satt un Kårten spelde, hürden se wat dör de Luft susen un gegen dat Finster slan, un en düchte, dat was een swarter Pudel. Un allen kam een grausamer Gruwel an, un se mügten nich upkieken gegen dat Finster. As se sick äwerst wedder een beten besunnen hedden, sproken se lang dåräwer; de Kröger äwerst satt still achter dem Awen un let den Kopp hängen.
Un se foppten sick toletzt unner eenanner, wer woll dat Hart hedd, herut to gahn un to sehn, wat då were. Un een Snider nam sick de rechte Sniderkrauwagie un begehrde eenen Gesellen, de dat Aventür mit em wagen wull. Un et fund sick eener to em, un se gingen in den Gården, wo dat Finster herutging, un süh, då lag een dooder, swarter Pudel, den de Snidergesell recht god kennde. Un se meenden nu all, man hedde dat dem Smitt tom Schabernack dhan, wiel de Pudel em as een güldnes Hohn was, un een Fiend un Schelm hedde den dooden Hund so gegen dat Finster smeten. Un se gröwen een Loch an dem Tun und leden den Pudel dårin und sett'ten sick dårup wedder tom Spill dal.
Äwerst de Smitt satt achter dem Awen un sede keen Starwenswurt un was sehr trurig. Un as se wedder van besten Künsten de Kårten flegen leten un uttrumfden, fung dat buten wedder an to susen un to brusen, un Kling! sede dat Finster, un de Pudel flog äwer den Disch un föll in de Stuw dal, un de meisten Gäste, de üm den Disch seten, föllen vör Schreck van den Bänken un krüzden un segneden sick.
De tappre Snidergesell, de een Hart hedd gröter as sin Natelknoop, nam den Pudel un smet en tom Finster herut; un de Gäste nehmen ehre Höd van der Wand un makten sick up de Beenen. Un knapp was eene halwe Stund vorgahn, då sede dat wedder Kling! un de Pudel föll to'm tweeten Mal in de Stuw. Då lag he bi dem bedröwten Wirt bet an den hellen, lichten Morgen, denn de arme Minsch bleew alleen sitten, un Fru un Kinder un Gesellen weren to Bedd gahn.
As äwerst de Sünn upging, was de Pudel weg, un keen Minsch wüßt, wo he stawen un flagen was. He hedd äwerst eenen grausamern Gestank as dat schändlichste Aas nah sick laten. Un up desülwige Wis is dat Greuel düslingto alle Nacht dörcht Finster edder dörch de Dören, ja dörcht Dack un de Wänd flagen; un hulpen keene Breder un Rigel, un ick glöw, he hedd sinen Weg dörch Stal un Demantsteen braken. Se gingen hen un begröwen den Hund mit grotem Staate; se brukten Segen un Bespreken äwer siner Gruft - alles umsüs: he kam jümmer wedder.
De arme Smitt grep to un makte sick eene annere Stuw torecht, he tog ut bawen herup in een Stüwken unner de Auken, he meende sick to vörsteken; äwerst de Pudel hedd em eene to fine Näs, jümmer flog he herin, wo de Smitt was.
Nu ging dat natürlich to, dat Krog un Smede bald leddig un vörlaten stunden, un datt de Smitt mit Wif un Kindern un mit dem aasigen, stinkenden Pudel eensam un alleen sitten un truren müßte. Wat dheed de arme Mann toletzt? He ging to un vörköfde alles, Smed und Krog un Acker un Gården, un tog van Poseritz weg.
Un dem Mann, de dat Hus van em köft hedd, let de Pudel ook keene Ruh, un he kunn nich eher ruhig slapen vör all dem Gesuse un Gebruse und dem Günsen und Krassen, dat et des Nachts bedref, bet he dat Hus afbraken un an eener annern Stell weder upbuwt hedd. Don week de Düwel van em, äwerst van dem armen Smitt week he nich. Disse hedd de Lade vull Dukaten un wull een Eddelmann warden und köfde sick eenen schönen Hoff, de Üselitz het. Äwerst wat Eddelmann un Dukaten!
Dat ging all to End mit em. De Pudel tog mit em in sin Eddelmannshus un husierde so arg, dat keen Knecht edder Magd bi dem jungen Eddelmann bedarwen kunn. Tolest satt de arme Smitt mit Fru un Kindern un mit all sinem Rikdom heel vörlaten då. Un as de Bös em lang nog ängstigt hedd up Erden, hett he em in eener Nacht den Gnadenstot gewen.
Et was eene schöne, stille Sommernacht, keen Blitz un keene Lüchting to sehn, keen Lüftken, dat im Rohr spelde, då hebben de Nawers, de üm Üselitz wahnen, plötzlich een gewaltiges für upstigen sehn, un in eener halwen Stund is alles, alles, Hus un Hoff un Minschen un Veh un de Smitt mit den Sinigen un mit sinem Düwelsgolde to Stoff un Asch vörbrennt west und hett man nümmer keene Spur van em sehn.
Äwerst een Mann ut Mellnitz, de tom Löschen tolopen was, hett eenen swarten Pudel sehn, de mit greulich glönigen Oogen dör den Gården un Busch wegstrek un noch lang gräselich hülde. So hült de Satan vör Froiden, wenn he arme Seelen vörslingen kann.
Sage von Ernst Moritz Arndt
THRIN WULFEN ...

Nicht weit von Schoritz, zwischen Schoritz und Puddemin, an dem Wege, wo man von Garz nach dem Zudar fährt, lag einst ein kleines Dorf, das hieß Günz, worin ein paar Bauern wohnten, die nach Schoritz zu Hofe dienten. Die sind aber ganz zerstört mit Häusern und mit Gärten, so daß man dort keine Spur mehr sieht, daß jemals Menschen dort gewohnt haben.
In diesem Dorfe Günz wohnte ein Bauer, der hieß Jochen Wulf, der hatte eine Frau, und die hieß Thrin; das war eine arge Hexe, von deren losen Künsten und bösen Streichen die Leute noch heute zu erzählen wissen. Daß sie aber eine Hexe war, konnte man ihr anmerken an ihrer außerordentlichen Freundlichkeit und Leidigkeit, woraus List und Schelmerei oft hervor lächelten, und an den schönen und leckeren Sachen, die sie immer bei sich trug, und womit sie die Hunde und kleinen Kinder an sich lockte.
Davor hat den Leuten auch gegraut, daß ihr, wohin sie immer gekommen, die Katzen von selbst auf den Schoß gesprungen sind, was diese Tiere, die eben keine Menschenfreunde sind, sonst nimmer mit Fremden tun. Denn durch die Kinder und durch Leckereien, die sie den Kindern geben, und durch Sälbchen und Kräuterchen, womit sie bei Kinderkrankheiten immer gleich zur Hand sind, drängen sich die alten Hexen in alle Häuser, und Hunde und Katzen dürfen sie nicht zu Feinden haben, weil ihre Arbeit meistens des Nachts ist, wo die anderen Christenmenschen schlafen.
Doch merkten die Leute ihr und ihrem Manne ihr heimliches und verbotenes Handwerk dadurch an, daß sie sehr reich wurden, und daß der Bauer Wulf dreimal soviel Korn und Weizen verkaufen konnte wie seine Nachbarn, und daß seine Pferde und Kühe, wenn er sie im Frühling ins Gras trieb, so glatt und fett waren wie die Aale, und als ob sie aus dem Teige gewälzt wären.
Auch sagten alle Leute, sie habe einen Drachen, und den haben sie des Nachts oft auf ihr Dach herabschießen sehen, wo er ihr Raub und Schätze von anderen zutrug. Das ist auch gewiß, und viele Leute haben es erzählt, die bei nächtlicher Weile bei Günz vorbeigegangen sind, daß es dann auf dem Wege oft geknarrt und geseufzt hat, wie die Räder an schwer beladenen Wägen knarren und seufzen.
Da haben die Leute sich umgesehen oder sind aus dem Wege gesprungen, damit sie nicht überfahren würden; sie haben aber weder Pferde noch Wagen gesehen, und es ist ihnen ein entsetzliches Grauen angekommen. Das ist aber auch der alte, heimliche Drache gewesen, der den Nachbarn die Garben gestohlen und sie in des Wulfs Scheunen hat einfahren lassen. Daß die Thrine Wulfen eine arge Wetterhexe war, hat man am meisten auf der Weide und Brache an dem jungen Vieh sehen können.
Wenn sie einmal unter eine Herde kam, gleich streckte ein Kalb alle viere von sich und hatte den Frosch, oder ein paar Dutzend junge Gänschen machten nicht zum Vergnügen den Drehhals, oder einige Lämmer und Jährlinge wurden Kopfhänger und Kopfschüttler, oder eine Schar Säue tanzte den Dreher.
Sie gebärdete sich bei solchem Anblick, als tue es ihr sehr leid (die alten Hexen aber können es nicht lassen, junges, freudiges Vieh zu behexen, und wenn es ihr eigenes wäre), und sie sagte den Hirten oder Nachbarn, sie habe und wisse manche heilsame Mittel gegen solche Übel; sie sollen nur zu ihr kommen und sich eine Salbe holen und die kranken Tierchen damit bestreichen, gleich werde es dann besser mit ihnen werden.
Das haben einige getan, und wirklich hat es stracks geholfen, aber den meisten hat gegraut, über ihre Schwelle zu treten, und da hat das liebe Vieh denn dran gemußt. Alle aber haben sich zugeflüstert, Thrin Wulfen habe sie behext und ihnen den Schabernack angetan.
So zum Beispiel hatte sie eine Frau, welche sich mit ihr erzürnt und sie eine alte Wetterhexe gescholten hatte, in ihrem eignen Hause fest gezaubert, daß sie nicht über die Schwelle zu gehen wagte und alle Türen und Fenster dicht versperrt hielt.
Denn sie glaubte, sie sei in eine Erbse verwandelt, und jeder Vogel, der vorüber flog, war ihr so fürchterlich, daß sie bei seinem Anblick schrie, als fliege ihr Tod heran, ja daß sie bei dem Ton eines Gefieders aus der Luft schon in Ohnmacht fiel und mit Händen und Füßen zappelte; für die Enten, Hühner und Tauben aber in ihrem Hofe war der jüngste Tag gekommen, und sie hatten ihnen allen sogleich beim Beginn ihrer Krankheit die Hälse umdrehen lassen.
Auch hatte die alte Bösewichtin es dem Mann dieser Frau angetan, daß er wie ein kindischer und besoffener Narr tanzen mußte, sobald er einen Ziegenbock springen sah. Und dies ist allen Leuten lächerlich und ärgerlich anzusehen gewesen, und das ärgste dabei ist noch gewesen, daß die Einfältigen vor dem Mann eine Art Grauen bekommen haben, als sei er auch von der Ziegenbocksgesellschaft und von den Blocksbergfahrern; die Klugen aber haben wohl gewußt, von wem diese Bockssprünge herrührten, doch keiner hat es ihr beweisen können.
Und man kann wohl denken, wie die alte Bosheit in sich gelacht hat, daß der unschuldige Mann für ihren Gesellen gehalten worden ist. Ihr Vieh war immer das fetteste und mutigste in der ganzen Dorfherde, und man konnte an vielen Zeichen sehen, daß der Teufel sein Spiel damit hatte; denn fast nie ist ein Stück davon krank worden, und sie hat ihnen solche Kraft und Stärke angezaubert, daß von ihren kleinsten Kälbern die größten Ochsen sich stoßen ließen, und daß ihre Ferkel die wütendsten Eber aus dem Felde schlugen.
Auch haben die Leute sie in mancherlei Verwandlungen umherlaufen und herumfliegen gesehen, aber niemand hat sich unterstanden, sie anzupacken oder ihr etwas zu tun; auch haben sie die allerwunderlichsten bunten Hunde und Katzen und sogar Füchse und Wiesel bei Tage und bei Nacht um ihren Hof laufen gesehen, aber keiner hat sie angetastet; sie wußten wohl, aus wessen Stall dieses gefährliche Vieh war.
Von Elstern und Krähen aber hüpften immer ganze Scharen auf ihrem Hofe und ihren Dächern, und von ihrem einzigen Hausgiebel uhuheten des Nachts mehr Eulen, denn von allen Häusern und Dächern in Swantow und Puddemin zusammen.
So ist sie in der Nachbarschaft viel herum gestrichen und herum geflogen auf Schelmstücke und Diebsschliche, und es ist ihr lange genug glücklich gegangen. Der Pastor zum Zudar, der Herr Manthey hieß, hat die meiste Not mit ihr gehabt, und auch wohl deswegen, weil er dem Bösen selbst den Krückstock reichte, womit er ihn überholen konnte, da er mehr ins Buch der vier Könige guckte als in Bibel und Evangelienbuch.
Einmal ist Thrin Wulfen zu seiner Frau gekommen und hat ihr eine Stiege Eier gebracht, und sie und die Frau Pastorin haben einander viel erzählt und sind sehr herzig und heimlich miteinander geworden, so daß die Frau Pastorin endlich die Thrin, als sie Ade gesagt, umhalst hat. Da ist ihr aber geschehen, daß sie vor Schrecken ohnmächtig worden und wie tot hingefallen ist. Denn was hat sie gesehen?
Vor ihren sehenden Augen und unter ihren greifenden Händen ist die Thrin plötzlich eine rote Füchsin geworden und hat ihr mit den Vordertatzen die Wangen gestreichelt und mit der Schnauze das Gesicht geleckt und dabei recht fürchterlich greinig und freundlich ausgesehen. Das hat die Pastorin später vielen Leuten erzählt; wie es aber weiter geworden, hat sie nicht gewußt; denn als sie wieder zur Besinnung gekommen, war die Thrin weg und auch keine Spur von ihr und der roten Füchsin mehr da als der Geruch der füchsischen Küsse in ihrem Gesichte und ein paar leichte rote Streifen, womit sie sie bei der umhalsenden Liebkosung gekratzt hatte.
Zuerst hat die Frau Manthey die Geschichte aus Furcht verschwiegen und erst nach Verlauf von Jahren erzählt. Auch Pastor Manthey ist inne geworden, daß er gegen die losen und leichten Künste der Thrin sich nicht mit der gehörigen geistlichen Rüstung gewaffnet hatte, und daß sie an ihn durfte; er hat bemerkt, daß ihm ein Dieb an seine Schinken und Würste kam, und das ist auch die Thrin gewesen.
Denn wie manche Nacht ist sie als Katze in Wiemen und Keller und Speisekammern geschlichen und hat sich eine Wurst, eine Spickgans oder ein Stück Schinken nach Hause getragen! Endlich war es ruchbar geworden, daß man oft eine unbekannte graue Katze durchs Dorf laufen gesehen und daß auch anderen Leuten auf eine ähnliche, unbegreifliche Weise manches abhanden gekommen war.
Da lauerte der Pastor des Abends und in der Frühe oft genug auf mit einem geladenen Gewehr; aber nimmer hat er den schleichenden Dieb erwischen können. Endlich aber ist ihm die Katze mal in dem Garten in den Wurf gekommen, als er Sperlinge schießen wollte, und er hat ihr unverzagt aufs Leder gebrannt und sie mit humpelndem Fuß über den Zaun springen und jämmerlich miauen gehört.
Der Schäfer aber, der hinter dem Garten eben mit den Schafen vorbei trieb, als der Mantheysche Schuß fiel, hat erzählt, es sei neben ihm ein altes Weib über den Weg hingehinkt, die habe jämmerlich gewinselt und geheult, und sie habe ihm geklagt, des Krügers großer Hund habe ihr den Fuß blutig gebissen. So sei sie über die Zudarsche und Schoritzer Heide fort gehumpelt, und man habe ihr Gewinsel noch lange aus der Ferne hören können. Und das war wirklich die Thrin aus Günz gewesen; der Pastor hatte ihr das linke Bein durchschossen.
Dieser geistliche Schuß gab einen großen Glückswandel. Thrin lag wohl ein Vierteljahr elend im Bette; dann sah man sie wieder, aber sie humpelte mit einem lahmen Bein und erzählte den Leuten, sie sei beim Äpfelschütteln vom Baum gefallen und habe sich dabei das Bein verrenkt. Nun ging es ihr aber schlimm. Weil sie nicht mehr so flink auf den Füßen war als sonst, so konnte sie, wann die Begier zu hexen mit plötzlicher Lüsternheit in ihr aufstieg, nicht mehr geschwind zu anderen oder zu Fremden kommen, sondern mußte ihr Eigenes behexen.
Da ward denn fast täglich irgend etwas verdreht, gelähmt oder umgebracht. Bei Tauben, Hühnern und Gänsen fing es an, und mit dem großen Vieh hörte es auf. Und wie viel der alte Jochen Wulf sie auch prügelte, das half alles nichts; die Hexenlust ist ein unauslöschlicher und unbezwinglicher Trieb.
Als also alles Federvieh verdorben oder erwürgt war, da ist die Kunst über die Ferkel und Lämmer her gefahren, darauf an die Kälber und Schafe, endlich an die Kühe und Pferde. Der Bauer hat nun immer wieder neues Vieh kaufen müssen, und in solcher Weise ist in ein paar Jahren der Reichtum vergangen und das ungerechte Teufelsgut zerronnen. Ja, ihr eigenes, einziges Kind hat sie zum Krüppel hexen müssen; und der alte Wulf ist aus Angst, daß ihm zuletzt ähnliches widerfahren möge, in die weite Welt gegangen und ist auf immer ein verschollener Name geblieben.
Einige erzählen aber, die Thrin habe ihn verwandelt und habe wegen seiner Sünde die Macht dazu gehabt, weil der alte Schelm um ihre Hexerei gewußt und die Früchte davon gehehlt und mitgenossen habe; und so müsse er nun als ein greulicher Werwolf rund laufen und die alten Weiber und Kinder erschrecken.
Die Thrin aber sei nach der Flucht des Wulf als eine arme Bettlerin aus der Wehr geworfen und habe zuletzt in Puddemin gewohnt, sei aber zuzeiten immer noch hin und wieder als eine lahme Katze oder Füchsin umgegangen oder habe als eine lahme Elster auf Bäumen und Dächern herum gehüpft; endlich aber sei sie vor das Gewehr eines Freischützen geraten, wodurch die Katzengestalt für immer fest gemacht worden.
So haben viele Leute sie öfter als eine wilde, graue Katze an dem Günzer Teiche sitzen gesehen, auch als kein Haus mehr da stand; auch haben andere es dort um die Mitternacht häufig miauen und prusten und pfuchsen gehört, daß ihnen vor Grauen die Haare zu Berge standen.
Sage von Ernst Moritz Arndt
DIE ALTE BURG BEI LÖBNITZ ...
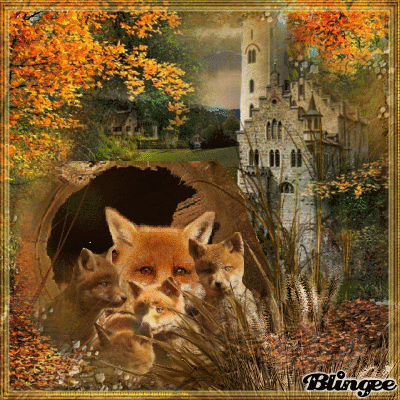
Nahe bei Löbnitz über grünen Wiesen, wodurch sich das Flüßchen Barth hinschlängelt, grünt ein kleiner Eichenwald mit einem durchrinnenden Bächlein und den schönsten und dichtesten Haselbüschen, welche sich fast jeden Herbst unter dem braunen Schmuck ihrer Früchte beugen.
An der Südseite des Wäldchens liegt eine Ziegelei, und am nördlichsten Ende erhebt sich eine Burghöhe, deren Umwallung ringsum eine Senkung umgibt, in welcher die elegischen und zauberischen Sträucher Kreuzdorn und Hagedorn, Holunder und Alf-Ranke, Nessel und Nachtschatten sich festgesiedelt hatten und dem Andringer das Aufsteigen fast schwer machten; auch hatten die Füchse sich den Wall und sein altes Gemäuer zu ihren unterirdischen Wohnungen durch miniert.
Dieser alten Burg gegenüber erhob jenseits am rechten Ufer des Flusses unweit Wobbelkow ein stattliches Hünengrab sein grün bemoostes Haupt, von dessen Gipfel man die Stadt Barth mit ihren roten Dächern und in der Landschaft umher ein halbes Dutzend Kirchtürme und ein halbes Hundert Höfe und Dörfer überschauen konnte. Dieses Eichwäldchen ward nach den Trümmern jener Burg gewöhnlich nur zur alten Burg genannt.
Hier hatte sich nun ein Abenteuer begeben, welches durch alle Münde und Mäuler der Menschen die Runde machte: Eine junge, hübsche Dirne, welche die Kühe des Zieglers im Busche hütete, war plötzlich verschwunden oder entlaufen, und da geschah es, daß die Stimmen der Sage sich wieder aufweckten, die oft verschollen ihre Zeit träumt und schläft und dann mit doppelter Lebendigkeit wieder in die Ohren der Menschen tönt. Und in folgender Weise war die Erzählung des Gärtners Christian Benzin:
»Herr, sie sagen so was von der Dirne des Zieglers, die vor vierzehn Tagen am hellen scheinenden Mittag verschwunden und nicht wiedergekommen ist. Die Leute munkeln, und des alten Schweden Sturbergs Jungen aus Wobbelkow, die einem Kalbe nachgelaufen, haben es gesehen: Ein Matrose in bunter, rot gestreifter Jacke ist mit ihr am Saum des Waldes spazieren gegangen und hat einen Blumenstrauß in der Hand gehabt, und sie glauben, der habe sie weg gelockt und mit sich auf sein Schiff genommen.
O du Herr Jemine! Das Schiff, worauf die Dirne fährt! Soviel ist wahr, den Buntjack werden die Sturbergsjungen wohl spazieren gesehen haben, aber meiner Sie so weit, als die dummen Leute sich einbilden, ist sie nicht unter Segel gegangen. Ich weiß wohl, wo sie sitzt, und Jochen Eigen, den sie immer den Edelmann schelten, weiß es wohl noch besser, aber der schämt sich und sagt's nicht und verrät nichts von seinen Hausheimlichkeiten, als wenn er mal ein wenig zu tief ins Glas geguckt hat.« Und bei diesen Worten machte der Gärtner Christian eine gar absonderliche und verwunderliche Miene.
»Nun, Benzin, nur her mit Euren Geschichten! Jetzt, hoffe ich, wird's einmal wohl ans Licht kommen, warum Ihr bei dem Namen alte Burg immer so wunderliche Reden und Gebärden braucht. Hier muß es irgendwo stecken, daß Ihr auf der Jagd nie in diesen Busch hinein wollt und mit leichten, diebischen Katzentritten an seinem Rande umherschleicht oder Euch in gehöriger Entfernung Eure Stelle anweisen laßt.
Darum habt ihr, als die schönen Mamsellen aus Barth jüngst dahin Nüsse pflücken gingen und noch andere hübsche junge Frauen mitgehen wollten, so wunderliche Gesichter geschnitten und sie in den Löbnitzer Wald auf den Kamp zu laufen verlockt, wo man unter den Pfriemenbüschen wohl Hasen und Füchse aufjagen, aber keine Nüsse schütteln kann. Es muß was Besonderes mit diesem Busche sein. Und nun heraus damit! Ich lasse Euch diesmal nicht los.«
»Ja, Herr, dies ist Euch ein Busch! hier ließe sich viel erzählen, und wer eine hübsche Frau und schöne Tochter hat, der lasse andere Weiber in diesen Busch Nüsse pflücken gehen. Ich sage nur soviel: wie manche hübsche Jungfer würde ihr Herzleid zu erzählen haben, wenn sie sich nicht schämte! Ich erinnere mich noch, mein Vater hat mir's erzählt, - es sind wohl ein paar Stiege Jahre her - da waren ein paar schöne Jungfern aus Barth gekommen Nüsse zu pflücken, und sie sind hier im Wäldchen verschwunden.
Man hat die Verschwundenen tage- und wochenlang gesucht, wie man Stecknadeln sucht, bei Sonnenlicht und Laternenlicht, aber keine Spur von ihnen gefunden, kein Mensch hat sie wiedergesehen. Mein Vater sagt, es sei große Wehklage und Trauer um sie gewesen - denn es waren Kinder ehrsamer und reicher Leute - und zuletzt in Kentz und Starkow und in allen Kirchen umher mit den Glocken um sie geläutet, als hätte ein Wolf oder Bär sie gefressen.
Aber deren gibt's hier nicht; ich weiß wohl, wer der Wolf ist. Und doch hat sich's wunderlich genug offenbart: sie waren nicht von wilden Tieren aufgefressen, sondern nach acht bis zehn Jahren von Vergessenheit und Verschollenheit sind sie mit einem mal noch ganz frisch und blank wieder unter den Lebendigen aufgetreten und haben sich nichts merken lassen.
Aber die Leute haben doch eine Art Grauel vor ihnen angewandelt und haben ihrer Jungferschaft nicht recht getraut, und die armen hübschen Mädchen haben zuletzt als alte Jungfern sterben müssen.
Und nun will ich erzählen, was Jochen Eigen mir erzählt hat, der diese Geschichten am besten weiß; aber er wird sich hüten sie dem Herrn zu erzählen. Und dann wird der Herr verstehen, warum ich hübsche junge Frauen und Mädchen nicht so leichtfertig in den Wald laufen lassen will, und warum ich neulich krank ward, als ich die Nacht bei dem Fuchsbau am Burgwall, wo sie gegraben hatten, Schildwache stehen und die jungen Füchse, wenn sie etwa heraus wollten, zurücktreiben sollte.
Vor langen, langen Jahren war Jochen Eigens Urgroßvater*, ein prächtiger, stolzer Edelmann, so prächtig und steinreich, daß er den Zaum seines Pferdes mit Juwelen besetzte und in einem goldnen Steigbügel saß. Dieser hatte im Lande Rügen und auch hier im Pommerlande viele schöne Höfe, Wälder und Bauern, so viele, daß man sie nicht zählen konnte - ein prächtiger, stolzer Mensch, der mit sechsen vom Bock fuhr, einen Läufer vor sich herlaufen und seine Pferde in langen Strängen springen ließ.
Aber es war ein wilder, verwegner Mensch, der nichts von Gottes Wort und Wegen wissen wollte, ein toller Jäger und Reiter und ein greulicher Weiberjäger, der wie der Falk auf die Tauben, auf die schönen Dirnen lauerte.
Diesem Eigen hat in jenen alten Zeiten auch Löbnitz und Diwitz und Wobbelkow gehört, und hier bei Löbnitz hat er im Walde ein prächtiges Burgschloß gehabt mit vielen Türmen und Fenstern, wo er manche schöne Nacht durchschwärmt und durchtrunken und mit seinen lustigen Gesellen bei Wein und Weibern bankettiert hat.
Und dort auf dem hohen Hünengrabe an dem anderen Ufer, dort am Wege zwischen Redebas und Wobbelkow, hat er sich ein prächtiges, aus eitel gehauenen demantenen Steinen gebautes Lustschloß hingestellt. Da ist er oft hin galoppiert und hat dort gesessen und mit einem Kieker auf die Landstraßen umher ausgeschaut, ob seine wilden Lauscher und Räuber, die er ausgeschickt hatte, schöne Weiber einzufangen, nicht irgendwo mit Beute heransprengten.
Diese armen Gefangenen haben sie dann bei nächtlicher Weile, wo andere gute Christenleute schlafen, auf die Burg im Walde geschleppt und dort versteckt, daß weder Hund noch Hahn danach gekräht hat. So hat der böse Mensch sein wildes, verruchtes Wesen viele lange Jahre getrieben, und Gott hat ihm manchen Tag die Zügel schießen lassen.
Das lag aber in seinem Blute, und Jochen, dem der Edelmann lange vergangen sein sollte, dessen Großvater schon ein armer Weber gewesen - der Herr glaubt nicht, was die alten Leute von dem zu erzählen wissen, wie grausam der in seinen jungen Jahren auf die hübschen Dirnen gejagt hat. Er will sich's nun nur nicht mehr merken lassen, aber diese lüsternen Edelmannstücken hat er noch genug in sich.
Endlich aber ist doch des alten wilden Jägers Tag gekommen, es ist Krieg geworden, und Pest und Hunger und Moskowiterzeit und Kalmückenzeit, ich weiß den Namen nicht recht, aber eine grausame böse Zeit ist gekommen, und da ist jener Bösewicht auch von seinem Jammer gefaßt worden: seine Schlösser und Häuser verbrannt, seine Scheunen und Speicher ausgeleert, sein Vieh weggetrieben.
Da hat er sich zuletzt hier in die Burg bergen und verstecken und knapp leben lernen müssen wie andere arme Leute. Da ist seine Rechnung bei dem höchsten und obersten Rechenmeister übervoll gewesen, und er hat ihn mit seinem Blitz geschlagen und sein prächtiges Sündenhaus angezündet, und er und seine Weiber sind alle zu weißen Aschen verbrannt, und von der ganzen Herrlichkeit, wo sonst Geigen und Trompeten klangen und Tag und Nacht bankettiert ward, liegen noch kaum ein paar Steine da, und nun sind die Füchse und Marder und Eulen die einzigen Nachtmusikanten.
Sage von Ernst Moritz Arndt
VOM KLEINEN TEUFELCHEN UND VOM MUFF, DER KINDER KRIEGTE ...
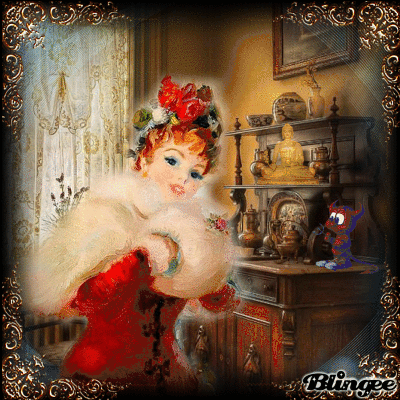
Ich will euch eine Nacht aus dem Leben eines Dichters erzählen. Das Leben eines Dichters ist anders als das Leben der anderen Menschen. Es sind andere Tage und andere Nächte - und meist sind sie traurig. Es sind auch schöne Tage und schöne Nächte darunter, Tage voll Sonne und Nächte voll Rosen. Aber davon will ich heute nicht erzählen, denn das sind keine Märchen für Kinder. Und heute seid ihr alle Kinder im Märchenland, die ihr dieses Buch lest.
Ich will euch heute von einer Nacht erzählen, wie sie ein Dichter oft erleben kann - die ist weder besonders schön, noch besonders traurig, sie ist nur sehr vergnügt und ganz, ganz anders als die anderen Menschen sich das denken. Ihr müsst aber alles glauben, was ich euch sage, denn was ich euch erzähle, ist ein richtiges Märchen und alle Märchen sind wahr und wirklich. Man kann sich das gar nicht ausdenken.
Nur der Teekessel in meinem Zimmer denkt, dass es keine Märchen gibt und dass ich mir das alles ausdenke, und so wie der Teekessel denken sehr viele Menschen. Seid also nicht so, wie der Teekessel, wenigstens heute nicht. Damit ihr nun wisst, wie ihr nicht sein sollt, will ich euch sagen, wie mein Teekessel ist.
Er ist dick und groß und von glänzendem Kupfer. Er hat eine große Schnauze und es ist gar nichts in ihm drin, denn er wird schon lange nicht mehr benutzt. Er tut nichts und auf seinem kupfernen Leibe setzt sich ein feiner grüner Ton an, den die Gelehrten Patina nennen und der sehr vornehm ist. Er hat auch eine schöne Linie, und zwar gerade bei der Schnauze. Bloß Feuer hat er nicht mehr in sich. Findet ihr nicht auch, dass viele Leute so sind wie mein Teekessel?
Also die Sache ging so an, dass ich in meinem Bett lag und an gar nichts dachte. Ich wollte gerne schlafen, aber der Mond schien zum Fenster herein, besah sich in meinem Spiegel und behauptete, ich habe jetzt kein Recht zu schlafen, ich solle lieber aufpassen. Das tat ich denn auch und das erste, was ich sah, war ein kleines Teufelchen, das auf meinem Bettrand saß und Turnübungen machte.
Es war ein sehr niedliches kleines Teufelchen, sozusagen ein Teufelchen in den besten Jahre, so groß als ein Zeigefinger, und es hatte einen sehr langen Schwanz - alles ganz schwarz natürlich. Nur ein Ohr war rot - es hatte überhaupt nur ein Ohr und das war dafür auch rot. Recht hatte es! Warum soll man zwei Ohren haben? Das ist ganz überflüssig, und außerdem ist es Geschmackssache.
"Ich komme gerade aus der Hölle" ,sagte das Teufelchen und turnte. - "Das ist mir gleichgültig" ,sagte ich, "ich habe schon viele schöne Hexen gekannt. Da stört mich ein kleines Teufelchen gar nicht, auch wenn es eben aus der Hölle kommt und turnt." Das Teufelchen machte Kopfsprung und schlug den Schwanz graziös um die Beine.
"Ich habe auch eine Tante, die hexen kann" ,sagte es, "meine Tante nimmt nichts dafür, sie tut es aus lauter Liebe zur Sache." - "Die Hexen, die ich kannte, waren nicht meine Tanten" ,sagte ich, "aber das ist ja einerlei."
Das Teufelchen erwärmte sich bei der Unterhaltung, wenn man überhaupt sagen kann, dass sich jemand erwärmt, der aus der Hölle kommt, wo es ja an sich schon sehr warm ist. "Ich habe auch einen Onkel" ,sagte das Teufelchen eifrig, "mein Onkel röstet die sündigen Seelen. Er röstet sie so lange, bis sie ganz knusprig sind." -
"Pfui" ,sagte ich, "Sie haben ja eine scheußliche Verwandtschaft. Im übrigen will ich Ihnen etwas sagen: Halten Sie Ihren Schwanz ruhiger, wenn Sie turnen. Sonst werden Sie sich den Schwanz noch einmal klemmen. Sie sehen, ich gebe Ihnen noch gute Ratschläge, obwohl Ihr Herr Onkel andere Leute röstet, bis sie knusprig sind."
Das kleine Teufelchen zog den Schwanz ein und schämte sich. "Ich habe auch sehr nette Verwandte" ,sagte es, "meine Schwester, die schleicht sich unter die Liebespaare der Menschen und setzt ihnen Dummheiten in den Kopf. Dann kommen sie nachher in die Hölle." Das Teufelchen rieb sich die Hände vor Vergnügen.
"Seien Sie nicht so albern" ,sagte ich. "Wenn zwei sich lieben, dann kommen sie nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Und die Dummheiten haben sie auch so schon im Kopf - die braucht ihnen kein Teufelchen mehr in den Kopf zu setzen. Das weiß ich nun einmal besser als Sie.
Wenn man anfängt, von der Liebe zu sprechen, so ist das eine sonderbare Sache: es ist, als ob es heimlich Mitternacht schlägt in allen Seelen. Die Dinge sind keine Dinge mehr, es fängt alles an zu leben und es geht wie ein innerliches Weinen und wie ein innerliches Jubeln durch alles was es gibt. - Bloß durch die Teekessel nicht.
Die anderen Gegenstände aber wurden sehr lebendig. Ganz zuerst natürlich das Äffchen und die kleine Kolombine (weibliche Maskenfigur der italienischen Stegreifbühne, Gegenstück zum Harlekin), die auf meinem Tisch standen und beide aus Porzellan waren. Denn sie liebten sich schon lange - und es ist kein Wunder, dass sie gleich lebendig wurden, wie das geschwänzte Teufelchen und ich anfingen, von der Liebe zu sprechen.
Warum das Äffchen und die Kolombine auf meinem Tisch standen, werde ich euch nicht sagen, denn das ist mein Geheimnis und das geht niemand etwas an. "Mein Äffchen" ,sagte die Kolombine und küsste das Äffchen auf den Mund. Es war sehr rührend. Der strenge bronzene Buddha nebenbei lächelte. Es war ein verstehendes und verzeihendes Lächeln.
Er dachte an die schlanken Glieder der braunen Mädchen in Indien und an die Blumen in ihrem Haar. Er dachte auch an ein anderes Mädchen, das auch "mein Äffchen" sagte zu dem, den es lieb hatte, obwohl das gar kein richtiger Affe war. Aber der bronzene Buddha verstand das alles sehr gut. Nur der Teekessel verstand das nicht, denn der hatte kein Feuer im Leibe, sondern bloß eine Schnauze und die vornehme Patina.
Es geschah aber noch viel mehr, was der Teekessel nicht verstand, denn wenn man von der Liebe spricht, dann geschehen die sonderbarsten Dinge. Aus einer großen kristallenen Schale, die hinter dem Buddha stand, kamen lauter kleine kristallene Geisterchen hervor. Das waren die Kristallgeisterchen, die immer aufgeweckt werden, wenn man von der Liebe spricht.
Die kleinen Geisterchen fingen an zu tanzen und es wurden immer mehr und mehr - immer wieder kamen welche aus der tiefen kristallenen Schale hervor und erfüllten das ganze Zimmer.
Es gab einen leise singenden Ton, wenn sich die Kristallgeisterchen berührten, wie von feinen gläsernen Glocken.
Der bronzene Buddha lächelte, die kleine Kolombine sagte "mein Äffchen" und die Blumen in den Vasen neigten ihre Kelche im Mondlicht. Die Kommode sperrte vor Staunen ihren Schubladenmund ganz weit auf und das kleine Teufelchen setzte sich auf den Mund der Kommode, um besser sehen zu können. Das war doch interessanter als der Onkel in der Hölle, der die sündigen Seelen knusprig röstete, oder als die Tante, die hexen konnte.
Es war schon sehr schön und es war so schön, dass ein Muff, den ein kleines Mädchen in meinem Zimmer vergessen hatte, bis ins letzte Haar davon gerührt wurde. Warum das kleine Mädchen den Muff bei mir vergessen hatte, weiß ich selbst nicht zu sagen. Ein Muff ist ein so sehr nützlicher und auch sehr, sehr vielseitiger Gegenstand - das hatten das kleine Mädchen und ich schon oft erfahren.
Wie gefällig hatte er uns zum Beispiel die Hände gewärmt, und zwar unser beider Hände zusammen. Aber wir hatten wohl sehr viel Wichtiges miteinander zu besprechen und bei wichtigen mündlichen Verhandlungen kann man sich so sehr vertiefen, dass man sogar einen Muff vergisst.
Wie der Muff nun alle die vielen Kristallgeisterchen sah und bis ins letzte Haar gerührt wurde - er neigte so schon zur Rührung, weil er so viel erlebt hatte - da kam er auf mein Bett gekrochen, seufzte tief auf und kriegte Kinder. Lauter kleine, süße, weiche Muffkinderchen ... - Und ihr alle seid Teekessel, wenn ihr das nicht glaubt.
Der Teekessel glaubte das auch nicht und sah es auch nicht, denn er machte die große Schnauze auf und begann zu reden, lauter langweiliges Zeug von seiner vornehmen Patina, von seiner schönen Linie und dem kupfernen Leibe, in dem kein Feuer mehr war. Das war sehr schade. Denn wenn ein Teekessel mit seiner großen Schnauze zu reden anfängt, dann verkriechen sich alle die Kristallgeisterchen der Liebe und alle Märchen gehen schlafen.
Die Kristallgeisterchen gingen in die kristallene Schale zurück, aus der sie gekommen waren, der Buddha sah ernst und verdrießlich aus und nur die Kolombine seufzte noch einmal "mein Äffchen" - dann stand sie steif und still da und niemand sah mehr, wie viel Liebe und Leben sie eigentlich im Leibe hatte.
Die Kommode machte den Schubladenmund so schnell und ärgerlich zu, dass sie dem Teufelchen den Schwanz ein bisschen einklemmte. Der Muff steckte besorgt und behutsam alle die süßen, kleinen , weichen Muffkinderchen wieder in sich hinein. Denn für einen Teekessel hatte er diese Kinder nicht zur Welt gebracht!
Ich selbst aber schlief ein, denn ich weiß es aus Erfahrung, dass es unsagbar langweilig ist, wenn ein Teekessel mit seiner großen Schnauze zu reden anfängt.
Am anderen Morgen war alles so wie immer. Nur das kleine Teufelchen saß auf dem Rande meines Wasserglases und kühlte sich den geklemmten Schwanz. Da nahm ich es und steckte es ganz ins Wasser hinein. Vielleicht wäre es gut, wenn man alle die kleinen Teufelchen in kaltes Wasser steckte und sie abkühlte. Dann würde die Welt am Ende ein bisschen besser werden.
Wir wollen es aber lieber nicht tun. Denn die großen Teufel würden wir dadurch doch nicht los und ohne die kleinen Teufel würde die Welt wohl ein ganz klein wenig besser werden - aber dafür auch sehr, sehr viel langweiliger und die Leute würden am Ende alle Teekessel.
Nein, ich will das Teufelchen wieder aus dem Wasser nehmen und es dem kleinen Mädchen in den Muff setzen. Freilich wird das Teufelchen dem kleinen Mädchen dann sagen, dass es in die Hölle kommt, wenn es mich lieb hat. Aber das tut nichts. Das kleine Mädchen weiß es besser und es weiß, dass man durch die Liebe nicht in die Hölle kommt, sondern in den Himmel.
Und der Muff wird das ganz gewiss bestätigen, denn er ist oft mit uns zusammen gewesen - und er wird dem kleinen Mädchen erzählen, dass er Kinder gekriegt hat, lauter kleine, süßte, weiche Muffkinderchen. Und es schadet gar nichts, wenn er ihm das erzählt!
Manfred Kyber
HIMMELSSCHLÜSSEL ...
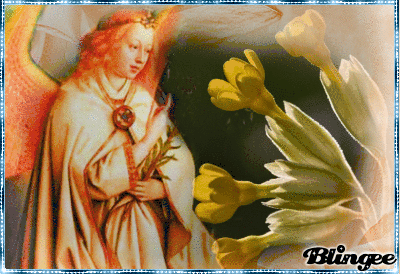
Es war einmal ein großer und gewaltiger König, der herrschte über viele Länder. Alle Schätze der Erde gehörten ihm und er trieb sein tägliches Spiel mit den Edelsteinen von Ophir (gemeint ist das sagenhafte Goldland König Salomons) und den Rosen von Damaskus. Aber eines fehlte ihm bei all seinem großen Reichtum: das waren die Schlüssel zu den Toren des Himmels.
Er hatte tausend Sendboten ausgesandt, die Schlüssel des Himmels zu suchen, aber keiner konnte sie ihm bringen. Er hatte viele weise Männer gefragt, die an seinen Hof kamen, wo die Schlüssel des Himmels zu finden wären, aber sie hatten keine Antwort gewusst. Nur einer, ein Mann aus Indien mit seltsamen Augen, der hatte die Edelsteine von Ophir und die Rosen von Damaskus, mit denen der König spielte, lächelnd bei Seite gelegt und ihm gesagt: alle Schätze der Erde könne man geschenkt erhalten, aber die Schlüssel des Himmels müsse ein jeder selber suchen.
Da beschloss der König, die Himmelsschlüssel zu finden, koste was es wolle. Nun war es in einer Zeit, zu der die Menschen noch sahen, wo der Himmel auf die Erde herab reichte und alle noch den hohen Berg kannten, auf dessen Gipfel die Tore des Himmels gebaut sind. Der König ließ sein Hofgesinde zu Hause und stieg den steilen Berg hinauf, bis er an die Tore des Himmels gekommen war. Vor den Toren, um deren Zinnen das Sonnenlicht flutete, stand der Engel Gabriel, der Hüter von Gottes ewigem Garten.
"Glorwürdiger" ,sagte der König, "ich habe alle Schätze der Erde, viele Länder sind mir untertan und ich spiele mit den Edelsteinen von Ophir und den Rosen von Damaskus. Aber ich habe keine Ruhe, ehe ich nicht auch die Schlüssel zum Himmel habe. Denn wie sollten sich sonst einmal seine goldenen Tore für mich öffnen?" -
"Das ist richtig" ,sagte der Engel Gabriel, "ohne die Himmelsschlüssel kannst du die Tore des Himmels nicht öffnen und wenn du auch alle Künste und Schätze der Erde hättest. Aber die Himmelsschlüssel sind ja so leicht zu finden. Sie blühen in lauter kleinen Blumen, wenn es Frühling ist, auf der Erde - und in den Seelen aller Geschöpfe."
"Wie?" ,fragte der König erstaunt, "Brauche ich weiter nichts zu tun, als jene kleine Blume zu pflücken? Die Wiesen und Wälder stehen ja voll davon und man tritt darauf auf all seinen Wegen." -
"Es ist wahr, dass die Menschen die vielen Himmelsschlüssel mit Füßen treten" ,sagte der Engel, "aber so leicht wie du es dir denkst, ist es doch nicht gemeint. Es müssen drei Himmelsschlüssel sein, die dir die Tore des Himmels aufschließen. Und alle drei sind nur dann richtige Himmelsschlüssel, wenn sie zu deinen Füßen und für dich aufgeblüht sind. Die vielen tausend anderen Himmelsschlüssel, die auf der Erde stehen, sollen die Menschen nur daran erinnern, die richtigen Himmelsschlüssel zum Aufblühen zu bringen - und das sind die Blumen, die alle Menschen mit Füßen treten."
In dem Augenblick kam ein Kind vor die Tore des Himmels, das hielt drei kleine Himmelsschlüssel in der Hand und die Blumen blühten und leuchteten in der Hand des Kindes. Als nun das Kind die Tore des Himmels mit den drei Himmelsschlüsseln berührte, da öffneten sich die Tore weit vor ihm und der Engel Gabriel führte es in den Himmel hinein.
Die Tore aber schlossen sich wieder und der König blieb allein vor den geschlossenen Toren stehen. Da ging er nachdenklich den Berg hinunter auf die Erde zurück - und überall standen Wiesen und Wälder voll der schönsten Himmelsschlüssel. Der König hütete sich wohl sie zu treten, aber keine der Blumen blühte zu seinen Füßen auf.
"Sollte ich die richtigen Himmelsschlüssel nicht finden" ,fragte sich der König, "wo ein Kind sie gefunden hat?" Aber er fand sie nicht und es vergingen viele Jahre. Da ritt er eines Tages mit seinem Hofgesinde aus und ein schmutziges verwahrlostes Mädchen, das weder Vater noch Mutter hatte, bettelte ihn an, als er mit seinem glänzenden Gefolge an ihm vorüber kam.
"Mag es weiter betteln!" ,sagten die Höflinge und drängten das Kind bei Seite. Der König aber hatte in all den Jahren, seit er von dem steilen Berg gekommen war, viel über die Himmelsschlüssel nachgedacht und trat sie nicht mehr mit Füßen. Er nahm das schmutzige Bettelkind, setzte es zu sich aufs Pferd und brachte es nach Hause. Dort ließ er es speisen und kleiden, er pflegte und schmückte es selbst und setzte ihm eine Krone auf den Kopf.
Da blühte zu seinen Füßen ein kleiner goldener Himmelsschlüssel auf. Der König aber ließ die Armen und die Kinder in seinem Reich als seine Brüder erklären. Wieder vergingen Jahre und der König ritt in den Wald mit seinem Hofgesinde. Da erblickte er einen kranken Wolf, der litt und sich nicht regen und helfen konnte. "Lass ihn verenden!" ,sagten die Höflinge und stellten sich zwischen ihn und das elende Tier.
Der König aber nahm den kranken Wolf und trug ihn auf seinen Armen in seinen Palast. Er pflegte ihn selbst gesund und der Wolf wich nie mehr von ihm. Da blühte ein zweiter goldener Himmelsschlüssel zu des Königs Füßen auf. Der König aber ließ von nun an alle Tiere in seinem Reich als seine Brüder erklären.
Wieder vergingen Jahre - aber nun schon nicht mehr eine so lange Zeit, wie sie vor dem ersten Himmelsschlüssel vergangen war - da ging der König in seinem Garten umher und freute sich an allen den seltenen Blumen, die, kunstverständig gehütet und gepflegt, seinen Garten zu einem der herrlichsten in allen Ländern machten.
Da erblickte der König eine kleine unschöne Pflanze am Wegrand, die am Verdursten war und die verstaubten Blätter in der sengenden Sonnenglut senkte. "Ich will ihr Wasser bringen" ,sagte der König. Doch der Gärtner wehrte es ihm. "Es ist Unkraut" ,sagte er, "und ich will es ausreißen und verbrennen. Es passt nicht in den königlichen Garten zu all den herrlichen Blumen."
Der König aber nahm seinen goldenen Helm, füllte ihn mit Wasser und brachte es der Pflanze - und die Pflanze trank und begann wieder zu atmen und zu leben. Da blühte der dritte Himmelsschlüssel zu des Königs Füßen auf und das Bettelmädchen mit der Krone und der Wolf standen dabei. Der König aber sah auf dem steilen Berge die Tore des Himmels weit, weit geöffnet - und im Sonnenlicht, das um die Zinnen flutete, sah er den Engel Gabriel und jenes Kind, das damals schon den Weg zum Himmel gefunden hatte.
Die drei Himmelsschlüssel blühen heute noch und sie leuchten heute noch heller und schöner als alle Edelsteine von Ophir und alle Rosen von Damaskus.
Manfred Kyber
MUMMELCHEN ...

Es war einmal eine schöne kleine Nixe, die hieß Mummelchen und lebte im Mummelteich. Mummelchen fühlte sich immer so sehr einsam im Mummelteich, denn der Mummelteich war recht sumpfig und alle, die darin herumkrabbelten, waren sehr versumpft und scheuten sich beinahe schon vor dem klaren Wasser.
Sonst waren ja auch ganz nette Leute darunter, zum Beispiel die Froschvettern, die abends so schön sangen und auch stets von ausgesuchter Höflichkeit waren. Die Unken waren dicke alte Tanten, die es gut meinten, aber immer, wenn sie Mummelchen sahen, so unkten sie sie an und rieten ihr, doch endlich auch einen richtigen anständigen Kraken zu heiraten und mit ihm ins Meer hinauszuschwimmen, so wie es ihre Schwestern getan hatten.
Das war so langweilig, denn wenn auch Mummelchens Schwestern alle so richtige und anständige Kraken geheiratet hatten - Mummelchen selbst hatte gar keine Lust dazu. Sie sehnte sich nach etwas ganz anderem, nur wusste sie selbst nicht recht, wonach sie sich eigentlich sehnte. Und niemand im ganzen Sumpf wusste es, weder die Froschvettern noch die Unkentanten und nicht einmal die Seerosen, die immer träumten und mit offenen Kelchen das silberne Mondlicht tranken.
Aber eines Nachts, als Mummelchen mitten unter den Seerosen saß, da schienen die Sterne am Himmel so klar und spiegelten sich im Mummelteich, so dass es aussah, als wäre die ganze gestirnte Nacht in den See versunken. Denn die Sterne scheinen in jeden Sumpf und es ist nicht ihre Schuld, wenn es die Unken nicht merken.
Mummelchen aber hatte die Augen, die die Sterne sehen, und wie sie die vielen Sterne sah, da wusste sie mit einem Male, wonach sie sich immer gesehnt hatte: Sie wollte eine Seele haben, darin sich auch die ewigen Sterne spiegeln könnten. Was eine Seele war, wusste sie freilich noch nicht genau zu sagen, aber das hätte sie ja auch erst gekonnt, wenn sie eine gefunden hätte. Sie sagte sich auch, dass es gewiss sehr schwer sein würde, eine Seele zu finden, aber versuchen wollte sie es jedenfalls.
Wenn Sie nur jemand nach dem Weg zu einer Seele hätte fragen können - sie war ja eine so unerfahrene junge Nixe und wusste gar nicht Bescheid mit solchen Dingen. Aber die Froschvettern hätten ihr nur Höflichkeiten gesagt und die Unkentanten hätten ihr wieder geraten, endlich einen anständigen Kraken zu heiraten. Da beschloss Mummelchen, den alten Quabbelonkel zu fragen, denn er war die älteste und klügste Person im ganzen Sumpf - und wenn der es nicht wusste, dann konnte es gewiss niemand wissen.
So stieg denn Mummelchen in den tiefsten Sumpf hinab und da saß der Quabbelonkel und aß Miesmuscheln. Der Quabbelonkel war so eine Art Gallertkugel mit Froschbeinen und Krötenärmchen. Sein ganzer Körper war mit Miesmuscheln bedeckt, die auf ihm wuchsen und die er sich absuchte und verspeiste.
So hatte er seine Nahrung immer bei sich, Er hatte ganz kleine geschickte Äuglein im Quabbelkopf, aber dafür war sein Mund so ungeheuer groß, dass er mit der Mitte seines Mundes sprechen, in der einen Ecke eine Miesmuschel hineinstecken und aus der anderen Ecke die Schalen wieder ausspucken konnte. Und das konnte er alles gleichzeitig.
"Onkel Quabbel" ,sagte Mummelchen, "ich möchte dich gerne etwas fragen." - "Ich weiß schon" ,sagte der Quabbelonkel, "du hast schon wieder Sehnsucht und weißt nicht, wonach. Aber mir ist es nun eingefallen, wonach du dich immer sehnst. Du sehnst dich nach mir, mein liebes Mummelchen." Und der Quabbelonkel lachte, dass sein ganzer Gallert ins Schwanken geriet und die Miesmuscheln an seinen Beinen klapperten.
"Nein" ,sagte Mummelchen, "nach dir sehne ich mich nicht. Dich habe ich ja auch immer da und brauche dazu nur in den tiefen Sumpf hinunterzusteigen. Aber ich weiß jetzt, wonach ich mich sehne." "So," sagte der Quabbelonkel, "dann setze dich auf meinen Schoß und erzähle es mir." - "Auf deinen Schoß kann ich mich nicht setzen, Onkel Quabbel" ,sagte Mummelchen, "du hast ja gar keinen Schoß, weil dein Bauch so groß geworden ist." -
"Ja, das ist wahr" ,sagte der Quabbelonkel und sah auf seinen Gallertbauch, "ich mache mir zu wenig Bewegung. Aber wenn ich mir Bewegung mache, dann wachsen mir die Miesmuscheln nicht mehr am Leibe und das ist so sehr bequem. Du könntest aber mal Kribbel-Krabbel auf meinem Bauch machen, das habe ich sehr gern und dann bekommen mir die Miesmuscheln auch besser."
Mummelchen schüttelte den Kopf. Sie hatte keine Lust dazu. Der Onkel war so scheußlich glitschig. "Nein, Onkel Quabbel" ,sagte sie, "ich habe keine Zeit, Kribbel-Krabbel auf deinem Bauch zu machen, du kannst die Unkentanten darum bitten. Ich muss fort von hier, denn ich muss gehen, mir eine Seele suchen." -
"Liebes Kind" ,sagte der Quabbelonkel, "bleibe lieber hier und iss Miesmuscheln. Ich will dir die fette Muschel schenken, die auf meinem linken großen Zeh sitzt." - "Nein, ich danke dir" ,sagte Mummelchen, "iss sie nur allein auf - und guten Appetit! Sage mir lieber, was ich tun muss, wenn ich eine Seele suchen will."
"Ja Kindchen" ,sagte der Quabbelonkel, "ich denke mir, wenn jemand was suchen will, wird er sich bewegen müssen. Du musst wandern. Aber ich täte es nicht, es wird dir nicht bekommen." - "Ich will wandern gehen" ,sagte Mummelchen, "denn ich sehne mich zu sehr nach einer Seele. Aber wohin muss ich wandern, um eine Seele zu suchen?" -
"Ja Kindchen" ,sagte der Quabbelonkel, "ich denke mir, du wirst wohl aus dem Sumpf heraus müssen. Wohin du dann gehst, weiß ich auch nicht. Ich bin noch nie aus meinem Sumpf herausgekommen." - "Die Sterne riefen mich, ich will den Sternen nachgehen" ,sagte Mummelchen und stieg langsam zum Spiegel des Mummelsees hinauf.
"Es kann dir nicht bekommen, Kindchen", rief der Quabbelonkel und streckte beschwörend den linken großen Zeh mit der fetten Miesmuschel aus. Aber es war zu spät. Mummelchen war ans Ufer geschwommen und wanderte durch Ried und Heide den Sternen nach.
Aber je weiter sie wanderte, um so ferner rückten die Sterne und es schien ihr, dass der Weg nach den Sternen ein sehr weiter und beschwerlicher Weg sein müsse. Und als sie müde wurde vom weiten Weg, da wurde die Nacht dunkel und die Sterne erloschen. Das geht einem jeden so, der den Sternen nachgeht.
Mummelchen war sehr erschrocken, als sie sah, dass die Sterne erloschen und es dunkel und weglos um sie herum wurde. "Aber, wenn die Sterne vom Himmel fort sind" ,dachte sie, "so sind sie sicherlich auf die Erde heruntergefallen und spielen dort verstecken. Ich werde ins Dunkel hineingehen, bis irgendwo ein Lichtlein aufloht. Dem will ich denn nachwandern und das wird sicher ein Stern sein, denn es ist doch viel zu schwer für einen Stern, sich auf der Erde zu verstecken, dass man gar nichts mehr davon sieht."
Mummelchen wusste eben nicht, dass nicht immer ein Stern vom Himmel fällt. Und sie wusste auch nicht, dass ein Stern sich gar nicht zu verstecken braucht, wenn er mal vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Es sieht ihn auch so niemand und alle Leute gehen dran vorüber, selbst wenn es ein noch so leuchtender klarer Stern ist und wenn er auch mitten auf der Gasse liegt.
Es sind die Alltagsgedanken der Menschen, die ihr graues Bahrtuch drüber decken, und darunter sind schon manche Sterne erloschen. Mummelchen hätte ja vielleicht den Stern bemerkt, weil sie kein Mensch war, aber es fiel nun mal keiner vom Himmel. Die Sterne fallen nur, wenn sie selbst wollen, und das kann ihnen niemand verdenken. So wanderte Mummelchen weiter durchs sternenlose Dunkel und ihre Füße wurden so müde und wund, wie die Füße aller werden, die den Sternen nachgehen.
Da endlich lohte ein Lichtlein auf einem hohen Berge auf und als Mummelchen näher kam, da sah sie, dass das Licht in einem großen Schlosse war, das Mauern und Türme und Erker hatte und in dem es eine Menge Prunkzimmer geben musste, denn es blitzte aus allen Fenstern heraus von Gold und Edelsteinen. "Das muss eine ganze Sternenversammlung sein" ,dachte Mummelchen und ging gerade in das Schloss hinein.
Im Schloss waren ein König und eine Königin und eine ganze Menge Lakaien und Zofen, die nur für den König und die Königin da waren. Die Lakaien des Königs waren die Würdenträger des Reiches und die Zofen der Königin waren die Frauen der Lakaien und hießen Hofdamen.
"Es ist mehr bunt als schön und eine Sternenversammlung ist es nicht, wie ich hoffte" ,dachte Mummelchen, "aber eine Seele muss ich sicher hier finden, wo so viele vornehme Menschen sind. Ich werde warten, bis die Leute näher kommen, dann will ich sie nach einer Seele fragen." Und Mummelchen setzte sich, da sie so müde geworden war, auf ein Ruhebett im Königssaal, um zu warten, bis die ganze Hofgesellschaft näher kommen würde.
Als die vielen Lakaien Mummelchen sahen, machten Sie sehr entsetzte Gesichter, aber sie sagten nichts, denn sie waren Lakaien und durften nur sprechen, wenn sie gefragt wurden. Die Königin aber, die keine Märchenkönigin, sondern eine Menschenkönigin war, ging auf Mummelchen zu und fragte sie, wer sie sei und ob sie am Ende Hofdame werden wolle. Denn die Königin war eine sehr praktische Frau und sie hatte gleich gesehen, dass Mummelchen sehr schön war.
"Bekomme ich dann eine Seele?" ,fragte Mummelchen. "Nötig ist das nicht" ,sagte die Königin und sie war sehr unangenehm berührt von einem so wenig hoffähigen Wunsche. "Dann möchte ich lieber keine Hofdame werden" ,sagte Mummelchen, "denn ich bin eine Nixe und ich suche eine Seele." -
"Pfui, wie scheußlich!" ,sagte die Königin, "Eine Nixe hat ja nasse Kleider und damit setzt sich die Person auf mein königliches Kanapee!" - "Scheußlich!" ,riefen alle Lakaien und Hofdamen. Mummelchen aber ging traurig aus dem Schloss hinaus und sie wusste nun, dass hier eine Seele nicht zu finden war.
So wanderte Mummelchen weiter, bis sie wieder ein Licht schimmern sah aus einem großen Hause mit dicken Mauern und festen Gewölben. Das Licht war sonderbar gelb und fahl und sah nicht aus, als ob es ein Stern wäre. In dem Hause lebte ein reicher Mann und zählte seine Schätze.
"Ich möchte gern eine Seele haben" ,sagte Mummelchen. "Eine Seele?" ,sagte der reiche Mann, "Ja, ich kann dir meine Seele geben, sie regt sich immer mal dazwischen, also wird sie wohl noch da sein. Nur sehr viel Geld musst du mir dafür geben." -
"Geld hat der Quabbelonkel im Mummelteich genug und übergenug" ,sagte Mummelchen, "aber solch eine Seele wie du möchte ich nicht haben. Lieber habe ich gar keine. Eine Seele muss man auch nicht kaufen, man muss sie geschenkt bekommen."
"Geschenkt wird bei mir nichts" ,sagte der reiche Mann und warf die Türe hinter Mummelchen zu. Mummelchen aber wanderte weiter, bis sie wieder ein Haus sah, in dem ein Lichtlein brannte. Das Haus war klein und das Lichtchen war noch kleiner. Es war sehr unwahrscheinlich, dass es ein Stern wäre, der vom Himmel gefallen war. Aber Mummelchen war schon so müde und traurig und so wollte sie alles versuchen und trat in das Haus ein.
Im Hause waren bloß Bücher, ganz schrecklich viele Bücher, dicke und dünne, aber meistens sehr dicke - und unter all den dicken Büchern saß ein gelehrter Mann bei einer trüben Tranlampe und las. "Was willst du hier?" ,fragte der gelehrte Mann und betrachtete Mummelchen im Licht seiner Tranlampe.
"Ich bin eine Nixe und ich suche eine Seele" ,sagte Mummelchen. "Es gibt weder Nixen noch Seelen" ,sagte der gelehrte Mann. "Ich bin aber eine Nixe" ,sagte Mummelchen und es zuckte trotzig um ihre Lippen, "ich komme gerade vom Mummelteich, wo die Froschvettern und Unkentanten leben und der Quabbelonkel."
Die Tranlampe begann zu flackern. "Es gibt keine Nixen" ,sagte der gelehrte Mann, "also bist du gar nicht da." Der gelehrte Mann las weiter, die Tranlampe brannte auch weiter und Mummelchen ging hinaus. Immer weiter wanderte sie und war nun schon sehr müde und traurig geworden. Da erblickte Mummelchen etwas Wunderbares.
Sie sah eine große Kirche mit herrlichen Spitzbogen und Türmen und das Kerzenlicht vom Altar flutete durch die bunten Fenster in die Nacht hinaus. "Das ist der Stern, den ich suche" ,dachte Mummelchen, und sie wollte in jubelnder Erwartung in die Kirche eintreten, denn nun musste sie ja sicher eine Seele finden! An der Schwelle aber stand ein Mann in einem schwarzen Gewand und fragte sie nach ihrem Begehren.
"Ich bin eine Nixe und suche eine Seele" ,sagte Mummelchen und in ihren Augen leuchtete schon der Widerschein der Kerzen am Altar. "Die Kirche ist nicht für Nixen" ,sagte der Mann im schwarzen Gewand und schloss die Tore, dass sie dröhnend zuschlugen.
Es war ganz finster und die Glocken läuteten. Da sank Mummelchen in die Knie und barg das Gesicht in den Händen. Sie war so müde und traurig und hatte keine Hoffnung mehr, eine Seele zu finden, die sie so brennend suchte. Wenn in diesem Hause mit den heiligen Kerzen nicht Gottes Sterne waren und keine Seele zu finden war, dann gab es sicher keine Seele auf der Erde und keinen Stern, der vom Himmel gefallen war.
Die Glocken läuteten und Mummelchen hörte deutlich, dass sie weinten. Aber die Glocken weinten nicht um Mummelchen, sondern um den Pfarrer in der Kirche und das tun sie schon lange. Dann hörten auch die Glocken auf zu weinen, der Himmel und die Erde waren dunkel und es war eine Finsternis, wie sie Mummelchen noch nicht erlebt hatte. Es war die Finsternis, die alle kennen, die den Sternen nachgegangen sind.
Wie Mummelchen aber die Hände von den Augen nahm und so hoffnungslos hinaus sah in die große Finsternis, da sah sie ganz nahe ein kleines Engelchen stehen. Die kleinen Engelchen sind nämlich viel näher als man denkt, man übersieht sie bloß so leicht, weil sie eben sehr klein sind. Das kleine Engelchen hielt ein Laternchen und leuchtete damit einem Dichter, der auf der roten Heide saß und Märchen schrieb. Das ist immer so, denn ein Dichter kann nur dann Märchen schreiben, wenn ein kleines Engelchen mit seiner Laterne dazu leuchtet.
"Das Laternchen ist kein Stern", dachte Mummelchen, "dazu ist es zu klein. Aber es ist doch vielleicht das Kind von einem Stern, weil ein Engelchen es in der Hand hat." Da ging Mummelchen auf den Dichter und das Engelchen zu, richtete die großen traurigen Augen auf sie und sagte: "Ich bin eine Nixe und ich möchte gerne eine Seele haben." -
"Weiter nichts?" ,fragte der Dichter, fasste Mummelchen um den schlanken Leib und küsste sie auf beide Augen. Das Engelchen aber löschte sein Laternchen aus, denn dazu brauchte es nicht zu leuchten, das wusste es schon - denn das, was geschah, war auch so ein wirkliches Märchen. Von Gottes Himmel aber fiel ein Stern und setzte sich Mummelchen ins Haar.
"Weißt du nun, dass du eine Seele hast?" ,fragte sie der Dichter und winkte dem Engelchen, dass es nicht so zugucken solle. "Ja" ,sagte Mummelchen, "jetzt habe ich eine Seele und seit du mir die Augen geküsst hast, sehe ich, dass etwas von meiner Seele in allem ist, was auf der Welt ist." - "Dann hast du eine wirkliche Seele, denn nur wer eine wirkliche Seele hat, der sieht die Seele in allem."
Es gibt viele Wege, sich eine Seele zu suchen. Einer der hübschesten ist sicherlich der, sich von einem Dichter die Augen küssen zu lassen. Es muss aber schon ein Märchendichter sein. Sonst hilft es nichts. Nur sind die Dichter darin ein bisschen einseitig. Sie küssen nämlich nur solche, die so sind wie Mummelchen und nicht wie der Quabbelonkel. Denn die Seelen küsst man nur wach in denen, die sie suchen.
Das Engelchen aber hat in dieser Nacht sein Laternchen nicht wieder angezündet ...
Manfred Kyber
DER SCHNEEMANN ...
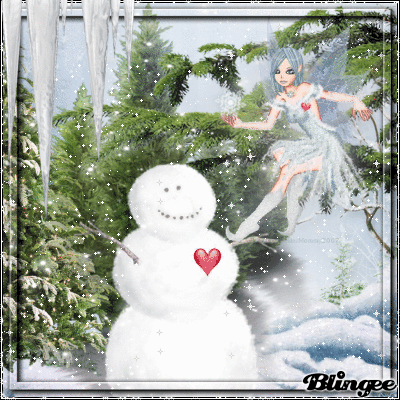
Es war einmal ein Schneemann, der stand mitten im tief verschneiten Walde und war ganz aus Schnee. Er hatte keine Beine und Augen aus Kohle und sonst nichts und das ist wenig. Aber dafür war er kalt, furchtbar kalt. Das sagte auch der alte griesgrämige Eiszapfen von ihm, der in der Nähe hing und noch viel kälter war.
"Sie sind kalt!" ,sagte er ganz vorwurfsvoll zum Schneemann. Der war gekränkt. "Sie sind ja auch kalt" ,antwortete er. "Ja, das ist etwas ganz anderes" ,sagte der Eiszapfen überlegen. Der Schneemann war so beleidigt, dass er fortgegangen wäre, wenn er Beine gehabt hätte. Er hatte aber keine Beine und blieb also stehen, doch nahm er sich vor, mit dem unliebenswürdigen Eiszapfen nicht mehr zu sprechen.
Der Eiszapfen hatte unterdessen was anderes entdeckt, was seinen Tadel reizte: ein Wiesel lief über den Weg und huschte mit eiligem Gruß an den Beiden vorbei. "Sie sind zu lang, viel zu lang!" ,rief der Eiszapfen hinter ihm her. "Wenn ich so lang wäre, wie Sie, ginge ich nicht auf die Straße!" - "Sie sind doch auch lang!" ,knurrte das Wiesel verletzt und erstaunt. "Das ist etwas ganz anderes!" ,sagte der Eiszapfen mit unverschämter Sicherheit und knackte dabei ordentlich vor lauter Frost.
Der Schneemann war empört über diese Art, mit Leuten umzugehen, und wandte sich, soweit ihm das möglich war, vom Eiszapfen ab. Da lachte was hoch über ihm in den Zweigen einer alten schneeverhangenen Tanne. Und wie er hinauf sah, saß ein wunderschönes, weißes, weiches Schnee-Elfchen oben und schüttelte die langen hängenden Haare, dass tausend kleine Schneesternchen herabfielen und dem armen Schneemann gerade auf den Kopf.
Das Schnee-Elfchen lachte noch lauter und lustiger, dem Schneemann aber wurde ganz seltsam zu Mute und er wusste gar nicht, was er sagen sollte; und da sagte er schließlich: "Ich weiß nicht, was das ist ..." - "Das ist etwas ganz anderes" ,höhnte der Eiszapfen neben ihm. Aber dem Schneemann war so seltsam zu Mute, dass er gar nicht mehr auf den Eiszapfen hörte, sondern immer hoch über sich auf den Tannenbaum sah, in dessen Krone sich das weiße Schnee-Elfchen wiegte und die langen hängenden Haare schüttelte, dass tausend kleine Schneesternchen herab fielen.
Der Schneemann wollte unbedingt etwas sagen über das eine, von dem er nicht wusste, was es war, und von dem der Eiszapfen sagte, dass es etwas ganz anderes wäre. Er dachte schrecklich lange darüber nach, so dass ihm die Kohlenaugen ordentlich herausstanden vor lauter Gedanken, und schließlich wusste er, was er sagen wollte, und da sagte er: "Schnee-Elfchen im silbernen Mondenschein, du sollst meine Herzallerliebste sein!" Dann sagte er nichts mehr, denn er hatte das Gefühl, dass nun das Schnee-Elfchen etwas sagen müsse, das war ja wohl auch nicht unrichtig.
Das Schnee-Elfchen sagte aber nichts, sondern lachte so laut und lustig, dass die alte Tanne, die doch sonst gewiss nicht für Bewegung war, missmutig und erstaunt die Zweige schüttelte und sogar vernehmlich knarrte. Da wurde es dem armen, kalten Schneemann so brennend heiß ums Herz, dass er anfing vor lauter brennender Hitze zu schmelzen; und das war nicht schön.
Zuerst schmolz der Kopf, und das ist das Unangenehmste - später geht's ja leichter. Das Schnee-Elfchen aber saß ruhig hoch oben in der weißen Tannenkrone und wiegte sich und lachte und schüttelte die langen hängenden Haare, dass tausend kleine Schneesternchen herab fielen.
Der arme Schneemann schmolz immer weiter und wurde immer kleiner und armseliger und das kam alles von dem brennenden Herzen. Und das ist so weitergegangen und der Schneemann war schon fast kein Schneemann mehr, da ist der heilige Abend gekommen und die Englein haben die goldenen und silbernen Sterne am Himmel geputzt, damit sie schön glänzen in der heiligen Nacht.
Und da ist etwas Wunderbares geschehen: Wie das Schnee-Elfchen den Sternenglanz der heiligen Nacht gesehen hat, da ist ihm so seltsam zu Mute geworden und da hat's mal auf den Schneemann herunter gesehen, der unten stand und schmolz und eigentlich schon so ziemlich zerschmolzen war. Da ist's dem Schnee-Elfchen so brennend heiß ums Herz geworden, dass es herunter gehuscht ist vom hohen Tann und den Schneemann auf den Mund geküsst hat, so viel noch davon übrig war.
Und wie die beiden brennenden Herzen zusammen waren, da sind sie alle beide so schnell geschmolzen, dass sich sogar der Eiszapfen darüber wunderte, so ekelhaft und unverständlich ihm die ganze Sache auch war.
So sind nur die beiden brennenden Herzen nachgeblieben, und die hat die Schneekönigin geholt und in ihren Kristallpalast gebracht; und da ist's wunderschön und der ist ewig und schmilzt auch nicht. Und zu alledem läuteten die Glocken der heiligen Nacht. Als aber die Glocken läuteten, ist das Wiesel wieder herausgekommen, weil es so gerne das Glockenläuten hört; und da hat's gesehen, dass die Beiden weg waren.
"Die Beiden sind ja weg" ,sagte es, "das ist wohl der Weihnachtszauber gewesen." - "Ach, das war ja etwas ganz anderes!" ,sagte der Eiszapfen rücksichtslos - und das Wiesel verzog sich empört in seine Behausung.
Auf die Stelle aber, wo die Beiden geschmolzen waren, fielen tausend und abertausend kleine weiße, weiche Flocken, so dass niemand mehr was von ihnen sehen und sagen konnte. - Nur der Eiszapfen hing noch genau so da, wie er zuerst gehangen hatte. Und der wird auch niemals an einem brennenden Herzen schmelzen und auch gewiss nicht in den Kristallpalast der Schneekönigin kommen - denn der ist eben etwas ganz anderes!
Manfred Kyber
DAS TAGEWERK VOR SONNENAUFGANG ...

Es waren eine Schmiede und ein Schmied. Der Schmied aber war ein besonderer Schmied, denn sein Tagewerk lag vor Sonnenaufgang. Das ist ein sehr hartes Tagewerk. Man wird müde und traurig dabei. Man wird still und geduldig dabei. Es gehört viel Kraft dazu. Denn man lebt einsam und schmiedet in der Dämmerung.
Jetzt war es Nacht und der Schmied war nicht in seiner Schmiede. Der Feuergeist in der Esse schlief. Nur sein Atem glomm unter der Asche und streute dazwischen einen sprühenden Funken in die Finsternis. Aber der Funke erlosch bald. Nur ein schwacher Lichtschein blieb und hastete suchend und irrend durch das Dunkel der Schmiede.
Der Blasebalg ließ seinen großen Magen in lauter griesgrämigen Falten hängen. Er sah aus wie ein dicker Herr, der plötzlich abgemagert ist. Man hätte darüber lachen können, aber in der Schmiede war niemand, der zu lachen verstand.
Der Amboss drehte einen dicken Kopf mit der spitzen Schnauze langsam nach allen Seiten und sah sich das alte Eisen an, das heute geschmiedet werden sollte. Es war nicht viel. Nur einige Stücke. Sie lagen in einer Ecke und waren beschmutzt und verstaubt, wie Leute, die eine weite und beschwerliche Wanderung hinter sich haben.
Der Amboss ärgerte sich. "Was für ein hergelaufenes Gesindel hier zusammenkommt! Ein Glück, dass es zuerst in die Esse muss, ehe es mir auf den blanken Kopf gelegt wird. Es wäre sonst zu unappetitlich. Danke bestens; unsereiner ist sauber."
Der Amboss rümpfte verächtlich die große Schnauze und kehrte dem alten Eisen den Rücken zu. Der Amboss war ein Dickkopf. Er dachte nicht daran, dass er ja auch aus Eisen war und dass das alte Eisen, das so weit gewandert war, auch so blank werden würde, wenn es der Feuergeist erfassen und der Hammer schmieden würde. Er dachte, es gäbe bloß blankes Eisen und schmutziges und bestaubtes - von vornherein - und dabei blieb es.
Er war eben ein Dickkopf und er wusste auch nicht, wie mühsam sein Meister dies alte Eisen gesammelt hatte, um es umzuschmieden in der Dämmerung. Das alte Eisen fühlte sich sehr erleichtert, als der Amboss ihm den Rücken gekehrt hatte und es seine abweisenden Blicke nicht mehr fühlte. Es hatte sie deutlich gefühlt, trotzdem es so bestaubt und so beschmutzt war. Nun begann es, sich flüsternd zu unterhalten.
Es waren Stücke, die dem Alter nach sehr verschieden waren. Es waren ganz alte dabei, die eigentlich in die Raritätensammlung gehörten. Es waren auch ganz junge darunter, die nur wenige Jahre auf
der Welt waren. Aber in ihrer Erscheinung waren sie sich alle ganz gleich.
"Sie sind so verrostet" ,sagte eine Kette teilnahmsvoll zu einem alten Schwert, "das ist eine sehr schlimme Krankheit. Sie fühlen sich gewiss nicht wohl?"
Das Schwert seufzte Knarrend zwischen Griff und Klinge. "Es ist ein altes Leiden" ,sagte es, "ich habe es schon viele hundert Jahre. Es sind Blutflecke. Ich habe schreckliche Dinge gesehen auf meinem Lebensweg. Ich ging durch viele Hände. Einer schlug den anderen mit mir. Einer nahm mich dem anderen fort, um wieder andere zu erschlagen. Alles Blut und alle Tränen haben sich in mich hineingefressen. Ich habe wenig Ruhe gehabt. Ich bin in Blut gewatet und der, der das meiste Blut vergossen, läutete die Glocken mit denselben Händen und nannte das seinen Sieg."
"Ich bin nur wenige Jahre alt" ,sagte ein junger Säbel, "aber ich habe ganz dasselbe erlebt." - "Ich habe andere Siege gesehen" ,sagte ein alter rostiger Riegel. "Ich sah Menschen, die gesiegt hatten über sich und die Welt - mit ihren Gedanken. Ich verschloss die Türe, hinter der man sie einsperrte. Sie saßen und verkamen in ihrem Kerker. Aber ihre Gedanken gingen durch die Kerkertüre an mir vorbei und gingen hinaus in alle Straßen." -
"Ich bin weit jünger als Sie" ,sagte ein anderer Riegel, "aber ich habe dasselbe tun müssen und habe dasselbe gesehen."
Der Feuergeist in der Esse atmete stärker und der erste Schein der Morgendämmerung zog über das alte Eisen. Es wurde sehr verlegen und bedrückt, denn nun traten die vielen Flecke noch deutlicher hervor, als im Licht des Feuergeistes, der in der engen Esse mühsam atmet. Das alte Eisen sah traurig auf seinen beschmutzten Körper und redete wirr und klagend durcheinander.
"Ich habe eine Mörder halten müssen" ,jammerte die Kette, "es war in seiner letzten Nacht. Neben ihm saß ein Mann im Talar und hatte ein Buch in der Hand, auf dem ein goldenes Kreuz drauf stand."
"Ich habe im Schlachthaus arbeiten müssen" ,sagte ein langes Messer. "Ich habe Tausenden von Geschöpfen ins entsetzte Auge gesehen, ehe es erlosch. Ich habe tausend Tierseelen umherirren gesehen in einem Hause voller Blut und Grauen. Dabei war ein Stück von mir früher eine Perle im Rosenkranz eines alten stillen Mannes. Es war in Indien und der alte stille Mann fegte den Weg vor sich mit schwachen Armen, um kein Geschöpf zu treten. Er nannte den Wurm seinen Bruder und bat für ihn um den Segen seiner Götter. Er sprach von der Kette der Dinge. Er zeichnete das Gebetsbild in den Sand und fingerte ergeben seinen Rosenkranz, wenn der Wind es verwehte. Die fremden Priester aus Europa höhnten den Glauben des alten Mannes."
"Wir haben jetzt Europa und seine Kultur" ,sagte der Säbel grimmig und schüttelte eine alberne goldene Troddel ab, die an ihm hing. "Wir müssen durch viele Formen wandeln" ,sagte das Messer, "das weiß ich von dem alten Mann in Indien. Nur weiß ich nicht, in welche wir kommen sollen."
"In diesen Formen können wir nicht bleiben!" ,riefen alle durcheinander. "Wir sind schmutzig und voller Flecken. Wir wollen umgeschmiedet werden. Wir wollen zum Feuergeist und um eine andere Form bitten. Aber wir wollen nicht warten, bis die Sonne aufgeht. Wir wollen nicht, dass die Sonne uns so findet. Dann bescheint sie unseren Schmutz und unsere Flecken. Aber der Schmied wird nicht so bald kommen. Er schläft gewiss noch."
Da flog ein Funke aus der Esse mitten in das alte Eisen hinein. "Der Schmied schläft nicht. Er wird gleich kommen" ,zischte der Funke, "es ist ein besonderer Schmied. Sein Tagewerk ist vor Sonnenaufgang. Dann erlosch der Funke.
Die Tür tat sich auf und der Schmied kam herein. Es war ein ernster stiller Mann mit traurigen Augen. Das kam von seinem Tagwerk. Er trat den Blasebalg, dass er alle seine Magenfalten aufklappte und ganz dick anschwoll. Der Feuergeist erwachte in der engen Esse und der Schmied hielt all das alte Eisen ins Feuer. Dann hob er es aus der Feuertaufe und legte es auf den Amboss.
"Was wird aus uns werden - welche Form - welche Form?" ,fragte das alte Eisen und das Messer dachte an den armen alten Mann in Indien.
Der Schmied schlug zu. Die Funken stoben. Er schmiedete nur eine Form, die letzte aller Formen. Er schmiedete die Seele des Eisens. Es war sein Tagewerk. Als es fertig war, stand eine glänzende Pflugschar auf der taufeuchten Erde vor der Schmiede.
Manfed Kyber
DAS MÄNNCHEN MIT DEM KOHLKOPF ...
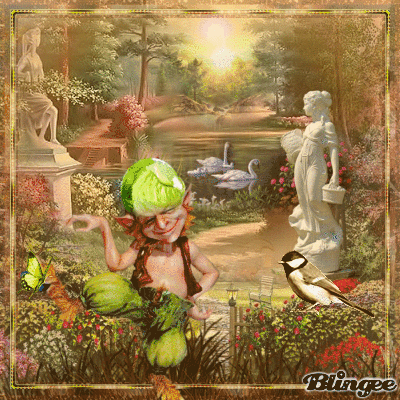
Es war in einem alten Park, in dem wilde Schwäne auf den Spiegeln dunkler Weiher ihre Kreise zogen, verblichene Marmorbilder lächelten und die Schatten vergangener Zeiten auf bemoosten Bänken saßen. In dem alten Park lebte ein kleines Männchen, das ein recht sonderbares Gewächs war, denn es war sozusagen allmählich aus allerlei Gewächsen zusammengewachsen.
Als Kopf aber hatte es einen Kohlkopf. Das Männchen war ein ganz harmloses Männchen, nur kamen so leicht die Raupen in seinen Kohlkopf, was ja bei einem Kohlkopf weiter nicht verwunderlich ist. Dann hatte es richtige Raupen im Kopf und wurde sehr anmaßend.
Es wackelte durch den ganzen Park und tadelte alles. Es fand die Kreise der wilden Schwäne hässlich, es grüßte die Regenwürmer und Käfer nicht mehr, obgleich das allgemein üblich ist, und es sagte sogar der Nachtigall nach, dass sie keine Stimme besitze und zudem eine schlechte Ausbildung genossen habe. Alles im Park ärgerte sich - nur die Marmorbilder lächelten.
Einmal nun, als das Männchen besonders viele Raupen in seinem Kohlkopf hatte, erblickte es auf dem grünen Rasen ein großes Kompottglas. Es mochte schon lange da gelegen haben, denn der Regen hatte es blank gewaschen, so dass es in der Sonne funkelte und blitzte. "Das ist eine passende Krone für mich" ,sagte das Männchen und stülpte sich das Kompottglas auf den Kohlkopf, in dem es von Raupen nur so wimmelte.
Mit dem gekrönten Kohlkopf aber wackelte das Männchen durch den ganzen Park und tadelte alles. Sogar die bescheidensten Leute des ganzen Parks, ein kleines Moosehepaar, ließ es nicht in Ruhe. Das Moosmännchen und das Moosweibchen lebten still und zurückgezogen in einer Mauerspalte. Sie störten wirklich niemand, denn sie gingen selten aus und waren überaus häuslich, fast so häuslich wie ihr Onkel, der Hausschwamm, der bekanntlich das häuslichste aller Wesen ist.
Das Moosmännchen und das Moosweibchen waren auch so genügsam. Sie kochten sich mittags nur eine Heidelbeere in einem Fingerhut und das reichte für alle beide. "Eine widerliche Völlerei" ,sagte das Männchen mit dem gekrönten Kohlkopf. "Diese einfachen Leute in der Mauerspalte tun auch tagsüber nichts weiter als Essen kochen. Was würde aus dem ganzen Park werden, wenn ich auch so wäre?"
Die armen Moosleute waren tief gekränkt. "Eine Heidelbeere für zwei Personen ist gewiss eine auskömmliche und gute Mahlzeit" ,sagten sie. "Aber eine unmäßige Mahlzeit ist es sicherlich nicht. Es ist freilich wahr, dass wir die Heidelbeere in einem Fingerhut kochen, aber das tun wir auch nur, weil wir alte Leute sind und keine rohen Heidelbeeren mehr vertragen." Mit diesen Worten, die gewiss berechtigt waren, zogen sie sich in ihre Mauerspalte zurück. Alles im Park ärgerte sich - nur die Marmorbilder lächelten.
Die Sonne hatte sich aber auch die ganze Geschichte angesehen und sie beschien nun den Kopf des Männchens Tag für Tag mit besonderer Sorgfalt. Es war, als ob es den Sonnenstrahlen geradezu Spaß mache, sich unter dem Glas zu sammeln und den Kohlkopf des kleinen Männchens zu wärmen. Die Sonnenstrahlen tun das sehr gerne.
Der Kohlkopf aber wuchs dadurch immer mehr und mehr, das kleine Männchen hörte auf alles zu tadeln und wurde stiller und stiller, bis es eines Tages mit ganz erbärmlichen Kopfschmerzen auf dem grünen Rasen saß.
"Mein Kopf schmerzt so sehr" ,jammerte das kleine Männchen, "er wird immer dicker und dicker. Er wächst und wächst und ich kriege das schreckliche Glas nicht mehr herunter! Lieber will ich ungekrönt bleiben, aber solche Kopfschmerzen möchte ich nicht wieder haben!" Sein Jammergeschrei erfüllte den ganzen Park.
Die Einwohner des Parks waren alle freundliche und gute Leute. Die Regenwürmer und Käfer krochen teilnahmsvoll näher und auch den wilden Schwänen tat es sehr leid, dass das kleine Männchen solche Kopfschmerzen hatte. Die Nachtigall war ganz still, denn sie sagte sich, dass ihr Gesang mit solchen Kopfschmerzen nicht mehr zu vereinbaren wäre. Aber helfen konnte niemand.
Endlich drang das Klagen des kleinen Männchens auch in die Mauerspalte zu den Moosleuten, die gerade bei Tisch waren und sich eine Heidelbeere im Fingerhut kochten. Sie vergaßen alle Kränkung und eilten dem kleinen Männchen zu Hilfe, so schnell sie das nur vermochten. Sie fassten das Kompottglas und zogen aus Leibeskräften daran, um den gekrönten Kohlkopf davon zu befreien. Sie zogen so sehr, dass es in ihren Mooskörpern ordentlich raschelte.
Die Regenwürmer und Käfer hielten den Atem an vor Spannung. Endlich ging es! Das Moosmännchen und das Moosweibchen fielen hintenüber, das Kompottglas blieb in ihren Händen - aber der Kohlkopf auch! "Das tut nichts" ,sagten sie, "es war ja nur ein Kohlkopf. Wir holen dem Männchen einen neuen und den setzen wir ihm dann auf." Und das taten sie.
Dem Männchen war nun wieder ganz wohl. "Ich möchte Ihnen aber doch raten" ,sagte die Nachtigall, "dass Sie sich in Zukunft die Raupen in Ihrem Kopf rechtzeitig von einem sachverständigen Vogel absuchen lassen." Das war gewiss ein sehr guter Rat und er sollte von allen befolgt werden, die es angeht.
Die verblichenen Marmorbilder lächelten, Es war ihnen nichts Neues, dass einer den Kopf verlor. Das hatten sie in vergangenen Zeiten in mancher blauen Mondnacht gesehen und es war nicht immer so harmlos abgelaufen wie dieses Mal, wo es ja nur ein Kohlkopf war. Denn es ist viel ungefährlicher, wenn es nur ein Kohlkopf ist, den man verliert, und es schadet darum auch gar nichts, wenn einer bloß einen Kohlkopf hat - aber er muss ihn nicht unter Glas setzen!
Manfred Kyber
DER GENERALOBERHOFZEREMONIEN-MEISTER ...
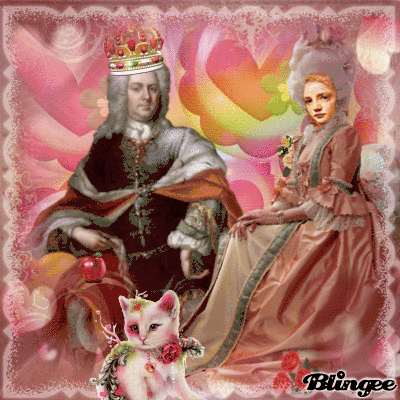
Der alte König saß auf seinem Thron und regierte. Er hatte eine Krone auf dem Kopf mit einer warmen Unterlage und an den Füßen trug er Filzpantoffeln. Es war eben schon ein alter König, der sich ein bisschen schonen musste beim Regieren, während sich die Könige ja sonst immer dabei überanstrengen. Außerdem sahen die Filzpantoffeln wirklich sehr hübsch aus, es waren alle sieben Farben darauf gestickt, denn das Land, das der alte König regierte, lag ganz weit von hier irgendwo hinter dem Regenbogen.
Der Regenbogen war das Tor, durch das man hindurchgehen musste, und darum waren seine sieben Farben die Landesfarben und die Farben auf den Filzpantoffeln des alten Königs. Ordentlich fröhliche Füße bekam man, wenn man die Pantoffeln an hatte, und der alte König war auch immer sehr fröhlich, wenn er sie anzog.
Wenn er nun so auf seinem Thron saß und regierte, dann hielt er sein Zepter in der rechten Hand und in der linken einen Reichsapfel. Das war aber kein goldener, sondern ein ganz richtiger Apfel. Der goldene Apfel war dem alten König schon lange zu schwer geworden, er musste auch jeden Tag mit Flanell abgerieben werden und das ist so umständlich.
Den richtigen Apfel aber konnte man essen und so aß der alte König eine ganze Menge Reichsäpfel, wenn er so dasaß und regierte. Er nährte sich sozusagen davon. Die Kerne aber spuckte er aus, denn die muss man niemals mitessen, weil das nicht gesund ist und ganz besonders nicht für einen alten König.
Das Land, das der alte König regierte, war nicht groß, denn hinter dem Regenbogen liegen sehr viele Länder, wie jeder weiß, der einmal dahinter gekommen ist. Also können die einzelnen Länder auch nicht so groß sein und das ist auch gar nicht nötig, denn wenn ein Land so sehr groß ist, so muss es auch einen sehr großen König haben, und die sind viel schwerer zu finden, als die großen Länder.
So war auch das Schloss des alten Königs nicht groß, aber den Thron konnte man ganz schön darin aufstellen, eine Küche war auch noch dabei und das ist doch schließlich die Hauptsache.
In der Küche wurden jeden Tag Pfefferkuchen gebacken. Früher hatte das immer die alte Königin getan und ihre Pfefferkuchen waren die schönsten in allen Ländern hinter dem Regenbogen.
Nun tat sie es schon lange nicht mehr aus dem Grunde, weil sie gestorben war. Aber sie hatte dem Staat ein großes Erbe hinterlassen: das wunderschöne Pfefferkuchenrezept und eine ebenso wunderschöne Prinzessin - und es war schwer zu sagen, welches von beiden das Schönere war.
Wenn jemand glaubt, das Schönere müsse doch allemal die Prinzessin gewesen sein, dann hat er noch niemals richtige Pfefferkuchen gegessen, und wenn jemand denkt, die Pfefferkuchen müssten das Schönere gewesen sein, dann hat er noch niemals eine richtige Märchenprinzessin geküsst!
Seitdem nun die alte Königin tot war, buk die Prinzessin die Pfefferkuchen und dann wurden es immer lauter Pfefferkuchenherzen. Der alte König fand das ein bisschen eintönig, aber die Prinzessin konnte eben nur die Herzen formen und dabei seufzte sie, besonders wenn sie die Mandeln hinein drückte.
Der alte König wäre vielleicht auch schon gestorben, aber er wollte dem Reich auch gerne ein großes Erbe hinterlassen und dafür war ihm immer noch kein Rezept eingefallen. So blieb er schon lieber einstweilen leben und regierte seine Untertanen. Er hatte drei ganze Untertanen und einen halben und von denen war einer noch dazu bloß ein Minister.
Der halbe Untertan lebte an der Grenze eines anderen Königreiches und da er niemand kränken wollte, so hatte er sich aus lauter Gefälligkeit gleichsam in zwei Hälften geteilt und jedem König eine geschenkt. Der Minister aber war der Minister des Inneren und des Äußeren. Wenn er der Minister des Inneren war, dann stellte er seine Füße einwärts, und wenn er der Minister des Äußeren war, dann stellte er sie auswärts.
Das war sehr übersichtlich und das sollte überall eingeführt werden. Aber meistens spielte er mit dem alten König Schafskopf und dann hatte er die Füße einwärts gestellt, denn das war eine innere Angelegenheit.
Das war das ganze Volk, das der alte König regierte, es war freilich noch eine Katze da, aber die ließ sich nicht regieren, denn sie war mit der Prinzessin befreundet und gab ihr gute Ratschläge. Wie nun der alte König wieder einmal auf seinem Thron saß und dazu seinen Reichsapfel aß und regierte, da kam die Prinzessin herein und sagte:
"Guten Tag." - "Guten Tag" ,sagte der alte König. "Ich habe Herzen aus Pfefferkuchen gebacken" ,sagte die Prinzessin, "und wie ich die Mandeln hinein drücke und seufzte, da ist mir etwas eingefallen. Ich werde heiraten." - "Tue das" ,sagte der alte König.
Da freute sich die Prinzessin sehr, dass es dem alten König so recht wäre, und sie fragte: "Weißt du auch, wen ich heiraten will?" - "Nein, das weiß ich nicht" ,sagte der alte König, "aber ich denke mir, dass ich das schon erfahren werde."
"Dann will ich es dir lieber gleich sagen, das ist vielleicht besser" ,sagte die Prinzessin. "Ich will unseren halben Untertan heiraten." Der alte König ließ vor Schreck seinen angebissenen Reichsapfel fallen. "Das könnte dir schon passen" , sagte er, "aber er ersetzt mir meinen halben Untertan? Wir haben so schon nicht viele. Nun willst du auch noch einen Wegekarten und wenn's auch nur ein halber ist." -
"Daran habe ich auch schon gedacht" ,sagte die Prinzessin, "aber es ist ja nur ein halber und das ist er auch nur aus lauter Gefälligkeit. Und wenn ich erst geheiratet habe, dann will ich mir auch große Mühe geben und fortwährend Kinder kriegen."
"Das wird mich sehr freuen" ,sagte der alte König, "aber wenn du so viele Kinder kriegst, so sind das alles Prinzen und Prinzessinnen und über wen sollen sie herrschen, wenn wir nur drei ganze Untertanen haben? Denn den halben heiratest du ja weg." -
"Das schadet nichts" ,sagte die Prinzessin, "dann können sie über sich selbst herrschen, das ist viel bequemer, denn man hat sich selbst doch immer gleich bei der Hand." Die Prinzessin war eben noch sehr jung! Der alte König schwieg dazu und aß seinen Reichsapfel weiter.
"Ich dachte mir, dass wir in drei Tagen heiraten" ,sagte die Prinzessin. "Früher kann ich es nicht machen, denn ich muss eine ganze Menge Pfefferkuchen zur Hochzeit backen." - "Es ist auch nicht nötig, dass du früher heiratest" ,sagte er alte König, "denn wenn du nachher fortwährend Kinder kriegen willst, so kommt es auf drei Tage früher oder später auch nicht an." -
"Ich will dann gleich gehen und Herzen aus Pfefferkuchen backen" ,sagte die Prinzessin. "Tue das" ,sagte der König. Die Prinzessin ging in die Küche, der alte König aber hörte auf zu regieren und dachte sehr stark darüber nach, womit er seiner Tochter eine Überraschung zur Hochzeit bereiten könne.
Als ihm gar nichts einfiel, ging er zur Tür und rief den Minister des Inneren und Äußeren herein, damit er ihm beim Nachdenken helfen solle. Der Minister kehrte die Füße einwärts und bedachte sich's von innen, er kehrte die Füße auswärts und bedachte sich's von außen, aber es fiel ihm auch nichts ein. Das war recht unangenehm, weil man doch nur drei Tage Zeit hatte und die Prinzessin dann schon heiraten wollte.
Da hörten sie ein Posthorn blasen, die Postkutsche kam angefahren und hielt gerade vor dem Reich des alten Königs. "Das werden Mandeln und Rosinen sein, die meine Tochter bestellt hat" ,sagte der alte König. Aber es waren keine Mandeln und Rosinen, sondern es war gerade das Gegenteil. Es war eine auswärtige Angelegenheit.
Der Postbote brachte eine gewaltig große Kiste von einem Kaiser, der über ein sehr großes Land herrschte, womit aber nicht gesagt ist, dass der Kaiser auch ebenso groß war wie das Land. Ich habe auch ganz genau gewusst, wie das Land hieß, aber ich kann mich eben nicht darauf besinnen.
Der Kaiser mit dem großen Land hatte ein großmächtiges Schreiben dazu geschrieben, worin er dem alten König versicherte, dass er ihm sehr wohlaffektioniert sei und ihm aus allerhöchste Wohlaffektioniertheit einen Generaloberhofzeremonienmeister schicke. Der wäre eine besonders große Erfindung seines großen Landes, er wäre am Kopf aufzuziehen und der Schlüssel wäre in der Kiste.
Da freute sich der alte König sehr, denn nun hatte er ja die Überraschung für die Hochzeit der Prinzessin und er schenkte dem Postboten einen Reichsapfel. Der Minister ging mit auswärts gekehrten Füßen um die Kiste herum, denn es war eine auswärtige Angelegenheit, und zwar so auswärtig, wie noch keine gewesen war.
Auf dem Deckel war ein amtlicher Stempel "Nicht stürzen!" und die ganze Kiste war von allen Seiten gehörig vernagelt. Der alte König klemmte sein Zepter zwischen die Nägel und brach den Deckel auf, er war schrecklich neugierig, was wohl darin sein möge, denn unter einem Generaloberhofzeremonienmeister konnte er sich beim besten Willen nichts denken, und ich hätte es auch nicht gekonnt.
Zuerst kam Stroh, dann noch einmal Stroh und dann kam der Generaloberhofzeremonienmeister. Der war ganz aus Blech gemacht, hatte eine herrliche bunte Uniform mit goldenen Aufschlägen, einen Orden auf dem Bauch und ein Loch im Kopf, wo man den Schlüssel hineinstecken und ihn aufziehen konnte.
Als der alte König das alles sah, musste er sehr lachen, und schrieb gleich eine Postkarte an den Kaiser in dem großen Land, auf das ich mich eben nicht besinnen kann. "Schönen Dank für deinen Generaloberhofzeremonienmeister. Er wird uns sicher viel Spaß machen - und wenn meine Tochter heiratet, wollen wir ihn aufziehen." Die Postkarte warf er sogleich selbst in den Briefkasten, der am Regenbogen hing.
Der alte König und der Minister, der jetzt nur noch Minister des Äußeren war, packten nun den Generaloberhofzeremonienmeister aus all dem vielen Stroh heraus und stellten ihn auf die Beine. Da sahen sie, dass er einen ganz krummen Rücken hatte. "Das kommt vom langen Liegen in der Kiste" ,sagte der alte König. "Es wird sich schon wieder geben." -
"Das glaube ich nicht" ,sagte der Minister. "Mir scheint überhaupt, dies ist eine ganz besonders auswärtige Angelegenheit." - "Vielleicht wird es besser, wenn man ihn aufzieht" ,sagte der König und steckte den Schlüssel in seinen Schlafrock. "Aber wir wollen ihn erst aufziehen, wenn die Prinzessin Hochzeit feiert." - "Ich will ihn dann so lange in die Ecke stellen" ,sagte der Minister des Äußeren. "Tue das" ,sagte der alte König.
Als nun die drei Tage um waren und die Prinzessin Hochzeit feiern wollte, da schien der Regenbogen besonders schön und im ganzen Lande duftete es nach Pfefferkuchen. Der Minister des Inneren und des äußeren versammelte erst sich selbst, weil er doch gleichsam zweimal da war, und dann versammelte er die zwei anderen Untertanen, die noch übrig waren, und alle gratulierten und bekamen Pfefferkuchen.
Der halbe Untertan aber saß bei der Prinzessin und küsste sie und auf ihrem Schoß saß die Katze, die sich nicht regieren ließ, und gab der Prinzessin gute Ratschläge für die Ehe. Besonders riet sie ihr, sie solle es auch so machen wie die Katze und sich auch nicht regieren lassen. Und das versprach die Prinzessin zu tun.
Der alte König saß auf seinem Thron und freute sich. Er hatte sein Zepter in der einen Hand und in der anderen den Reichsapfel, aber diesmal den goldenen und er hatte alles mit Flanell abgerieben, so dass es glänzte. Den Schlafrock und die Filzpantoffeln hatte er auch an und es war wirklich sehr schön.
"Das Schönste kommt aber noch, das ist eine Überraschung" ,sagte der alte König und holte den Generaloberhofzeremonienmeister aus der Ecke. Er steckte ihm den Schlüssel in das Loch im Kopf und zog ihn auf. Im Kopf gab es nur ein schwächliches Geräusch, aber die Wirkung war eine sehr spaßhafte, so dass alle sehr lachen mussten.
Der Generaloberhofzeremonienmeister verbeugte sich und verbeugte sich, und da er an sich schon einen krummen Rücken hatte, so verbeugte er sich so tief, wie das ein richtiger Mensch gar nicht fertig bekommen hätte. Die Prinzessin fand ihn auch sehr komisch. Aber als er gar nicht aufhören wollte, sich zu verbeugen, da kriegte sie es satt.
"Steht doch einmal gerade!" ,rief sie. Doch der Generaloberhofzeremonienmeister verstand das nicht, denn das hatte noch niemals jemand zu ihm gesagt und er konnte es ja gar nicht verstehen, weil er eine Puppe war mit einer Uniform und mit einem Orden auf dem Bauch.
Da ärgerte sich die Prinzessin sehr, denn es war eine Märchenprinzessin. Und sie stand auf, gab dem Generaloberhofzeremonienmeister einen tüchtigen Puff in den Rücken und bog ihn gerade. Da aber gab es einen Knacks und der Generaloberhofzeremonienmeister war kaputt. Der alte König bemühte sich, ihn wieder aufzuziehen, aber es war nichts mehr zu machen. "Es ist eigentlich schade um ihn" ,sagte der alte König, "er war so sehr komisch." -
"Es schadet gar nichts" ,sagte die Prinzessin, "zuerst muss man ja lachen, aber dann ist es auch genug. Ich denke, wir packen ihn wieder ein und schicken ihn zurück, denn auf der Rumpelkammer habe ich keinen Platz, dazu nimmt er zu viel Raum ein. Er passt auch gar nicht in die Länder hinter dem Regenbogen."
Da packten sie den Generaloberhofzeremonienmeister wieder in die Kiste und schickten ihn dem Kaiser in das große Land zurück. Der Kaiser aber in dem großen Lande ärgerte sich sehr, als er die Kiste aufmachte. Er ließ auch gleich seinen Generaloberhofmechanikus kommen und befahl ihm bei seiner allerhöchsten Ungnade, er solle den Generaloberhofzeremonienmeister sofort wieder in Ordnung bringen.
Der Generaloberhofmechanikus besah sich den Schaden von allen Seiten und machte ein sehr bedenkliches Gesicht. Schließlich meinte er, die Kleinigkeit im Kopf wolle er gern reparieren, dann könne der Generaloberhofzeremonienmeister wieder spazieren gehen. Aber wer einmal einen wirklich geraden Rücken habe, dem sei er nicht mehr krumm zu machen und für den Hofdienst wäre er keinesfalls zu gebrauchen.
Da wurde der Kaiser sehr böse, er nahm dem Generaloberhofzeremonienmeister seine Orden vom Bauch und stellte ihn als ein warnendes Exempel öffentlich aus. Und alles Volk lief herbei, um ihn anzuschauen, denn in dem großen Land, auf das ich mich eben nicht besinnen kann, hatte noch keiner einen Generaloberhofzeremonienmeister mit einem geraden Rücken gesehen. So etwas war einfach noch nicht da gewesen ....
Im Märchenland hinter dem Regenbogen aber waren alle sehr glücklich und zufrieden. Der alte König regierte nicht mehr, er aß seine Reichsäpfel und spielte Schafskopf mit dem Minister, der deshalb bloß noch Minister des Inneren war und nur noch einwärts ging. Der halbe Untertan regierte das ganze Land und das genügte allen vollkommen.
Nur die Prinzessin regierte er nicht, denn die machte es wie die Katze und ließ sich nicht regieren. Sie hatte es nun einmal der Katze versprochen. Aber dafür kriegte sie fortwährend Kinder, genau so, wie sie es ja auch versprochen hatte.
Die Kinder waren alle Prinzen und Prinzessinnen und da sie zu wenig Untertanen hatten und niemand beherrschen konnten, so beherrschten sie sich selbst. Und das ist auch noch niemals da gewesen!
Manfred Kyber
DER HAMPELMANN ...

Es war ein Hampelmann. Er war rot und aus Papier. Sonst nichts. Bloß so zum Spaß. Auf dem Rücken hatte er eine Schnur und wenn man dran zog, hampelte er mit armen und Beinen. Es sah sehr komisch aus und alle, die an ihm zogen, lachten.
Der Hampelmann lachte nicht, denn es ermüdete ihn, den ganzen Tag Arme und Beine zu bewegen, wenn andere an ihm zupften. Das ist kein leichter Beruf. Aber er ist sehr verbreitet. Der Hampelmann war auch traurig, dass er nur aus Papier war, sonst aus nichts, und eigentlich überhaupt nur so gemacht war - bloß so zum Spaß.
Dazu störte ihn die rote Farbe. Rot ist so auffallend und passt gar nicht, wenn man immer hampeln muss. Rosa hätte es sein müssen, dachte er, das würde besser passen. Denn er gehörte einem kleinen Mädchen, das ein rosa Kleid trug. Der Hampelmann liebte das Mädchen und hätte es gerne geheiratet. Es war so sehr freundlich. Aber es ging nicht.
Er war ja aus Papier und das kleine Mädchen konnte es nicht mal merken, wie es geliebt wurde, denn die Liebe eines Hampelmanns saß wie jede richtige Liebe im Herzen und sein Herz war im Papier, grad auf der Stelle, wo die Leute immer an der Schnur zogen. Darum tat es auch besonders weh. Nur das kleine Mädchen konnte dran herumziehen. Das schadete nichts.
"Es ist ein roter Teufel" ,sagte der Bruder des kleines Mädchens. Das Mädchen verzog den Mund. "Das ist er gar nicht" ,sagte es, "es ist ein ganz richtige Hampelmann und ein sehr feiner. Ich liebe ihn sehr." Der Hampelmann wäre vor Freude rot geworden, aber er war ja so schon rot. Da erübrigt sich das. "Der kann nichts wie hampeln. Wenn er ein Bein verliert, schenke es mir" ,sagte der Junge. "Er verliert keine Beine!" ,sagte das Mädchen empört.
"Man könnte ihm eins ausreißen" ,schlug der Knabe mit höflicher Bosheit vor. "Dann hab ich das Bein und er stirbt vielleicht und wird ein richtiger Teufel in der Hölle. Die Hölle ist auch rot. Ich weiß das." Das kleine Mädchen fasste den Hampelmann fester. "Wenn du dem Hampelmann ein Bein ausreißt, kommst du selbst in die Hölle, pass mal auf" ,sagte es.
"Oder wenn du nicht in die Hölle kommst, verstecke ich deinen Federkasten und sage dir nicht, wo er ist. Ätsch!" - "Er wird ein Teufel, ein Teufel, ein Teufel!!" ,schrie der Junge vergnügt und tanzte auf einem einzigen Bein - gleichsam symbolisch. Es war grausig.
Dem Hampelmann schlug das Herz im Papier, so dass es an der Schnur zog - und die arme und Beine hampelten vor Entsetzen. "Du bist hässlich" ,sagte das kleine Mädchen, "wenn der Hampelmann einmal stirbt, wird er ein Engel und kein Teufel. Alle werden Engel. Bloß die nicht, die anderen die Beine herausreißen. Die werden Teufel, da hast du's!"
Das war ein furchtbares Argument, gegen das nicht aufzukommen war. Man musste auf die Zukunft hoffen und ihr alle weiteren schauerlichen Pläne vertrauensvoll überlassen. "Du wirst schon sehen" ,höhnte der Junge, "du meinst wohl, jeder der kaputt geht, wird ein Engel? Quatsch!"
Das kleine Mädchen brachte den Hampelmann in den Puppenschrank. Da war er vorläufig am sichersten. Denn den Puppenschrank durfte der Bruder nicht anrühren. Sonst bekam er Prügel. Es war eine Art Asylrecht und aus der Notwendigkeit entstanden - wie wenige Gesetze. Im Schrank waren viele Puppen.
"Vertragt euch" ,sagte das kleine Mädchen, "und tretet ihm nicht auf die Beine. Sie sind so lang." Die Puppen rückten höflich zusammen und machten den langen Beinen Platz. Aber es war kaum nötig. Der Hampelmann hatte sie schon bescheiden zusammengefaltet. Er war dankbar für das Asyl, das ihm geboten wurde. Die Puppen waren auch so freundlich und erkundigten sich nach Einzelheiten seiner ermüdenden Tätigkeit.
Nur eine besonders vornehme Puppe, die ganz in Seide angezogen war, rümpfte die bemalte Porzellannase und sagte: "Es ist wirklich unpassend, Leute, die bloß aus Papier sind, hier zu uns zu setzen. Ich habe gerade an den Puppen genug, die nur in Wolle oder Musselin gekleidet sind und nicht aus dem allerersten Laden stammen."
Die anderen Puppen schwiegen bedrückt. Der Nussknacker war leider beruflich im Speisezimmer beschäftigt. Sonst hätte er der vornehmen Puppe auf den Bauch getreten. Das tat er in solchen Fällen immer und sagte ihr dazu, dass sie nur einen hohlen Porzellankopf habe.
Der Nussknacker war ein Philosoph und er nannte das seine Methode. Nicht alle Methoden der Philosophen sind gut. Aber diese ist bei vornehmen Puppen wirklich die allerbeste. Doch der Nussknacker war nicht da und so setzte niemand der vornehmen Puppe den hohlen Porzellankopf zurecht.
Dem armen Hampelmann wurde ganz schwach. Er hatte sich so über das Asyl gefreut und war so dankbar gewesen. Aber er war zu feinfühlig und darum konnte er nicht bleiben. Leute, an denen zu viel gezupft worden ist und die viel gehampelt haben, werden sehr feinfühlig in allen Dingen - mehr als gut tut.
So wurde er sehr traurig und beschloss, zu dem kleinen Mädchen zu gehen, das er liebte, und um Hilfe zu bitten. Er schob die langen Beine nach vorn und hastete an die Schranktür. Die kleinen Puppen halfen bedrückt und bedauernd sie zu öffnen und der Hampelmann hüpfte hinaus. Die langen Beine schlugen klatschend auf.
Das kleine Mädchen war nicht da. Aber der Junge hörte die Beine klatschen und kam triumphierend angelaufen. Er dachte: Es lohnt nicht, wenn ich ihm ein Bein ausreiße, man nimmt es mir wieder weg. Da nahm er den Hampelmann und warf ihn in den Kamin.
Der Kamin brannte, denn es war Winter und draußen fielen die Flocken. Das Feuer im Kamin freute sich sehr. Es macht keine Unterschied und man kann ihm das nicht Übel nehmen. Es beleckte den Hampelmann mit lauter roten Zungen und das vertrug er nicht. Denn er war ja nur aus Papier gemacht - bloß so zum Spaß.
Er krümmte ein paar Male die langen Arme und Beine, mit denen er so viel gehampelt hatte. Dann zerfiel er zu Asche und mit ihm die Schnur, an er ihn alle Leute immer so viel gezupft hatten. Das war noch das Beste dabei.
Das kleine Mädchen kam dazu gelaufen. Es brachte den Nussknacker in den Puppenschrank zurück. Aber für den armen Hampelmann war es zu spät. "Ich habe deinen Hampelmann in den Kamin geschmissen" ,schrie der Junge, "er ist aber doch kein Engel geworden, trotzdem er ganz futsch ist. Bäh!" Das kleine Mädchen weinte bitterlich.
Der Junge bekam Prügel und der Nussknacker trat der vornehmen Puppe in den Bauch, als er hörte, was geschehen war. So schwebte zwar über dem Trauerfall die Stimmung ausgleichender Gerechtigkeit der höheren Mächte, aber die Tränen des kleinen Mädchens waren doch bitter genug, denn es war der erste Hampelmann, der ihm zu Asche geworden war. Draußen war es Winter und die Flocken fielen auf die Erde.
"Ich werde den Hampelmann immer im Herzen behalten" ,sagte das kleine Mädchen. "Dann ist er nicht futsch und nicht gestorben. Denn ich sterbe ja nicht. Bloß die alten Leute sterben. Ich will aber nicht alt werden. Man darf dann wohl alles durcheinander essen, was man will, aber man stirbt später. Ich finde, es hat keinen Witz."
Das dachte das kleine Mädchen natürlich bloß so. Es wird auch groß werden und alles durcheinander essen und dann sterben. Nur das, was es im Herzen hatte, wird nicht sterben und darum wird auch der Hampelmann leben bleiben, was eine große Beruhigung ist.
Denn wer einmal im Herzen eines Menschenkindes war, der bleibt ewig leben und es ist auch ganz gleich, dass er nur ein armer Hampelmann war, der sein Leben lang gehampelt hat, wenn andere ihn an der Schnur zogen, und der überhaupt nur aus Papier gemacht war - bloß so zum Spaß...
Manfred Kyber
DIE POSTKUTSCHE ...

Der Bär Tobias Muffelfell saß behaglich vor seiner Höhle und drehte die Daumen seiner Tatzen umeinander. Dazwischen aß er Knusperchen, die ihm seine Frau gebacken hatte und durch seine Seele zogen liebliche Bilder des Winterschlafes. Jeder, der den Winterschlaf kennt und liebt, wird Tobias Muffelfell das nachfühlen können.
Seine Kinder spielten Fußball mit einem Kürbis, während Frau Muffelfell in der Höhle Knusperchen backte, wie sie es stets zu tun pflegte. Sie hatte sich eine große weiße Schürze umgebunden und trug eine Haube auf dem Kopf, denn es ist sehr unangenehm, wenn der Küchendampf sich einem so stark ins Fell setzt. Niemand konnte so schön Knusperchen backen wie Frau Muffelfell und es war eine Freude, ihr zuzusehen, wenn sie den Teig mit den Tatzen knetete und allerlei hübsche Muster mit ihren Krallen hinein drückte.
Als Frau Muffelfell fertig war, wischte sie sich die Tatzen mit der Schürze ab und trat vor die Höhle hinaus. "Tobias" ,sagte sie, "der Honig ist alle. Du musst den neuen Honig bringen. Sonst kann ich keine Knusperchen mehr backen." Tobias Muffelfell verzog höchst unangenehm berührt die Schnauze und brummte ungnädig. "Es gibt keinen Honig mehr in der ganzen Nachbarschaft" ,sagte er, "wie soll ich welchen beschaffen?" "Du bist ein Mann, Tobias", sagte seine Frau, "mache eine Erfindung." Tobias Muffelfell stützte den Kopf in die Tatzen und dachte nach. Es dauerte sehr lange.
"Jetzt weiß ich, was ich machen werde" ,sagte er endlich und ging zu seiner Frau in die Küche, "ich werde eine Postkutsche bauen und die Leute von einem Ende des Waldes zum anderen fahren. Dafür müssen sie mir Honig geben. Ist das nun eine Erfindung?" - "Ich weiß gar nicht, was eine Erfindung ist" ,sagte Frau Muffelfell. "Aber du sagtest doch, dass ich eine Erfindung machen soll?" ,sagte Tobias Muffelfell erstaunt. "Du bist ein Mann, Tobias" ,sagte Frau Muffelfell, "ich dachte, du wirst schon wissen, was eine Erfindung ist." -
"Dann ist es bestimmt eine Erfindung" ,sagte Tobias Muffelfell und baute gleich eine Postkutsche aus einem hohlen Baumstamm und vier Rädern. Das Innere polsterte er sorgsam mit Heu und Moos aus, so dass es wirklich sehr hübsch und bequem aussah. Dann malte er große Anzeigen über sein neues Unternehmen auf Birkenrinde und klebte sie mit Harz an die Bäume in der ganzen Nachbarschaft.
Am Tage der ersten Abfahrt hatten sich auch wirklich Fahrgäste eingefunden. Es waren ein Fuchs, eine Ente, ein Frosch, eine Fliege und ein Pfifferling. Tobias Muffelfell musterte die Gesellschaft misstrauisch. "Habt ihr auch Honig?" ,fragte er. "Wenn ihr keinen Honig habt, fahre ich euch nicht in der Postkutsche." Alle versicherten, sie würden bestimmt Honig beschaffen, sie hätten ihn nur eben nicht bei sich, denn das ganze Unternehmen sei ihnen zu überraschend gekommen.
Tobias Muffelfell gab sich zufrieden. Er ließ die Fahrgäste einsteigen und wollte abfahren. "Tobias" ,sagte Frau Muffelfell, "das sind fast alles Leute, die einander verspeisen. Wenn sie sich unterwegs aufessen, dann kriegst du keinen Honig mehr." - "Das ist wahr" ,sagte Tobias Muffelfell. "Also dies ist eine Postkutsche und hier darf keiner den anderen fressen!" ,brüllte er unhöflich in den Wagen hinein. Dann spannte er sich vor und die Fahrt ging los.
Die Fahrgäste begannen sich über den Zweck ihrer Reise zu unterhalten. Der Fuchs fuhr zur Jagd zu seinem Vetter, dem Wolf. Die Ente reiste in einen anderen Teich, um sich einmal gehörig über ihre ganze Verwandtschaft aussprechen zu können. Der Frosch reiste in Regierungsangelegenheiten. Er hatte ein Krönchen auf dem Kopf und war von kaltem und königlichem Geblüt. Die Fliege fuhr nur aus Leichtsinn mit und der Pfifferling überhaupt ohne den allergeringsten Grund.
Leute, die aufeinander Appetit haben, dürfen nicht zusammen in einer Postkutsche fahren. Der Fuchs war der erste, der das einsah. Er bekam einen solchen Appetit auf die Ente, dass ihm das Wasser im Munde zusammenlief. Er hatte in der Eile überhaupt schon schwach gefrühstückt. "Ich kann es nicht mehr aushalten" ,sagte er und sprang von der Postkutsche ab - nur aus Appetit.
Es dauerte nicht lange, da sprang auch die Ente ab. Sie konnte den Frosch nicht mehr ansehen. Lieber wollte sie den Weg zu Fuß weiter watscheln, als neben jemand zu sitzen, der ihrer Meinung nach in ihren Magen, aber nicht in eine Postkutsche gehörte. Nach einer Weile wurde dem Frosch, der an sich schon grün war, grün vor Augen. Sein Mund erweiterte sich unangenehm beim Anblick der Fliege und er sprang ab - auch aus Appetit.
Der Bär Tobias Muffelfell hatte nichts von alledem bemerkt. Es war ihm wohl so vorgekommen, als wäre die Postkutsche leichter geworden, aber er dachte, das käme von der Übung beim Ziehen. Jetzt
hielt er an. "Erste Haltestelle!" ,schrie er und guckte in die Postkutsche hinein.
Die Fliege flog davon und in der Postkutsche saß einzig und allein nur noch der Pfifferling. "Die anderen sind alle ausgestiegen" ,erklärte er, "weil einer auf den anderen Appetit hatte und es
nicht mehr aushalten konnte. Die Fliege ist davongeflogen, weil sie leichtsinnig ist. Nur ich bin sitzen geblieben, um das neue Unternehmen zu stützen."
"Wer sind Sie denn überhaupt?" ,schrie Tobias Muffelfell. "Ich bin Pilz von Beruf" ,sagte der Pfifferling freundlich. "Können Sie denn überhaupt bezahlen?" ,fragte Tobias Muffelfell. "Nein, das kann ich nicht" ,sagte der Pfifferling, "ich bin ja eigentlich auch ganz ohne jeden Grund mitgefahren."
"So" ,sagte Tobias Muffelfell, "das ist eine unerhörte Unverschämtheit von einem so knirpsigen Kerl mit einem so piepsigen Stimmchen. Dafür kippe ich Sie hier einfach aus und Sie können sehen, wie Sie auf Ihren kurzen Beinen allein wieder zurück wackeln." - "Das tut nichts" ,sagte der Pfifferling, "ich bin Pilz von Beruf und bleibe ruhig hier sitzen. Ich warte den ersten warmen Regen ab und dann kriege ich Kinder. Alles übrige ist mir einerlei."
Da zerschlug Tobias Muffelfell seine Postkutsche und ging sehr erbost nach Hause. Seine Bärenkinder kamen ihm schon von Weitem entgegen gelaufen: "Papa" ,riefen sie heulend, "wir können nicht mehr Fußball spielen. Wir haben keinen Fußball mehr." - "Warum habt ihr keinen Fußball mehr?" ,fragte Tobias Muffelfell böse. "Wir haben ihn aufgegessen, Papa" ,sagten die Kleinen.
Da gab Tobias Muffelfell jedem seiner Bärenkinder eine Tatzenohrfeige. "Tobias" ,sagte Frau Muffelfell, "du siehst aus, als wären die Motten in deinen Pelz gekommen. Ich denke mir, du solltest doch lieber keine Erfindung mehr machen."
Ein Bär kann ruhig Erfindungen machen. Man muss bloß nicht alles durcheinander in einer Postkutsche fahren wollen - sonst bleibt am Ende nichts weiter übrig als nur ein Pfifferling!
Manfred Kyber
DER KLEINE TANNENBAUM ...

Es war einmal ein kleiner Tannenbaum im tiefen Tannenwalde, der wollte so gerne ein Weihnachtsbaum sein. Aber das ist gar nicht so leicht, als man das meistens in der Tannengesellschaft annimmt, denn der Heilige Nikolaus ist in der Beziehung sehr streng und erlaubt nur den Tannen als Weihnachtsbaum in Dorf und Stadt zu spazieren, die dafür ganz ordnungsmäßig in seinem Buch aufgeschrieben sind.
Das Buch ist ganz erschrecklich groß und dick, so wie sich das für einen guten alten Heiligen geziemt. Und damit geht er im Walde herum in den klaren kalten Winternächten und sagt es allen den Tannen, die zum Weihnachtsfeste bestimmt sind. Dann erschauern die Tannen, die zur Weihnacht erwählt sind, vor Freude und neigen sich dankend. Dazu leuchtet des Heiligen Heiligenschein und das ist sehr schön und sehr feierlich.
Und der kleine Tannenbaum im tiefen Tannenwalde, der wollte so gerne ein Weihnachtsbaum sein. Aber manches Jahr schon ist der Heilige Nikolaus in den klaren kalten Winternächten an dem kleinen Tannenbaum vorbei gegangen und hat wohl ernst und geschäftig in sein schrecklich großes Buch geguckt, aber auch nichts und gar nichts dazu gesagt. Der arme kleine Tannenbaum war eben nicht ordnungsmäßig vermerkt - und da ist er sehr, sehr traurig geworden und hat ganz schrecklich geweint, so dass es ordentlich tropfte von allen Zweigen.
Wenn jemand so weint, dass es tropft, so hört man das natürlich, und diesmal hörte das ein kleiner Wicht, der ein grünes Moosröcklein trug, einen grauen Bart und eine feuerrote Nase hatte und in einem dunklen Erdloch wohnte. Das Männchen aß Haselnüsse, am liebsten hohle, und las Bücher, am liebsten dicke, und war ein ganz boshaftes kleines Geschöpf.
Aber den Tannenbaum mochte es gerne leiden, weil es oft von ihm ein paar grüne Nadeln geschenkt bekam für sein gläsernes Pfeifchen, aus dem es immer blaue ringelnde Rauchwolken in die goldene Sonne blies - und darum ist der Wicht auch gleich heraus gekommen, als er den Tannenbaum so jämmerlich weinen hörte und hat gefragt: "Warum weinst du denn so schrecklich, dass es tropft?"
Da hörte der kleine Tannenbaum etwas auf zu tropfen und erzählte dem Männchen sein Herzeleid. Der Wicht wurde ganz ernst und seine glühende Nase glühte so sehr, dass man befürchten konnte, das Moosröcklein finge Feuer, aber es war ja nur die Begeisterung und das ist nicht gefährlich. Der Wichtelmann war also begeistert davon, dass der kleine Tannenbaum im tiefen Tannenwalde so gerne ein Weihnachtsbaum sein wollte, und sagte bedächtig, indem er sich aufrichtete und ein paarmal bedeutsam schluckte:
"Mein lieber kleiner Tannenbaum, es ist zwar unmöglich dir zu helfen, aber ich bin eben ich und mir ist es vielleicht doch nicht unmöglich, dir zu helfen. Ich bin nämlich mit einigen Wachslichtern, darunter mit einem ganz bunten, befreundet, und die will ich bitten zu dir zu kommen. Auch kenne ich ein großes Pfefferkuchenherz, das allerdings nur flüchtig - aber jedenfalls will ich sehen, was sich machen lässt. Vor allen aber - weine nicht mehr so schrecklich, dass es tropft."
Damit nahm der kleine Wicht einen Eiszapfen in die Hand als Spazierstock und wanderte los durch den tief verschneiten Wald, der fernen Stadt zu. Es dauerte sehr, sehr lange, und am Himmel schauten schon die ersten Sterne der heiligen Nacht durchs winterliche Dämmergrau auf die Erde hinab und der kleine Tannenbaum war schon wieder ganz traurig geworden und dachte, dass er nun doch wieder kein Weihnachtsbaum würde.
Aber da kam es auch schon ganz eilig und aufgeregt durch den Schnee gestapft, eine ganze kleine Gesellschaft: der Wicht mit dem Eiszapfen in der Hand und hinter ihm sieben Lichtlein - und auch eine Zündholzschachtel war dabei, auf der sogar was drauf gedruckt war und die so kurze Beinchen hatte, dass sie nur mühsam durch den Schnee wackeln konnte. Wie sie nun alle vor dem kleinen Tannenbaum standen, da räusperte sich der kleine Wicht im Moosröcklein vernehmlich, schluckte ein paarmal ganz bedeutsam und sagte:
"Ich bin eben ich - und darum sind auch alle meine Bekannten mitgekommen. Es sind sieben Lichtlein aus allervornehmsten Wachs, darunter sogar ein buntes, und auch die Zündholzschachtel ist aus einer ganz besonders guten Familie, denn sie zündet nur an der braunen Reibfläche. Und jetzt wirst du also ein Weihnachtsbaum werden. Aber was das große Pfefferkuchenherz betrifft, das ich nur flüchtig kenne, so hat es auch versprochen zu kommen, es wollte sich nur noch ein Paar warme Filzschuhe kaufen, weil es gar so kalt ist draußen im Walde.
Eine Bedingung hat es freilich gemacht: Es muss gegessen werden, denn das müssen alle Pfefferkuchenherzen, das ist nun mal so. Ich habe schon einen Dachs benachrichtigt, den ich sehr gut kenne und dem ich einmal in einer Familienangelegenheit einen guten Rat gegeben habe. Er liegt jetzt im Winterschlaf, doch versprach er, als ich ihn weckte, das Pfefferkuchenherz zu verspeisen. Hoffentlich verschläft er es nicht!"
Als das Männchen das alles gesagt hatte, räusperte es sich wieder vernehmlich und schluckte ein paarmal gar bedeutsam und dann verschwand es im Erdloch. Die Lichtlein aber sprangen auf den kleinen Tannenbaum hinauf und die Zündholzschachtel, die aus so guter Familie war, zog sich ein Zündholz nach dem anderen aus dem Magen, strich es an der braunen Reibfläche und steckte alle die Lichtlein der Reihe nach an.
Und wie die Lichtlein brannten und leuchteten im tief verschneiten Walde, da ist auch noch keuchend und atemlos vom eiligen Laufen das Pfefferkuchenherz angekommen und hängte sich sehr freundlich und verbindlich mitten in den grünen Tannenbaum, trotzdem es nun doch die warmen Filzschuhe unterwegs verloren hatte und arg erkältet war. Der kleine Tannenbaum aber, der so gerne ein Weihnachtsbaum sein wollte, der wusste gar nicht, wie ihm geschah, dass er nun doch ein Weihnachtsbaum war.
Am anderen Morgen aber ist der Dachs aus seiner Höhle gekrochen, um sich das Pfefferkuchenherz zu holen. Und wie er ankam, da hatten es die kleinen Englein schon gegessen, die ja in der heiligen Nacht auf die Erde dürfen und die so gerne die Pfefferkuchenherzen speisen. Da ist der Dachs sehr böse geworden und hat sich bitter beklagt und ganz furchtbar auf den kleinen Tannenbaum geschimpft.
Dem aber war das ganz einerlei, denn wer einmal in seinem Leben seine heilige Weihnacht gefeiert hat, den stört auch der frechste Frechdachs nicht mehr.
Manfred Kyber
DAS KELLERMÄNNCHEN ...
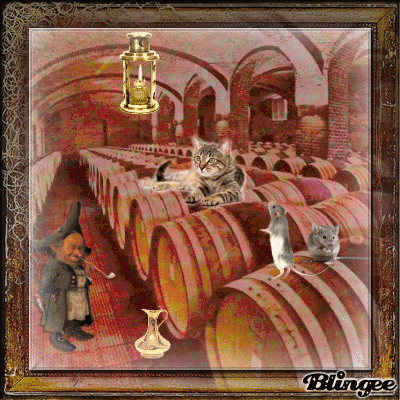
Zwischen zwölf und ein Uhr Nachts wird alles lebendig, von dem die dummen Menschen glauben, dass es überhaupt nicht lebendig werden kann. Aber alle die vielen Dinge, die sonst immer so steif und still da liegen, als könnten sie kaum "Guten Tag" sagen, die werden dann lebendig. - Und sie kümmern sich sehr wenig darum, ob die dummen Menschen daran glauben oder nicht.
Und so wurde es auch in dem kleinen alten Städtchen lebendig, als die Uhr vom Kirchturm Unserer Lieben Frau mit zwölf dumpfen schweren Schlägen Mitternacht verkündete. Die Pflastersteine unterhielten sich mit den Grashalmen, die zwischen ihnen wuchsen, und fragten sie, wie lange sie noch zu bleiben gedächten. Und die Giebel und Erker der Häuser in den engen winkligen Gassen nickten einander zu, und die Laternen beschwerten sich über den Wind, und dass sie erkältet wären, weil er so rücksichtslos mit ihnen umgesprungen sei.
Auch im alten Weinkeller des kleinen alten Städtchens wurde es lebendig. Die vielen, vielen Fässer, die dort nebeneinander standen, große und kleine, die gähnten und reckten und streckten sich, und wenn mal eins das andere dabei anstieß, dann sagte es: "Oh, bitte entschuldigen Sie tausendmal!" Denn die Fässer sind sehr höflich und wissen sich zu benehmen. Dann stellten sie sich alle aufrecht hin auf ihre dicken kleinen Beinchen - die Fässer haben nämlich kleine Beinchen, wenn die dummen Menschen das auch nicht wissen - und sie verneigten sich alle voreinander und nickten und grüßten nach allen Seiten.
Und wie sie sich so begrüßten und "Wie geht es?" fragten und "Haben Sie wohl geruht?" - da kroch ein kleines komisches Männchen aus einer Mauerspalte und rieb sich verschlagen die Äuglein. Das war das Kellermännchen und das sah aus, als ob es ganz und gar gedörrt und vertrocknet wäre, und hatte ein fahles, runzliges Gesicht und eine rote Nase dazu - und das kam alles vom vielen Wein trinken. Denn das Männlein trank erschrecklich viel Wein und man wusste gar nicht, wo alle der viele Wein Platz haben konnte, den es so hinunter schluckte, als wäre es gar nichts und als hätte es nur einmal genippt.
Und war das Männlein gräulich anzusehen, so war sein Gewand ganz wunderschön und seltsam. Einen gar fürnehmen (vornehm, elegant) Dreispitz trug es auf dem Kopfe und hatte Schnallenschuhe an und einen langen Rock mit Spitzen und Goldstickerei, so wie man es vor vielen hundert Jahren trug. An der Seite hing ihm ein Degen in güldener Scheide und mit einem gar kunstvoll geschmiedeten Knauf. Nur arg verstaubt und verblichen war all die wunderliche Pracht, und das ist ja auch nicht anders zu erwarten, wenn jemand nur immer so in einer Mauerspalte lebt.
Wie nun das Männlein gravitätisch und mit gespreizten Schritten, das Händchen auf den Degenknauf gestützt, durch die alten Kellerräume hindurch schritt, da grüßten die Fässer alle und verneigten sich ehrerbietig. Denn das Kellermännchen ist die höchste Respektsperson in einem Keller und hat aufzupassen, dass alles in Ordnung ist. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann schimpft es und trinkt Wein dazu, und wenn alles in Ordnung ist, dann sagt es gar nichts und trinkt auch Wein dazu. Denn es ist eben eine Respektsperson.
Weil nun das Männlein eine Respektsperson war, so grüßte es auch niemand wieder und tat überhaupt sehr hochmütig und herablassend. Nur wenn es an dem alten grauen Kater vorbeikam, der jede Nacht
im Keller schlief, da blieb es stehen, schob den Degen graziös nach hinten, nahm den fürnehmen Dreispitz vom Kopfe und machte eine tiefe höfische Verbeugung.
Das tat es deswegen, weil der Kater ihm einmal bei einer Meinungsverschiedenheit eine solche Ohrfeige gegeben hatte, dass es mit all seiner vielhundertjährigen Pracht auf den Boden gefallen war.
Denn der Kater war, wie alle Kater, ein großer Philosoph und hielt nichts von derartig windigem Kellerspuk, wie er sich ausdrückte. "Alle Hochachtung vor Dero Pfoten" ,sagte sich das Männchen seitdem und darum dienerte und knickste es so untertänig vor dem alten grauen Herrn. Der Kater aber kümmerte sich wenig um den kleinen komischen Kerl, der schnurrte höchstens etwas gnädig, strich sich den kriegerischen Bart und murmelte was von nächtlicher Ruhestörung und unnützem Gesindel.
Das Kellermännchen aber stelzte weiter auf seinen dürren Beinchen und guckte ganz giftig nach rechts und nach links, ob auch alles in Ordnung wäre und so wie es sich geziemt für einen Keller, der in der guten alten Zeit erbaut worden war, wo man noch auf Sitte hielt und Schnallenschuhe und einen Dreispitz trug und einen güldenen Degen.
Es war aber alles in Ordnung. Nur zwei Flaschen, die etwas leichten jungen Wein im Magen hatten, die wollten sich totlachen über das komische Männchen, aber das sah es gar nicht und das war ein rechtes Glück, denn es hätte den naseweisen Flaschen ohne Gnade den Kopf abgeschlagen. Und das wäre doch sehr schade gewesen, wenn es auch nur ein ganz leichter Wein war, den sie im Magen hatten.
Das Kellermännchen aber schritt weiter bis ans Ende des Kellers und dort setzte es sich in einer Ecke nieder, holte einen gewaltigen silbernen Humpen hervor und begann ganz erschrecklich zu trinken. Es gluckste nur ein paarmal ganz leise, dann war der Humpen leer, und so ging es weiter und man wusste gar nicht, wo all der viele Wein Platz haben konnte, den das Männlein hinunter schluckte.
Am anderen Ende des Kellers aber begannen die Fässer sich zu unterhalten und eins fragte das andere, ob es denn gar nichts Neues gäbe. Doch es gab nichts Neues, und die Fässer beklagten sich darüber, denn wenn man den ganzen Tag still liegt und Nachts nur eine Stunde Zeit hat, lebendig zu sein, dann will man sich etwas zu sagen haben und will etwas von der Welt hören, die draußen über den Kellerfenstern liegt.
"Ja, ja" ,sagte ein großes dickes Fass, das ganz besonders alt war, "die Welt ist recht langweilig heutzutage und es passiert gar nichts mehr, was so ein echtes rechtes Weinfass auch nur im Entferntesten interessieren könnte. Zu meiner Zeit, als ich noch jung war, da gab es doch immer mal einen Krieg oder eine Pestilenz oder sonst etwas Ähnliches, was sich gut erzählen lässt im Keller um Mitternacht. Ich habe sogar noch den Tatzelwurm (schlangenähnlicher Drachen) erlebt, wie er vor den Mauern der Stadt herum kroch und Feuer spuckte aus Rachen und Nüstern." -
"Ach bitte, erzählen Sie" ,sagten ein paar junge Fässer, "das muss ja furchtbar interessant gewesen sein!" "Ja, es war sehr interessant und gar gräulich und schauerlich dazu. Tag und Nacht läuteten die Glocken von der Kirche Unserer Lieben Frau, die Bürger standen auf den Mauern und Zinnen und hielten Wacht mit Zittern und Zagen, denn es ist ein ganz erschrecklich Ding um solch einen Tatzelwurm.
Der Herr Tatzelwurm speisen nämlich alles mit Haut und Haaren und so hat niemand in die Stadt hinein gekonnt und niemand heraus und es war eine böse Hungersnot ausgebrochen, so dass allen Leuten die Kleider am Leibe hingen, als wären sie gar nicht für sie gemacht. Und da das alles doch gar nicht schön war und auch nicht so weitergehen konnte, so beschloss der hochwohlweise Rat mit dem alten Bürgermeister an der Spitze, eine große Tat zu tun.
Sie stellten sich alle der Reihe nach auf der Stadtmauer auf und der Herr Bürgermeister sagte: "Wohledler und viel lieber Herr Tatzelwurm, wollt Ihr Euch nicht von den Mauern unserer Stadt hinweg bemühen, die weil wir nicht gesonnen sind, uns von Euch verspeisen zu lassen." Der Tatzelwurm aber nieste lauter Feuer aus seiner Nase heraus und sagte: "Nein!" -
Da wurde der Herr Bürgermeister sehr traurig und mit ihm der ganze hohe Rat und sie kletterten wieder von der Stadtmauer herab und gingen auf den Marktplatz und sagten, sie hätten eine große Tat getan, aber es hätte nichts geholfen.
Da weinten alle Leute, wenigstens die, die noch nicht verhungert waren, und die Glocken läuteten von der Kirche Unserer Lieben Frau und der Tatzelwurm kroch um die Mauer herum, so dass auch nicht mal ein Zweiback hereinkommen konnte. Aber wie der hochwohlweise Rat all den vielen Jammer sah und dazu den Tatzelwurm draußen Feuer niesen hörte, da beschloss er noch einmal, eine große Tat zu tun und gar erschrecklich nachzudenken. Da stiegen alle die edlen Herren in diesen Keller hinab und dachten erschrecklich nach und tranken Wein dazu, aber es ist ihnen nichts eingefallen."
Wie das alte Fass so weit erzählt hatte, da sagte es: "Jetzt muss ich mich etwas erholen" ,und zog sich ein Spinngewebe übers Gesicht. Da schwiegen alle Fässer ringsherum und warteten in großer Spannung, wie es weitergehen würde.
Zwei kleine Mäuse aber, die auch gehört hatten, dass das alte Fass etwas erzählte, und die sich nur nicht hin getraut hatten, weil der Kater dazwischen lag, die fanden, dass es jetzt doch gar zu interessant würde, wo dem hochwohlweisen Rat nichts einfiele. Und so beschlossen sie, es näher zu hören. Sie fassten sich ein Herz, strichen ihre grauen Röcklein mit den Pfoten recht sauber und glatt, traten vor das Kellermännchen hin und sagten: "Ach, entschuldigen Sie, essen Seine Hochwohlgeboren der Herr Kater Mäuse?"
Das Männchen sah von seinem Humpen auf, schluckte noch eine furchtbare Menge Wein hinunter und sagte nachsichtig und herablassend: "Seine Hochwohlgeboren sind lange über das Alter hinaus und essen nur noch ganz besonders präparierte und exzellente Sachen, aber keine gemeinen Mäuse mehr. Ihr könnt also ruhig vorbei gehen, denn Euresgleichen sehen Seine Hochwohlgeboren gar nicht."
Da bedankten sich die Mäuse vielmals und dienerten und knicksten und dann huschten sie schleunigst und ängstlich an Seiner Hochwohlgeboren vorbei, denn man konnte nicht wissen, ob es wirklich sicher war, da doch auch alte Herren zuweilen ein jugendliches Gelüste bekommen. Der Kater aber hatte nur ein überlegenes Lächeln für sie und so kamen die Mäuse ungefährdet bei dem großen Fasse an.
Das war aber eingeschlafen und dachte gar nicht daran, weiter zu erzählen, wie es denn geworden war, nachdem dem hochwohlweisen Rat trotz seines erschrecklichen Nachdenkens nichts einfiel. Die nebenstehenden Fässer stießen es leise an und baten, doch weiter zu erzählen, und auch die Mäuse waren ganz entsetzt, dass sie nichts mehr hören sollten, wo sie doch eben deswegen den gefährlichen Weg gewagt hatten an den Pfoten Seiner Hochwohlgeboren vorbei.
Und die eine Maus sprang auf das alte Fass und klopfte ihm schonend auf den Magen, während die andere sich gar erdreistete, ihm das Spinngewebe vom Gesicht zu ziehen. Das alte dicke Fass aber wachte nicht auf, sondern schlief beharrlich weiter und das tat es wohl deswegen, weil es so ganz besonders alt war, und dagegen lässt sich natürlich nichts machen.
Da stützten die kleinen Mäuse den Kopf in die Pfötchen und begannen bitterlich zu weinen, und auch alle die Fässer bedauerten lebhaft und allerseits, dass die Geschichte nicht weiter erzählt wurde, denn es war doch ganz zu interessant gewesen, von dem Tatzelwurm zu hören, der Feuer nieste und "Nein" gesagt hatte, und von dem hochwohlweisen Rat, der zwei große Taten getan und so viel Wein getrunken hatte und dem doch nichts eingefallen war.
Ein mittelgroßes Fass aber, das sehr vernünftig aussah, weil es in einem Jahr mit einem unvergesslichen Philosophen geboren war, dessen Namen es vergessen hatte, das stellte sich auf die Beinchen und sagte: "Es ist doch ganz unnütz, sich aufzuregen und sich zu beunruhigen oder gar so exaltiert in die Pfoten zu schluchzen, wie es die beiden Mäuse tun. Wenn man nur etwas Philosophie im Leibe hat, dann ist die ganze Sache doch furchtbar einfach:
Der Herr Tatzelwurm müssen sich schließlich doch hinweg bemüht haben oder haben sein Leben eines seligen oder unseligen Todes ausgeniest, denn sonst stünde unsere Stadt nicht mehr mit ihren Toren und Türmen und die Glocken läuteten nicht mehr von der Kirche Unserer Lieben Frau. Man muss nur Philosophie im Leibe haben, aber die habe eben nur ich."
Da beruhigten sich die Fässer wieder und nur eins, das ganz besonders frech war, wandte sich an das philosophische Fass und fragte: "Darum ist wohl Ihr Wein auch so gräulich sauer, weil Sie gar so viel Philosophie im Magen liegen haben?" Da wurde das philosophische Fass aber böse und stampfte mit den Beinchen auf, dass alle Reifen krachten, und schickte sich an, eine grässliche Rede zu halten.
Wie es aber gerade anfing und sagte: "Ich bin in dem Jahre geboren, in dem der unvergessliche Philosoph geboren wurde, dessen Namen ich vergessen habe" ... da geschah etwas Entsetzliches.
Die Kellerlaterne raste plötzlich in wahnsinniger Verzückung durch die alten Gewölbe an den Fässern und an den Mäusen vorbei und an Seiner Hochwohlgeboren, dem Herrn Kate. In ihrer Brust aber brannte es lichterloh und es war, als ob das Petroleum ihres Herzens aufgehen wolle in einer einzigen Flamme! Alles schwieg in stillem Grauen, nur das Kellermännchen sprang wütend auf, warf den silbernen Humpen bei Seite und stürzte mit entblößtem Degen auf die arme Kellerlatene zu.
"Sie haben die Zündholzschachtel geküsst in diesem sittsamen Keller, der noch in der guten alten Zeit erbaut worden ist" ,schrie es wütend, "Sie müssen sterben." Die verliebte Kellerlaterne erlosch vor Schrecken und verwünschte ihr empfindliches Herzens-Petroleum, das Männlein aber zückte den Degen, um das grässliche Vergehen zu ahnden, das eine simple Laterne mit einer simplen Zündholzschachtel begangen hatte in einem Keller, in dem der hochwohlweise Rat gesessen und ihm nichts eingefallen war.
Wie aber das Kellermännchen eben zustoßen wollte und die Laterne angstvoll die kleinen Händchen über dem Petroleumherzen faltete, da schlug es Eins vom Kirchturm Unserer Lieben Frau. Das Männlein ließ den Degen sinken und verkroch sich fluchend in seiner Mauerspalte, die Laterne war gerettet, die Fässer knickten ihre Beinchen hübsch sorgfältig zusammen und legten sich wieder hin und die Mäuse hüpften vorsichtig an Seiner Hochwohlgeboren vorbei und verschwanden in ihren Löchern, wo ihnen die graue Frau Mama Speckschwarten und geräucherten Schinken zurechtgestellt hatte.
Der Kater aber, der wie alle Kater ein großer Philosoph war, strich sich den kriegerischen Bart, schnurrte behaglich und legte sich auf die andere Seite. Auch draußen wurde es ruhig in den engen winkligen Gassen des alten Städtchens und alles sah so aus, wie die dummen Menschen es immer sehen.
Die Pflastersteine sprachen nicht mehr mit den Grashalmen und die Erker und Giebel nickten einander nicht mehr zu und standen steif und still da, als ob sie nicht einmal "Guten Tag" sagen könnten.
Die Mauern und Tore und Türme schliefen wieder und der Marktplatz mit der Kirche Unserer Lieben Frau - sie schliefen alle und träumten von dem, was sie einst gesehen hatten: von den Kriegen und von der Pestilenz, von dem Tatzelwurm, der Feuer nieste, und von dem hochwohlweisen Rat, der zwei große Tagen getan und so viel Wein getrunken und so erschrecklich viel nachgedacht hatte - und dem doch nichts eingefallen war.
Manfred Kyber
DER STARKE ZWERG AUF DEM KYFFHÄUSER ...
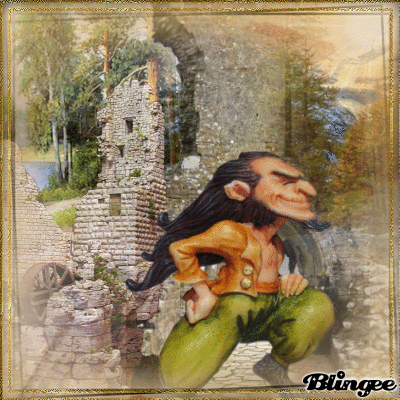
In Sondershausen lebte vor vielen Jahren ein Müller namens Lau, der die Wippermühle von der Stadt gepachtet hatte. Er war ein großer, kräftiger Mann, stark wie ein Bär, und hatte am Hofe zu Potsdam bei den langen Grenadieren gedient.
Einmal fuhr Lau mit seinem Mühlknappen nach dem Kyffhäuser, um sich einen Mühlstein zu holen. Er selbst stieg einen Fußsteig hinan und ließ den Knecht auf dem Fahrweg nachkommen. Die Sonne war schon untergegangen, als er oben bei dem alten Turm anlangte. Da stolzierte auf einmal ein dicker, stämmiger Zwerg hinter dem Turm den Berg herauf, zeigte dem Müller eine Höhle, die kaum groß genug war, einen Dachs aufzunehmen, und verlangte, daß er sich da in die Höhle hineinarbeiten und ihm helfen solle, einen Stein loszubrechen, der sie beide glücklich machen werde.
Der Müller aber hatte keine Lust dazu und schlug das Ansinnen ab. Da wurde der Zwerg grob und fing an zu schimpfen und zu drohen. Doch der Müller war nicht faul und knallte dem Wicht eins hinter die Ohren. Der Knirps aber hängte sich dem Manne wie ein Bleiklumpen an den Hals und warf ihn auf die Erde, daß ihm alle Rippen krachten. Der Müller kriegte den Kleinen zwar wieder herum, aber der Zwerg umfaßte ihn wie eine Kneifzange und zwickte ihn derart, daß er laut aufschreien mußte. Es gab eine Rauferei, wie sie der Müller noch nie mitgemacht hatte, bis er schließlich ganz ermattet war.
Da kam gerade noch zur rechten Zeit der Mühlknappe herbei. Dieser schlug mit seinem Stock auf den Angreifer los, daß die Splitter flogen. Nun erst ließ der Zwerg von dem Müller ab und verschwand wie ein Regenwurm in einem Loch, das kaum eine Spanne groß war. Dem Müller taten alle Glieder weh, und er war am ganzen Leib voll blauer Flecken. Noch mehr ärgerte ihn aber, daß er, der bärenstarke Mann, dem kleinen Knirps fast unterlegen wäre; aber was war zu machen?
Er lud mit seinem Knappen den Mühlstein auf und fuhr heim. Der starke Zwerg aber war seither nicht mehr zu sehen.
Sage aus Thüringen
DER KLEINE WURZELPROFESSOR ...

Es war einmal ein kleiner Wurzelprofessor, der stand im Walde und war ganz aus Wurzeln. Der Körper, die Arme und Beine waren Wurzeln und auch der Kopf. Der kleine Wurzelprofessor war nur ein unendlich kleines Stückchen eines großen hohen Baumes, dessen Gipfel er nie gesehen - und den er leugnete. Die Vögel, die obenauf dem Gipfel des Baumes ihre Nester bauten, setzten sich dem kleinen Wurzelprofessor oft gerade auf die Nase uns sangen ihm die herrlichsten Lieder vor vom Gipfel des großen hohen Baumes, von dem er selber ja doch nur ein unendlich kleines Stückchen war.
Aber der kleine Wurzelprofessor glaubte es auch dann nicht, wenn sie es ihm in beide Ohren gleichzeitig hinein schrien. Auch ein Eichhörnchen, das in beruflichen Angelegenheiten täglich am Stamm des Baumes hinauf lief, hatte dem kleinen Wurzelprofessor von all den Wundern erzählt, die es oben zu sehen gab. "Es sind Wunder über Wunder" , sagte das Eichhörnchen, "und über allem ist der Himmel." -
"Das alles gibt es ja gar nicht" ,sagte der kleine Wurzelprofessor, "denn wie soll es etwas geben, was ich nicht beleuchtet habe?"
Der kleine Wurzelprofessor konnte nämlich leuchten und ich will auch erzählen, wie es gekommen war, dass er so leuchten konnte. Weil er doch fest gewachsen war und gar nicht vom Fleck konnte, so hatte er nichts weiter getan, als bloß immer gedacht, und so viel hatte er gedacht, dass er allmählich einen ganz verfaulten Kopf bekommen hatte. Nun war doch der Kopf aus Holz und jeder weiß, dass faules Holz im Finstern leuchtet. So leuchtete auch der Kopf des kleinen Wurzelprofessors - und seitdem war er sehr froh!
Nur durfte es sonst nicht zu hell sein und der Mond durfte nicht scheinen, den er nicht kannte - und den er leugnete. Am Anfang war es ja noch nicht so besonders bedeutend, aber im Laufe der Jahre leuchtete er doch schon so sehr, dass bei seinem Schein die Regenwürmer ganz bequem ihren Weg finden und die Hamster ihre Einnahmen aufschreiben konnten. Aber natürlich musste es - damit der kleine Wurzelprofessor wirklich leuchtete - immer schon sehr dunkel sein. So stand der kleine Wurzelprofessor auch in einer stillen Nacht wie immer da und dachte und leuchtete so vor sich hin.
Die Nacht war aber keine gewöhnliche Nacht. Denn am Himmel stand der Stern der Liebe. Die Nacht war keine gewöhnliche Nacht. Denn ein Dichter führte seine Liebste heim in den Märchenwald, der seine Heimat war. Und als er mitten im tiefsten Märchenwald angekommen war, wo die sieben silbernen Quellen sind, da küsste er seine Liebste auf den Mund und setzte ihr eine seltsame Krone auf den Scheitel. Das war eine von den Kronen, die es auf der ganzen Erde nicht gibt und die nur ein Dichter seiner Liebsten ins Haar flechten kann.
Der Stern der Liebe an Gottes Himmel aber schien auf Beide nieder und sein Licht verfing sich in der Krone auf des Mädchens Scheitel. Da flammte die Krone auf in tausend wunderbaren Farben, die schöner waren als alle Farben der Erde. Denn das Mädchen war des Dichters Liebste und es war die Krone der Unsterblichkeit, die es trug.
Davon fing der ganze Märchenwald an zu leuchten, die Nixen tauchten aus den dunklen Wassern auf, die Elfen warfen sich heimlich und leise ihre Schleier zu und von Ferne läuteten die Glocken versunkener Städte. Auch die Tiere des Waldes kamen alle herbei, um zuzusehen, die Frösche sangen Loblieder und sogar die Pilze nahmen ihre großen Hüte ab und grüßten nach allen Seiten.
Denn eines Dichters Liebste ist Königin im ganzen Märchenland! ...
Nur der kleine Wurzelprofessor sah nichts vom Dichter und seiner Liebsten, nichts vom Stern der Liebe und nichts von der Krone der Unsterblichkeit. Er stand und leuchtete so vor sich hin und
dachte: all der Glanz im Himmel und auf der Erde käme einzig und allein nur davon her, dass er so heftig leuchte.
Manfred Kyber
WARUM KIEFER UND BIRKE ZUSAMMENWOHNEN ...

Als Waldkönig schon viele tausend Jahre regierte, da kamen einmal alle Waldfürsten und Waldprinzen und Waldgrafen zu ihm und sagten: "Herr König, gebt uns ein Stück Land in Eurem Reiche, auf dem wir uns anbauen können, es ist gar eng bei uns, und unsere Brüder und Schwestern und Anverwandten haben keinen Platz mehr."
"Gut", sagte der König, geht hin und sucht in meinem Reiche Land aus, wie ihr wollt und wo es euch dort gefällt. Aber baut es schön an, und wer das am schönsten macht, der soll die schöne Prinzessin zur Frau kriegen."
Die schönste Prinzessin im ganzen Land aber war Junge Birke, die war zart und zierlich und schlank im Wuchs, hatte ein weiß seidenes Kleid an und einen lichtgrünen Schleier darüber und war behängt mit lauter gelben und braunen Anhängerchen, die aussahen wie ganz klimper kleine niedliche Lämmer Schwänzchen.
Und alle Waldprinzen und Waldfürsten und Waldgrafen hätten sie gar zu gern zur Frau gehabt. Darum gefiel ihnen auch der Vorschlag des Waldkönigs, und sie gingen aus und suchten sich ihr Land und bauten sich dort an. Wie sie nun damit fertig waren, nahm Waldkönig Prinzess Birke und reiste mit ihr durchs ganze Land, zu sehen, wer es am besten gemacht hätte.
Da kamen sie in eine schöne Stadt mit hohen Häusern und langen geraden Straßen. Da hatte der stolze Fürst Kastanie sich angesiedelt, und alle seine Verwandten standen in Reih und Glied an den Straßen entlang, wie die Soldaten des Kaisers, der dort in der Straße wohnte und gerade Parade hielt. Das wäre so nach Waldkönigs Sinn gewesen, aber Prinzess Birke schüttelte ihr Köpfchen und ging weiter.
Dann kamen sie auf ein hübsches Dorf, da hatte Fürst Lindenblatt sich seine Wohnung gebaut, ei war es da freundlich! Kleine niedrige Bauernhäuser, und vor jedem ein schattiger Lindenbaum, um dessen Blüten die Bienchen summten. Waldkönig schmunzelte zufrieden aber Prinzess Birke schüttelte ihr Köpfchen und ging weiter.
So zogen sie durchs ganze Reich, sie kamen zu steilen Bergen, in denen sich Prinz Tannenzapfen sein Heim gebaut hatte, und an sanfte Hänge, wo Prinz Lärchenstamm wohnte, in welliges Hügelgelände
mit fettem Boden, silbernen Strömen, ragenden Burgen, dem Gebiet des Herzogs von Eichwald und an das blaue schöne Meer, an dessen Ufern Fürst Buchecker sein wundervolles schön gepflegtes
Land hatte, sie kamen in sumpfige Niederungen,
wo Prinz Erle wohnte, und in saftige Wiesengründe, wo an schmalen Bächen und Gräben Graf Salweide seine neue Heimat gefunden hatte.
Sie kamen an schön gepflegte Chausseen, an denen die beiden Grafen Ahorn und Esche sich und ihre Verwandten rechts und links aufgestellt hatten, um die hohen Herrschaften feierlich zu empfangen. Und der Waldkönig schien sehr befriedigt mit dem, was die Söhne seines Reiches geschaffen hatten, er war stolz darauf, dass all das Land nun so schön bestellt und bebaut war.
Aber jedes Mal, wenn er Prinzess Birke fragte, ob es ihr nicht gefiele, sagte sie: "Herr König, lasst uns erst alles besehen, dann will ich sagen, welcher von allen Fürsten und Prinzen und Grafen es am besten gemacht hat."
Als sie nun schon fast alles gesehen hatten, fragte der Waldkönig: "Nun haben wir fast das ganze Reich bereist. Es ist nur noch ein Stück übrig, aber da wollen wir nur gar nicht erst hinreisen, denn da ist doch nichts los, lauter Sand und Heide, da wird es dir schon gar nicht gefallen." "Lasst uns auch dahin reisen", sagte Prinzess Birke.
So machten sie sich auf und kamen in das Gebiet der sandigen Heide. Aber wie waren sie erstaunt, als sie dahin kamen! Da war das Land bedeckt mit einem schönen, grünen Wald, dunkelblaugrün schimmerten seine Kronen und rotgolden seine Stämme, kleine Seen mit ihren blanken Spiegeln blitzten dazwischen auf, und über den grauen und gelben Sand breitete Heidekraut einen zarten bläulich-roten Schein, und um das ganze Land wehte herbe, kräftige Luft.
"Wer hat das fertig gebracht?", fragte erstaunt der Waldkönig. Da kam im braunen Kittel mit struppigen schwarzem Haar und Bart ein einfacher Arbeiter. "Verzeiht, Herr König", sagte er, "von
Euren Fürsten und Prinzen und Grafen wollte niemand das Stück Land haben, denn es war ihnen zu arm und zu schlecht. Da bat ich sie, sie möchten es mir lassen, denn ich habe eine große Sippe, und
wir sind alle arme Leute und zufrieden, wenn wir ein bisschen
Sand und Wasser zum Leben haben. Da haben sie mir es aus Gnade und Barmherzigkeit gelassen, und ich habe mich mit meinen Leuten daran gemacht und es in Ordnung gebracht. Erlaubt mir, dass
ich hier wohnen bleiben darf."
Da trat Prinzess Birke zum Waldkönig und sprach: "Herr König,dieser arme Mann hat mehr geleistet als Eure Großen alle. Gebt mich ihm zur Frau." "Du hast Recht", sagte der König. Aber er ist doch ein armer Mann und du bist eine Prinzessin." "Das tut nichts, er hat doch aus einer Sandwüste ein Paradies gemacht."
Da wandte sich der König an den Arbeiter:" Wie heißt Er, guter Freund?", fragte er ihn freundlich. "Ich heiße Föhre." "Gut. Er soll von nun an in den Grafenstand erhoben werden und Graf Kiefer heißen und Prinzessin Birke soll seine Frau sein."
Seitdem leben Kiefer und Birke zusammen und führen ein glückliches Leben miteinander, wenn sie auch nur im Walde wohnen!
Der Wald steckt voller Geheimnisse. Seit Menschengedenken ranken sich um ihn Sagen, Mythen und Legenden.
P. u. A. Blau, "Wies wispert und wuspert im grünen Wald" - Waldmärchen
WOHER DIE GLOCKENBLUMEN KOMMEN ...

Der Waldkönig und die Waldkönigin lebten schon lange auf ihrem steinernen Schloß im grünen Wald ganz allein. Als aber einmal der böse Winter, der immer eine ganz lange Zeit bei ihnen wohnte, wieder davon gezogen war, um für ein paar Monate nach dem Nordpol auf Reisen zu gehen, da wurde ihnen eines Tages ein liebliches Töchterlein geschenkt.
Das war ein feines, zartes Mägdelein mit sonnengoldenen Härchen und ein Paar Äuglein, blau wie Vergißmeinnicht. Da war große Freude im Waldschloß, und der Waldkönig wollte, alle Bewohner seines weiten Reiches sollten es wissen, daß ein kleines Prinzeßchen geboren sei, das Waldtraut heißen sollte.
So rief er denn alle seine Hofbeamten zusammen und sprach: „Wer will mein Bote sein, der im ganzen Reich verkündigt, daß uns ein Prinzeßchen geschenkt ist?“ Da sagte die Schnecke: „Herr König, das will ich besorgen.“ „Gut,“ sagte der Waldkönig, „so spute dich, damit alle es bald erfahren.“
Aber die Schnecke dachte: „Das wird eine lange Reise werden! Und wenn ich dann einen Tag nach dem anderen laufen muß, wo finde ich eine Herberge, da ich ausruhen, wo ein Haus, da ich einkehren könnte? Ich will mir ein Häuschen machen, das ich überall mitnehmen kann, und in dem ich wohnen und schlafen kann.“ Und so machte sie sich ihr Häuschen und lud es auf aber das war schwer und drum ging es langsam mit der Reise, manchen Tag noch nicht eine halbe Meile!
Als das der König hörte, wurde er sehr ungeduldig und böse und rief seine Hofbeamten und sagte: „Die Schnecke macht es zu langsam, wer will mein Bote sein?“ Da sagte der Schmetterling: „Herr König, schickt mich, ich habe zwei schöne Flügelein, mit denen kann ich fliegen durch das ganze Reich.“ „Du hast recht,“ sagte der König: „So flieg und spute dich!“ Da breitete der Schmetterling seine zitronengelben Schwingen aus und wiegte sich im warmen Sonnenschein und flog von Blüte zu Blüte, von Halm zu Halm.
Aber da kam er zu einer reizenden kleinen Wiesenblume, die lächelte ihn freundlich an. Da blieb er bei ihr sitzen, und sie liebkosten einander und plauderten zusammen, und über dem allen vergaß er beinahe, seine Botschaft zu bestellen. Und als er sich von dieser lieblichen Blüte doch los riß, fand er bald eine andere, bei der er sitzen blieb, und mit der er das selbe Tändelspiel trieb und übert all dem Gaukeln und Tändeln verstrich die Zeit.
Als der König das hörte, wurde er zornig und rief abermals seine Hofbeamten zusammen und sagte: „Auch der Schmetterling ist ein unbrauchbarer Bote wer will mein Bote sein? Aber alle schwiegen, denn sie fürchteten, sie würden es dem König doch nicht recht machen.
Da trat ein kleines, graues Männlein herzu, das hatte einen krummen Rücken und einen langen Bart und humpelte auf seinen kurzen Beinchen. „Herr König,“ sagte es, „gebt mir acht Tage Zeit und in acht Tagen sollen alle Eure Untertanen Botschaft haben.“
„Wie wolltet Ihr das fertig bringen, Meister Bimbam?“ fragte der König. „Ihr seid doch gar betagt und schlecht auf den Füßen!“ „Das laßt meine Sorge sein, Herr König; wollt Ihr meines Dienstes brauchen, so sagt Ja.“ „Nun ja denn,“ sagte der König, weil doch kein anderer Bote zu haben war.
Da humpelte Meister Bimbam gar eilig nach seiner Werkstatt und rief alle seine Gesellen zusammen. Und nun ging ein heimliches Klopfen und Hämmern los Tag und Nacht; die einen standen am Amboß und schmiedeten, die anderen machten ein mächtiges feuer, die dritten gruben tiefe Gruben und gossen da flüssiges Feuer hinein. Wieder andere liefen durchs ganze Land und machten da heimlich allerlei zurecht.
Und als acht Tage um waren, da rief Meister Bimbam seinen Obergesellen, der hieß Herr Mailüfterl, und sagte ihm: „Mailüfterl, wenn nun der Herr König ein Zeichen gibt, dann machst du deine Sache
gut.“ „Das will ich schon tun, Meister.“
Da ging Meister Bimbam zum König und sagte:
„Herr König, wenn Ihr nun befehlen wollt, so sollen in einer Stunde alle Eure Untertanen Botschaft haben. Gebt nur meinem Obergesellen ein Zeichen.“ Da winkte der König mit der Hand, und Mailüfterl sprang schnell hinaus. Ja, was war den das? „Bim baum, bim baum“ klang es auf einmal rings umher, im Walde und auf der Wiese, am Berg und am Bach. „Bim baum, bim baum! Wir haben ein Prinzeßchen, das heißt Waldtraut, Waldtraut.“
Der König sah erstaunt zum Fenster hinaus da sah er überall im ganzen Reich schöne blau Glocken hängen, die läuteten die Botschaft von Prinzeßchens Geburt hinaus über alle Lande. Seitdem läuten die Glockenblumen jahraus, jahrein, so oft Prinzeßchens Geburtstag wieder kommt und Herr Mailüfterl ist Königlicher Hofglöckner geworden.
[P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
HOLD EMMCHEN UND DER SILBERNE MANN ...

Hoch droben in den Bergen, wo zwischen grauen Klippen das braune Moos und die grünen Wiesen sich dehnen, lebte vor Zeiten ein kleines Mädchen, ein liebliches, lustiges und munteres Ding, das sang und sprang den lieben langen Tag und wand sich Kränzchen aus blauen Vergißmeinnicht und weißem Wollgras und freute sich an dem blauen Himmel und an den grünen Tannen, die es drüben vom Bergeshang her grüßten.
Aber droben auf dem Berge hauste ein alter Riese; silbergrau war sein Haar und silbergrau sein Bart, um die Brust trug er einen Panzer von silbergrauem Granit und an den Beinen eben solche Stiefel. Der sah schon lange Hold Emmchens Spiel mit Wohlgefallen zu. Einsam saß er auf seinem Renneckenberg. Ei, das wäre schön, wenn Hold Emmchen seine Frau würde und zu ihm herauf zöge und ihm mit ihrem lustigen Singen die Einsamkeit vertriebe.
So stieg er denn eines Tages von seinem Berge hernieder und fragte Hold Emmchen, ob sie nicht seine Frau werden wollte. Aber die lachte den alten Graubart aus; sie wollte viel lieber weiter lustig singen und springen und sich ihrer Kindheit freuen, als des silbernen Mannes Frau werden.
Doch, der ließ nicht nach und bat und bat immer wieder, bis Hold Emmchen schließlich sagte: „Weißt du was? Wir wollen miteinander zum Herrn Erzbischof nach Magdeburg reisen, der soll entscheiden. Wenn du zuerst dort bist, dann kannst du ihn bitten, daß ich deine Frau werde; wenn ich zuerst dort bin, werde ich ihm freilich sagen, daß ich nicht deine Frau werden möchte. Aber du darfst mich auf dem Wege nicht aufhalten, und ich verspreche dir auch, dir nichts in den Weg zu legen.“
Der silberne Mann war zufrieden, denn er dachte, er mit seinen großen Siebenmeilenstiefeln würde doch viel schneller in Magdeburg sein, als Hold Emmchen mit seinen kleinen, zarten Füßchen.
So machten sie sich denn eines Tages auf und gingen nebeneinander her, und immer, wenn der silberne Mann ihr zu nahe kommen wollte, wich Hold Emmchen im großen Bogen aus. Eine Zeit lang ging es ganz gemächlich. Der silberne Mann ließ Hold Emmchen sogar vorangehen, er würde sie doch bald einholen und überholen.
Aber es ging doch nicht so schnell, wie er dachte; der Boden war sumpfig, und während Hold Emmchen mit leichtem Fuß drüber hin sprang, blieb der silberne Man mit seinen schweren Stiefeln immer stecken, und es kostete ihm immer viel Mühe und Schweiß, bis er so ein Bein nach dem anderen wieder aus dem Sumpf heraus gezogen hatte.
Hold Emmchen aber lachte ihn dann tüchtig aus. Dann holte er sie freilich mit einem einzigen großen Schritt schnell wieder ein—aber patsch! Da saß er wieder im Sumpf. Das wurde ihm denn doch allmählich bedenklich. Wenn das so weiter ging, kam Hold Emmchen ihm am Ende doch beim Erzbischof zuvor. Da faßte er einen bösen, bösen Plan—und gedacht, getan!
Es war Abend geworden. Da versteckte er sich im Walde, wo ihn niemand sehen konnte und legte seine schwere Steinrüstung ab, die ihn mit ihrem Gewicht immer in den Sumpf hinab zog; dann schlug er sie in Stücke und warf sie auf den Weg, auf dem Hold Emmchen kommen mußte. Da, so rechnete er, würde sie im Dunkeln darüber stolpern und sich ein Bein brechen—dann konnte sie nicht mehr so schnell laufen! —
So duckte er sich denn in den Wald und wartete ab, wenn Hold Emmchen kommen würde. Aber es wurde Nacht und sie kam nicht; der Mond guckte neugierig über den Berg, um zu sehen, was da los wäre, und die Sternlein blinzelten sich zu — und sie kam noch immer nicht. Die Nacht verging, der Morgen graute — Hold Emmchen kam nicht.
Ja, wo blieb sie denn nur? Nun, sie hatte sich abends ruhig zwischen grünen Tannen auf dem weichen Moos schlafen gelegt, um am anderen Morgen frisch und rüstig weiterlaufen zu können. Als die Sonne aufging, wachte sie auf, rieb sich die Äuglein und sprang auf ihre Füßchen.
Hurtig lief sie zu — da lagen all die großen grauen Steine in ihrem Weg; sie aber sprang lachend mit ihren leichten Füßchen darüber weg und jauchzend die Felsen hinunter. Wütend sah es der silberne Mann aus seinem Versteck und wollte nun, weil seine List mißlungen war, schnell weiter eilen, um nach Magdeburg zu kommen.
Aber, oh weh, o weh! Bei dem langen Stehen war er ganz tief eingesunken in den Sumpf. Alles Strampeln und Zappeln war umsonst — er konnte nicht mehr heraus. Nun muß er immer, immer dort stehen bleiben zur Strafe für seine Tücke— ihr könnt noch die Spitze von seinem silbergrauen Helm aus dem Wald herausragen sehen.
Hold Emmchen aber lief lachend an ihm vorbei nach Magdeburg zum Erzbischof. Der aber war ein guter Mann und sagte, sie sollte nicht dem silbernen Mann seine Frau werden, sondern sollte immerzu lustig weiter singen und springen.
Und das tut Hold Emmchen heute noch, und wenn sie an die großen grauen Felsen von der Steinernen Renne kommt, dann springt sie besonders lustig über sie hinweg und lacht den silbernen Mann aus, der gar nicht weit davon im Walde fest gewachsen steht.
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
STERNENMOOS UND BECHERFLECHTE ...
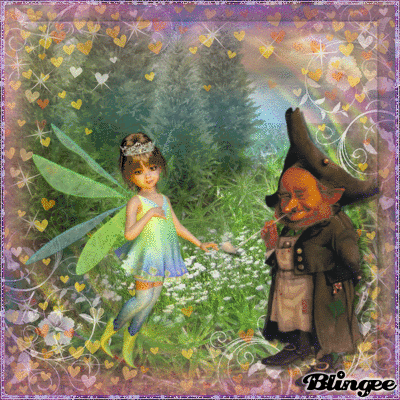
Prinzeßchen Waldtraut spielte am allerliebsten im Walde Verstecken. Da waren so schöne dichte Büsche und hohe Farnkräuter und dicke Baumstämme, hinter denen es sich so verbergen konnte, daß niemand es fand.
Einmal aber war es beim Verstecken so weit in den Wald hinein geraten, daß es sich nicht mehr darin zurecht fand. Es rief seine Gespielinnen, aber es war so weit weg, daß diese es nicht hörten. In seiner Angst lief es immer weiter und weiter, und der Wald wurde immer dunkler, und die Nacht kam immer näher, und Prinzeßchen war schon ganz müde und matt. Und hungrig war es von dem vielen laufen auch geworden und durstig erst recht von der großen Hitze und niemand war da, der seinen Hunger stillen und seinen Durst löschen konnte.
Da legte es sich unter ein grünes, schönes Farnkraut ins weiche Moos und fing bitterlich an zu weinen, denn es meinte, nun müßte es verhungern und verdursten und elend umkommen. Wie es da lag und schluchzte, da stand auf einmal bei ihm ein kleines, altes Großmütterchen, das hatte ein Kleid von lauter grünen Sternen und hielt auf seinem langen, dünnen Arm ein kleines Brot hoch empor.
„Weine nur nicht,“ sagte es zu Prinzeßchen, „sieh, ich bin eine alte Frau und habe auch einmal so ein kleines Mädchen gehabt, wie du bist, aber das ist schon lange, lange tot. Nun werde ich ja wohl bald sterben, aber du bist noch jung und sollst noch leben. Ich habe da noch ein Brot, es ist freilich mein letztes, aber ich will dir es gern geben; um mich ist es ja nicht schade, wenn ich verhungere. Da nimm und iß dich satt.“
Und damit legte es sein Brot ihm in den Schoß und verschwand. Wie Prinzeßchen noch ganz erstaunt da saß, kam ein kleines, graues Männchen angehumpelt, das hatte graue Haare und einen langen grauen Bart und einen harten, ledernen, grauen Mantel und in der Hand ein graues Becherchen und sagte:
„Weine nur nicht, Prinzeßchen, ich habe dein Weinen gehört und bringe dir hier ein Becherchen mit Wasser. Es ist freilich mein letztes Tröpfchen. Aber dir will ich es schon schenken; ich bin ein alter Mann was schadet es, wenn ich verdurste? Aber du bist jung und sollst leben. Da nimm und trink dich satt.“
Und damit stellte es sein Becherchen neben Prinzeßchen; „und wenn du dich satt getrunken und gegessen hast, dann geh nur immer jenem silbernen Stern nach, siehst du ihn? Dort oben steht er, dann kommst du wieder zurück in deines Vaters Schloß.“ Damit verschwand er.
O wie dankbar war Prinzeßchen! Nun aß es sein Brötchen und trank sein Wässerchen und dann lief es schnell dem Stern nach und kam nach Hause. Als aber der Waldkönig und die Waldkönigin hörten, wie es Prinzeßchen gegangen war, da sagten sie beide: „Das gute graue Männchen und das liebe alte Großmütterchen, die dich gespeist und getränkt haben, sollten nicht verhungern und verdursten.
Und Prinzeßchen nahm ein silbernes Becherchen mit wunderschönem, kristallklarem Wasser und eine goldene Stange, auf der ein schönes Brot steckte und lief mit seinen Dienern und Mägden in den Wald zurück. Da fanden sie das alte Großmütterchen schon fast verhungert; Prinzeßchen aber gab ihr das Brot und die goldene Stange dazu und sagte:
„Du sollst nicht Hungers sterben; so oft du diese goldene Stange in die Erde steckst, soll ein Brötchen oben dran sein, damit du dich satt essen kannst dein Leben lang.“
Und dann fanden sie auch das alte Männchen, das war auch schon am Verdursten. Aber Prinzeßchen gab ihm das silberne Becherchen, und so oft er es auf die Erde stellte, war immer ein Tröpfchen des reinsten Wassers drin, so daß er nicht du dürsten brauchte sein Leben lang.
Und nun leben die beiden Alten immer noch, und wenn ihr durch den Wald geht, dann könnt ihr das Großmütterchen Sternenmoos sehen, das sein Brötchen auf goldener Stange hoch hält und nicht weit davon das alte graue Männchen Becherflechte mit seinem silbernen Becher und seinem Wassertröpfchen drin.
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
VON HEIDELBEEREN UND PREISSELBEEREN ...
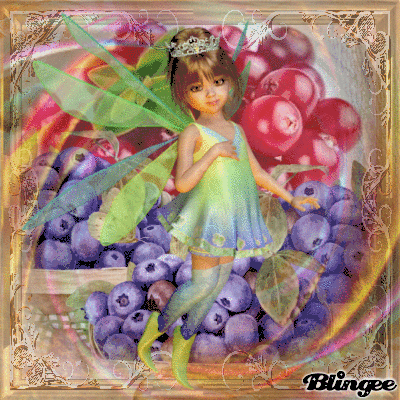
Einmal ging Prinzeßchen Waldtraut auf eine schöne Wiese spielen. Ei, war das ein vergnügtes Völkchen, das sich da tummelte! Frau Schnake mit ihren langen Beinen hüpfte und tanzte mit ihren Schwestern einen schönen Reigen, Blaustrümpfchen und Distelfalter spielten Haschen und alle ihre Freunde und Freundinnen aus dem Schmetterlings Geschlecht machten es ihnen nach.
Bienchen und Hummel spielten Verstecken und krochen bald in dieses, bald in jenes Blümleins Kelch; Frau Grille und ihr Chor sangen zusammen ein fröhliches Sommerlied, kurz und gut, es war ein gar fröhliches Treiben.
Aber Prinzeßchen Waldtraut hätte zu gern Ball gespielt. „Hat denn niemand von euch einen schönen Ball?“ fragte sie. Aber niemand hatte einen Ball bei sich. „Da wollen wir schnell einen kaufen gehen,“ sagte sie zu ihrer Freundin, Prinzeß Heckenröschen; und nun gingen sie zu allen Kaufleuten im ganzen Waldreich, um Bälle zu kaufen.
Zuerst kamen sie zu Herrn Storchschnabel. „Guten Tag, Herr Storchschnabel,“ sagte Prinzeßchen, „haben Sie schöne Bälle zu verkaufen?“ „O ja,“ sagte Herr Storchschnabel, und holte aus seinem Laden einen Ball heraus, der hatte einen ganz langen Schwanz. „Ist der nicht sehr schön?“ sagte Herr Storchschnabel. „Ach, nein,“ sagte Prinzeßchen, „den kann ich nicht brauchen, der hat ja so einen langen, spitzen Schwanz, da steche ich mich daran.“
Da gingen sie weiter zu Herrn Mohnkopf. „Guten Tag, Herr Mohnkopf,“ sagte Prinzeßchen, „haben Sie schöne Bälle zu verkaufen?“ „O gewiß“, sagte Herr Mohnkopf, und holte eine große, runde Büchse und machte ihren Deckel auf. Da lagen viele kleine braune und schwarze runde Bälle drin. „Ach, das sind doch keine Bälle,“ sagte Prinzeßchen, „die sind ja so klein, das sind man bloß Murmeln, die kann ich nicht brauchen.“
Nun kamen sie zu Frau Walderbse. „Guten Tag, Frau Walderbse,“ sagte Prinzeßchen, „haben Sie nicht schöne Bälle zu verkaufen?“ „O natürlich,“ sagte Frau Walderbse und brachte eine lange, schmale Schale. Da lagen grüne Dingerchen drin, die sahen aus wie Bälle. Aber als Prinzeßchen sie aufhob, da sah sie, daß sie ganz platt waren wie Harzer Käse. „Ach nein,“ sagte sie, „die können ja nicht schön kullern, die kann ich auch nicht brauchen.“
„Wo gehen wir aber nun noch hin?“ fragte Prinzeßchen ihre Freundin. „Wir wollen doch mal zum Juden Veilchenfeld gehen, der hat gewiß welche,“ antwortete Prinzeßchen Heckenröschen. Da gingen sie zu Herrn Veilchenfeld. „Guten Tag, Herr Veilchenfeld,“ sagte Prinzeßchen, „haben Sie nicht schöne Bälle zu verkaufen?“ „Mit Vergnügen, Königliche Hoheit,“ schmunzelte Veilchenfeld, „wird mir sein ´ne große Ehre, zu bedienen Königl. Hoheit.“
Und nun schleppte er eine ganze Kiste heran mit graubraunen rundlichen Kugeln; die hatten aber auf drei Seiten solche dicken Nähte, daß Prinzeßchen sie gar nicht anfassen wollte. Aber als sie es doch wagte und ein bißchen drückte, ob sie auch fest wären, da platzten die Nähte, und alles, was drin war, kullerte heraus.
Da machte Herr Veilchenfeld ein sehr verlegenes Gesicht aber Prinzeßchen warf den kaputten Ball weg. „Die kann ich auch nicht brauchen,“ sagte es und ging davon. Soweit sie nun auch noch gingen, soviel sie nun auch fragten niemand hatte schöne Bälle. Da ging Prinzeßchen nach Hause und weinte, daß sie im ganzen Waldkönigreich keine schönen Bälle hatte finden können.
Als das der Waldkönig hörte, rief er seine Minister zusammen und hielt mit ihnen einen großen Rat, woher sie für Prinzeßchen Bälle kriegen könnten. Schließlich wurde beschlossen, in der Zeitung eine Bekanntmachung zu erlassen, daß alle Ballfabrikanten mit ihren Bällen kommen sollten, damit der Waldkönig selbst die schönsten für sein Töchterchen aussuchen könnte. Und wer die schönsten hätte, der solle Hoflieferant werden.
Kaum hatte das in der Zeitung gestanden, da kamen auch aus allen Ecken und Enden des Reiches die Fabrikanten angefahren, um ihre Proben vorzulegen.
Zuerst kam Herr Holzapfel; der trat sehr bescheiden auf, hatte aber ein niedliches Töchterchen, das hieß Grete; die sollte die Bälle dem Herrn König vorlegen, denn er meinte, dann würde sie der
Herr König schon nehmen.
Freilich waren sie sehr hart, aber sie sollte nur recht weich sprechen, dann würden sie dem Herrn König schon gefallen. So machte sie denn einen tiefen Knicks vor dem Waldkönig und sagte: „Guden Dag, Herr Gönig.“ Aber wie der König die Bälle anfaßte, waren sie doch so hart und so groß, daß er sie nicht haben wollte; denn Prinzeßchen hatte doch so ganz kleine, zarte Händchen.
Da ging Herr Holzapfel traurig davon. Dann kam Herr Caddik; der war aus Ostpreußen gekommen und hatte wunderschöne schwarzbraune Bälle mit einem blauen, weichen Samt Bezug. Die hätten dem Prinzeßchen schon gefallen; aber sie rochen gar nicht schön, und sie sagte: „Pfui, die beißen ja!“ Aber Herr Caddik meinte: „I nein, mein trautstes Marjallchen! Die sind doch goldig!“
Da nahm Prinzeßchen ein Bällchen in die Hand, aber als sie es anfaßte, da ging der ganze schöne blaue Samt herunter — da war es auch mit Herrn Caddik seinen Bällen vorbei. Nach ihm ließ sich Herr Quitsche melden; der brachte gleich einen ganzen Strauß von feuerroten Bällen, die hingen alle an grünen, dicken Strippen und sahen ganz prächtig aus.
Aber als Prinzeßchen sie anfassen wollte, da bat er höflich, Prinzeßchen möchte doch recht vorsichtig damit umgehen, sie wären sehr zart; es wäre am besten, sie hingen immer so hoch, daß niemand dran rühren könnte. Und richtig, als Prinzeßchen einen Ball ein bißchen fest anfaßte, quitsch, da zerdrückte sie ihn da war es auch mit Herrn Quitsche seinen Bällen nichts.
Zuletzt kam Herr Weißdorn; der hatte auch schöne rote Bälle, aber er hatte es ganz extra fein machen wollen, und weil doch die Bälle für ein Prinzeßchen sein sollten, hatte er auf jeden seiner roten Bälle ein richtiges schwarzes Krönchen drauf gesetzt das sah ja nun sehr fein aus, aber natürlich konnten die Bällchen gar nicht kullern was sollte da Prinzeßchen mit ihnen anfangen?
Das war nun aber ganz schlimm und traurig, daß auch die großen und berühmten Ball Fabriken keine schönen Bälle machen konnten. Waldkönig war ganz böse. Aber wenn Waldkönig bei seinen Ministern keinen Rat fand, dann rief er seinen klugen Meister Bimbam, der ihm damals bei Prinzeßchens Geburt die schönen Glocken gemacht hatte.
„Meister Bimbam,“ sagte er, „wißt Ihr denn niemanden, der schöne Bälle macht?“
„O ja, Herr Waldkönig,“ sagte Bimbam, „ich kenne zwei Brüder, die haben freilich keine schöne, große Fabrik, wie die Herren Holzapfel und Caddik und Quitsche und Weißdorn; das sind ein paar ganz
arme Brüderlein, die haben nur eine ganz armselige Wohnung und eine ganz einfache Werkstätte. Das sind die Brüder Beere, Heidel und Preisel.“
„Geh, hole sie mir her,“ sagte der Waldkönig. „Aber sie haben keine schönen Kleider“, sagte Bimbam. „Das tut nichts,“ erwiderte Waldkönig; der braucht noch lange nicht tüchtig zu sein, der ein schönes Kleid trägt, und der noch lange nicht untüchtig, der ein armes Kleid anhat. Aufs Kleid kommt es nicht an.“
Da rief Meister Bimbam die beiden Brüder. Und sie kamen ganz schüchtern und ängstlich, denn sie waren noch nie beim König gewesen und wußten gar nicht, wie man mit einem König sprechen mußte. Ihre Bällchen hielten sie ganz versteckt unter ihrem grünen Arbeitsanzug; denn einen besseren hatten sie nicht.
Als sie nun so zum König kamen, ganz bescheiden und demütig, und prahlten gar nicht mit ihren schönen Bällen, sondern machten bloß einen tiefen Diener vor dem Herrn König, da fragte er sie: „ich habe von euch gehört, daß ihr fleißige und brave Untertanen seid. Könnt ihr auch schöne Bälle für mein Prinzeßchen machen?“
„Ach, Herr König,“ sagte da Heidel, „meine Bälle sind gar nicht sehr schön; bloß blau. Aber ich habe kein Geld, um schönere Farben zu kaufen.“ „Und meine sind nur rot,“ sagte Preisel, „die werden dem gnädigen Herrn König gewiß nicht gefallen; denn für ein Prinzeßchen müssen die Bälle doch golden und silbern sein.“
„Zeig sie nur einmal her,“ sagte der König. Da nahm Heidel sein blaues Bällchen ganz verstohlen aus seiner Tasche und hielt es dem König hin und Preisel sein rotes. Als aber Prinzeßchen die sah, da gefielen sie ihm so gut, daß es gleich sagte, die wollte es haben und keine anderen, und die wären so schön, daß sie gleich hunderttausend Millionen davon alle Jahre für ihre Freundinnen haben wollte.
Da erschraken freilich Heidel und Preisel sehr, denn sie meinten, soviel könnten sie doch nicht in ihren kleinen Werkstätten herstellen. „Da will ich euch schon helfen,“ sagte der König, und befahl, daß im ganzen Reich Fabriken gebaut werden sollten für die Brüder Heidel und Preisel.
Die beiden Brüder aber wurden von ihm hochgeehrt und wurden Hoflieferanten und bekamen die Firma:
Heidelbeere und Preiselbeere
Fabrik für Prinzeßchen Waldtraut
Ihre Spielbälle
Hoflieferanten Seiner Majestät des
Waldkönigs.
Und jedes Jahr liefern sie viele hunderttausend Millionen blaue und rote Bälle; die gehen in großen Körben in alle Welt, und Prinzeßchen ihre Freundinnen bekommen jedes Jahr von ihr neue geschenkt.
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
FEE SONNENTAU ...
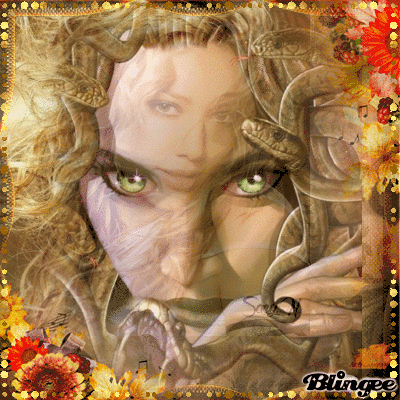
In Waldkönigs Reich lebte vor vielen tausend Jahren eine wunderschöne Fee. Die hatte weiße Blümchen in ihrem Haar und ein grünes Röckchen mit lauter roten Fransen dran und an jeder Franse eine herrliche Perle; ihr Schloß stand in einem wunderschönen Garten, in dem die lieblichsten Blumen dufteten, und die buntesten Schmetterlinge sich im Sonnenschein wiegten, und die aller herrlichsten Vögelchen sangen.
Und sie selber war so lieblich von Angesicht, daß niemand sie sehen konnte, ohne sich in sie zu verlieben. Und weil die Perlen an ihrem Kleid glitzerten wie die Tautröpflein im Sonnenschein, hieß sie die Fee Sonnentau.
Aber sie war eine böse, böse Zauberin. Freilich, weil sie so lieblich aussah, wollte es niemand glauben, und wer es doch behauptete, den lachten die anderen aus.
Weil sie ab er so wunderlieblich war, darum konnten die jungen Edelknaben und Pagen des Waldkönigs und die jungen Prinzen und Rittersöhne sich gar nicht satt an ihr sehen und jeder hätte sie am
liebsten zur Frau gehabt.
Da faßte sich einmal der junge Ritter Heldbock ein Herz und schlich sich heimlich in ihren Zaubergarten. „Schöne Fee Sonnentau,“ sagte er, „du bist so schön und ich habe dich so lieb, willst du nicht meine Frau werden?“ Und ehe sie noch antworten konnte, wollte er ihr einen Kuß geben.
Aber da verwandelte sie sich in ein ganz schreckliches Ungeheuer: ihre roten Fransen wurden zu greulichen Schlangen, die sich um seinen Leib wickelten, und ihre Perlen zu klebrigen Tropfen, an denen er so fest kleben blieb, daß er nicht wieder los konnte, und die Schlangen sogen ihm das Blut aus den Adern und das Leben aus dem Leibe und die Seele aus dem Körper. Da mußte Ritter Heldbock eines elenden Todes sterben.
Und als er tot war, da ließen ihn die Schlangen los und Fee Sonnentau winkte ihren Dienern, Regentropfen und Windhauch, die trugen die Leiche hinaus und vergruben sie so tief, daß niemand sie fand. Ritter Heldbock war nicht wieder gekommen. Niemand wußte, wo er geblieben war. Aber Fee Sonnentau lächelte weiter, als ob nichts geschehen wäre.
Da ging ein anderer junger Ritter zu ihr, das war Ritter Ordensband — aber auch er kam nicht wieder. Niemand wußte, wo er geblieben war. So geschah es viele, viele Jahre; Prinz Siedbenpunkt verschwand in ihrem Zaubergarten und Junker Harlekin mit seinem schwarz-weiß-gelben Mantel, selbst der tapfere Ritter Rebenstecher mit seiner spitzen Lanze und Ritter Gelbrand mit seinem breiten Schild kamen nicht wieder.
Da machte sich zuletzt Junker Goldschmied auf, um seinen verschwundenen Freund zu suchen. Der war wegen seiner List und Tapferkeit im ganzen Land gefürchtet und niemand konnte ihm etwas anhaben. Als er zur Fee Sonnentau kam, da war freilich auch er von ihrer Schönheit bezaubert und wollte sie umarmen.
Aber wie er merkte, daß sie sich in ein greuliches Ungeheuer verwandelte und schon ihre klebrigen Krallen ihn festhalten und schon ihre greulichen Schlangen ihn umwinden wollten, da schoß er ihr einen ganz abscheulich übelriechenden gelben Saft ins Gesicht, daß sie laut aufschrie und ihn loslassen mußte.
Schnell floh Junker Goldschmied und kehrte zurück in Waldkönigs Reich, krank freilich und siech für sein ganzes Leben, denn die Fee Sonnentau hatte ihn schon vergiftet. Aber nun erzählte er, wie es ihm ergangen war, und nun wußten alle, wo die Prinzen und Ritter und Junker und Edelknaben geblieben waren.
Da ging ein lautes Wehklagen durchs ganze Reich und alle Väter und Mütter der gemordeten Jünglinge gingen zum Waldkönig und klagten ihm ihr Leid. Da wurde Waldkönig zornig und ließ Fee Sonnentau vor sich rufen.
Wunderlieblich wie immer stand sie vor ihm. Aber er sprach: „Weil du die besten Söhne meines Reiches vergiftet und umgebracht hast, sollst du verflucht und verbannt sein, sollst in der öden Einsamkeit leben und von ekelhafter Speise dich nähren.“
Und wie er das gesprochen, da versank der Zaubergarten und das Schloß der Fee und verwandelte sich in ein ödes, sumpfiges Land mit schwarzem Schlamm und rotbraunen Halmen und tiefen Wasserlöchern — und wenn ihr einmal so ein Land findet, hoch oben im Gebirge — die Leute nennen es Hochmoor — und seht dort ein Pflänzchen mit kleinen weißen Blüten und grünen runden Blättchen mit roten Haaren drauf und auf jedem Haar einen klebrigen Tropfen, das ist Fee Sonnentau; die muß im öden Hochmoor wohnen und Fliegen und Käfer essen ihr Leben lang.
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
DER SONNENFÜNKCHEN ERDENFAHRT ...
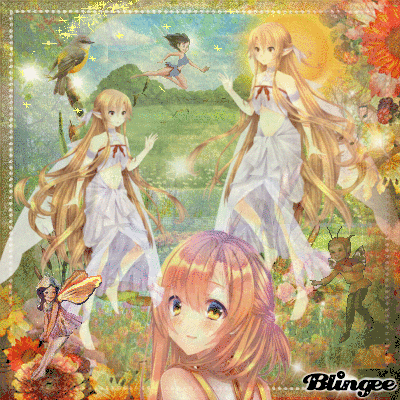
„Liebe Mutter Sonne,“ sagten eines Tages die Sonnenfünkchen, „laß uns doch ein bißchen auf die Erde hinunter springen. Wir möchten gern spielen! Bitte, bitte!“—„Wir möchten gern im Wässerchen pantschen,“ riefen die einen, und „wir möchten gern auf den grünen Blätterchen tanzen,“ sprachen die anderen, und „wir möchten uns gern auf der Wiese lagern“, schrien die dritten dazwischen, und noch andere wollten gern im Walde Verstecken spielen.
Und so baten sie und bettelten, bis Mutter Sonne ihnen ihren Willen tat. „Meinetwegen,“ sagte sie, „springt hin, aber hütet euch vor den bösen Riesen auf der Erde da unten!“ „Ach, die werden uns schon nichts tun. Wir werden schon aufpassen,“ schrien die Sonnenfünkchen durcheinander, froh, daß sie nun auf die Erde hinunter konnten. Schnell sprangen sie davon.
O, wie wunderschön war das auf der Erde! Da gab es große, weite Seen, in denen sie baden oder auf einem Blattkahn spazieren fahren konnten, und die waren so klar wie ein Spiegel—und auf einmal schrien sie ganz laut vor Vergnügen, denn sie sahen im Spiegel Mutter Sonne ihr rundes, freundliches Gesicht, das lachte sie so fröhlich an, und sie warfen ihm tausend Grüßchen und Kußhändchen zu!
Und da gab es plätschernde Bächlein, mit denen hüpften sie über Stock und Stein und purzelten lachend durcheinander, um dann wieder lustig in die Luft zu springen. Und grüne, schöne Wiesen waren auch da, auf denen sie Ringel, Ringel, Reihen spielten oder Purzelbäume schlagen konnten; am allerschönsten aber wars im Walde, wenn sie an den Baumstämmen hinauf klettern und herunter huschen konnten mit den Eichhörnchen um die Wette. Und alles, was auf Erden lebte, das freute sich an dem lustigen Spiele der Sonnenfünkchen; wohin sie kamen, hieß man sie herzlich willkommen.
Die Mücken veranstalteten ihnen zu Ehren gleich einen großen Ball, auf dem sie mit ihren langen Beinen die zierlichsten Menuetts tanzten; die Vögelchen stimmten ein Konzert an, bei dem Frau Lerche und Frau Nachtigall ihre aller schönsten Lieder sangen; selbst die großen, schrecklichen Ungeheuer, die Rieseneidechsen und Krokodile, die so große Mäuler hatten, daß sie hunderttausend Millionen Sonnenfünkchen auf einmal hätten aufessen können, blinzelten ganz vergnügt mit ihren Glotzaugen, wenn die Sonnenfünkchen ihnen ihre schuppigen Panzer blitzblank putzten, und sogar Isegrim, der Brummbär, ließ sichs ganz behaglich gefallen, wenn sie ihm seinen braunen Pelz kraulten.
Nur zwei waren gar nicht zufrieden mit ihnen, das waren die beiden bösen Riesen Rumpelberg und Rauscheflut. Denn Rumpelberg hatte sich einmal zum Mittagsschlaf hingelegt, und wie er gerade im schönsten Schnarchen war, da hatten so ein paar kleine übermütige Sonnenfünkchen ihn in der Nase gekitzelt; davon war er aufgewacht und hatte schrecklich niesen müssen.
Und wenn Rumpelberg nieste, dann klang es, als ob ein Gewitter los ginge und im ganzen Lande hallte es tausendfach wider, daß alle Vögelchen erschreckt aufflatterten und alle Tierchen angstvoll in ihre Höhlen krochen, und wenn Rumpelberg seine Fäuste schüttelte, dann zitterten die Berge und die Erde wackelte, daß alles, was darauf stand, durcheinander kollerte.
Die Sonnenfünkchen hatten seitdem schreckliche Angst vor ihm, den er hatte ihnen Rache geschworen dafür, daß sie ihn im Mittagsschläfchen gestört hatten. Darum trauten sie sich nicht in die Höhle, wo er wohnte; nur manchmal schlichen sie ein paar Schrittchen hinein oder guckten durch ein Fensterchen hinunter, aber da war es so schrecklich dunkel und kalt, daß sie immer schnell machten, daß sie wieder heraus kamen.
Und Rauscheflut war ihnen auch gram. Der wohnte in einem schönen, gläsernen Schloß im Meer und hatte sein besonderes Vergnügen daran, auf seinen weißen Rossen über sein weites Reich hinzujagen und mit den lieblichen Meerjungfern und Wassernixen Haschen zu spielen. Aber seitdem die Sonnenfünkchen gekommen waren, wollten seine Gespielinnen gar nicht mehr mit ihm herumtollen, sondern spielten viel lieber mit den lustigen, kleinen Sonnenfünkchen. Das ärgerte ihn und er schwor, er wollte alle Sonnenfünkchen umbringen.
Da machte er sich eines Tages auf und besuchte seinen Freund Rumpelberg. Lange saßen sie beieinander und klagten sich ihr Leid, daß die Sonnenfünkchen sie in ihrem schönsten Vergnügen störten, den einen in seiner Mittagsruhe, den anderen in seinem Haschenspielen, und sie beschlossen zusammen, alle Sonnenfünkchen müßten sterben. Aber sie wußten nicht, wie sies anfangen sollten.
„Ich weiß Rat,“ rief auf einmal Rauscheflut; „komm, wir wollen den Doktor Bazillus holen, der kriegt es gewiß fertig.“ Doktor Bazillus aber war ein schlimmer Zauberer und Giftmischer, freilich so winzig klein, daß Rauscheflut erst seine grünliche Brille aufsetzen mußte, um ihn zu sehen, und Rumpelberg in seiner dunklen Höhle erst ein Licht anzünden mußte, um ihn zu finden; aber er war der gefährlichste und gefürchtetste Zauberer auf der ganzen Erde.
Er hatte hunderttausend ganz winzige, kleine, spitze Nadeln, und wen er damit bloß ein ganz klein bißchen piekte, der mußte sterben. Der sollte nun auch alle Sonnenfünkchen tot pieken. Aber Doktor Bazillus konnte das nicht. „Seht,“ sagte er ihnen, „das ist mein täglicher Ärger, daß die Sonnenfünkchen alle meine Arbeit zuschanden machen! Wenn ich einen pieke, dann läuft er zu den Sonnenfünkchen, und die machen ihn wieder gesund. Nein, denen kann ich nichts anhaben.“
Da wurde Rumpelberg so wütend, daß er beide Fäuste schüttelte. Und wie er so schüttelte, da bebte die ganze Erde, und alle ihre Säulen brachen zusammen, und ein großer feuerspeiender, schwarzer Abgrund tat seinen Rachen auf und verschlang den Wald, in dem die Sonnenfünkchen gerade spielten, und alles stürzte in die Tiefe; und fiel auch Rauscheflut über sie her und deckte sie solange zu, bis sie alle erstickt waren. Da waren nun die armen Sonnenfünkchen mausetot und tief, tief unter der Erde begraben und da schliefen sie einen langen, langen Todesschlaf, wohl ein paar tausend Jahre lang.
Als Mutter Sonne hörte, daß ihre lieben Sonnenfünkchen tot waren, da war sie ganz, ganz traurig und hing sich einen dicken, schwarzen Wolkenschleier vors Gesicht, wie das die feien Damen machen, wenn jemand gestorben ist, und weinte bitterlich, und ihre Tränen fielen auf die Erde. Auf der Erde aber war es so kalt und dunkel, seit die Sonnenfünkchen tot waren, und Mutter Sonne ihre Tränen wurden zu Schnee und Eis, und die Blümelein krochen tief in die Erde, und die Würmchen und Käferchen wühlten sich tief in den Schlamm und Sand, und die Tierchen zogen ihren dicksten Pelz an, und die Menschen machten sich warme Kleider und alle dachten:
„Ach, wenn wir doch die lieben Sonnenfünkchen wieder hätten!“ „Wir wollen sie doch aus der Erde wieder heraus holen!“ sagte der Maulwurf, und gleich fing er an, mit seinen Schaufeln zu graben. Aber soviel er auch suchte, und wenn ihm schließlich auch vor lauter Suchen seine Augen blind wurden, er fand sie nicht; Rumpelberg hatte sie ganz tief versteckt und einen steinernen Riegel vor die Tür gemacht. „Den kriege ich nicht auf,“ klagte er.
Wir wollen dir helfen,“ sagten da die Menschen, und nun banden sie sich einen ledernen Schurz um und nahmen in die eine Hand Hacke und Hammer und in die andere eine Laterne, und nun gruben sie tiefe Gänge in die Erde, und wenn auch Rumpelberg sie mit seinem heißen Atem anhauchte und viele von ihnen totschlug sie drangen immer, immer weiter vor.
Und richtig, eines Tages fanden sie die Särge der Sonnenfünkchen ganz kohlrabenschwarze Särge, viele hunderttausend Millionen, und da drin lagen die lieben, kleinen Sonnenfünkchen bleich und starr und kalt. Vorsichtig nahmen die Menschen die schwarzen Särge und brachten sie hinauf auf die Erde; aber die Sonnenfünkchen waren und blieben tot.
Sie hauchten sie warm an, wie die Kinder die regungslosen Maikäfer aber sie regten sich nicht. „Wir wollen sie doch ans Feuerchen stellen,“ sagte einer, „vielleicht erwärmen sie sich und werden wieder lebendig.“ Und richtig, kaum standen sie am Feuerchen, da fingen die schwarzen Särge an, ganz rot und golden zu werden, und auf einmal ging es: Knister Knaster und ein Sonnenfünkchen nach dem anderen sprang lustig aus seinem schwarzen Totenbettchen und alle freuten sich, denn nun wurde es so schön hell und warm, selbst mitten im Winter.
Aber es liegen noch viele hunderttausend Millionen Sonnenfünkchen in der Erde begraben, und darum steigen die Menschen noch immer hinunter und holen ihre schwarzen Särge heraus.
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
DAS MÄRCHEN VOM STEINERNEN KRÜPPELCHEN ...
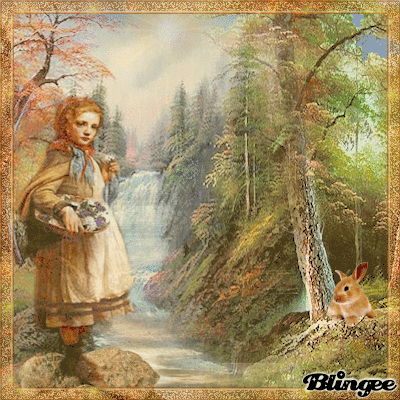
Lebte da einmal im tiefen Walde ein armer Waldarbeiter mit seiner Frau, die hatten ein einziges Kindlein und das war ein armer Krüppel; es hatte einen großen Kopf und einen ganz krummen Rücken, nur ein Auge und nur ein Ärmchen, und seine Beinchen waren so schwach, daß es nicht gehen konnte, sondern immer sitzen mußte. Die armen Eltern waren sehr traurig darüber.
Als Krüppelchen noch nicht ein Jahr alt war, da fiel seinem Vater beim Baumfällen ein Baumstamm auf den Kopf und schlug ihn tot; und als man den toten Mann nach Hause brachte, erschrak die Frau so, daß sie auch starb. Da wurden beide zusammen begraben und Krüppelchen war mutterseelenallein in der Welt. Was sollte aus ihm werden?
Niemand wollte sich des armen Waisleins annehmen. Da bestimmte der Oberförster, daß alle Leute im ganzen Walde es der Reihe nach jeder einen Monat lang verpflegen müßte. So wurde Krüppelchen von Haus zu Haus gestoßen; überall bekam es unfreundliche Gesichter, wenig zu essen und viel Schläge und böse Worte. Alle schimpften über die Last, die sie mit dem armen Krüppelchen hatten, und meinten, es wäre doch am besten, wenn es stürbe.
Aber es starb nicht; im Gegenteil, es wurde alt und immer älter, Jahr um Jahr ging dahin, und Jahrzehnt um Jahrzehnt verrann; schließlich war es ein steinaltes, eisgraues Männchen mit grauem Haar und grauem Bart und grauem Gesicht, und die ältesten Leute im Wald konnten nicht sagen, ob es hundert oder tausend Jahre alt war.
Noch immer trug man es Monat um Monat von Haus zu Haus, bis sie ihm schließlich einen Platz am Bergeshang gaben, wo es Tag und Nacht, jahraus, jahrein auf einem Fleck saß. Noch immer schimpften die Leute, die ihm sein tägliches Essen hin tragen mußten, noch immer verspotteten es die bösen Buben und machten ihm seinen krummen Rücken und sein schielendes Auge und seinen schiefen Mund nach.
Niemand, niemand hatte ihm Freundlichkeit erwiesen; da war auch sein Herz vor Bitterkeit hart wie Stein geworden. und weil es aussah wie ein großer grauer Stein, nannten sie es den steinernen Krüppel.
Nur einmal war eine freundliche Fee zu ihm getreten und hatte ihm gesagt: „Krüppelchen, wenn dir nur ein einziges Mal jemand etwas Liebes tut, so wirst du für viele zum Segen werden.“ Aber ach, würde ihm nur ein einziges Mal jemand etwas Liebes tun?
Früher war es seine Freude gewesen, wenn es mit seinem einen Arm die Blümchen in seiner Nähe hatte gießen können und sie dann schön blühten und dufteten. Aber schon lange wollte ihm keiner mehr dazu Wasser bringen, und nun hatten sie auch seine Gießkanne ihm weg genommen und den Berg hinunter geworfen.
So saß es wieder einmal stumm und still auf seinem Platze. Die bösen Leute aber, die es längst gern los gewesen wären, hatten beschlossen, es heimlich den Berg hinunterzustürzen und zu sagen, es sei von selbst hinunter gefallen.
Es war Nacht, Krüppelchen war eingeschlafen da kamen zwei Männer heimlich heran geschlichen und stießen es den Berg hinunter. Wie es da hinunter kollerte und sich im rollen immer überschlug! Die bösen Leute lachten noch darüber und waren froh, es los zu sein, denn sie meinten, nun sei es gewiß tot.
Aber Krüppelchen war nicht tot, es schlief nur einen langen, langen Schlaf. In einem tiefen Tale lag es zwischen Brombeergestrüpp in sumpfigem Grunde und schlief und schlief vielleicht hundert, vielleicht tausend Jahre.
Da geschah es eines Tages, daß ein kleines Mädchen, das Beeren suchen wollte, sich in der Dämmerung dahin verirrt hatte, wo Krüppelchen schlief. Angstvoll suchte es sich durch die Dornen einen Weg zu bahnen, seine Füßchen sanken in dem Sumpf immer bis über die Knöchel ein, es wurde immer dunkler ach, wo sollte es bleiben?
Es war so müde, so müde, daß es gar nicht weiter konnte, und hier in dem nassen Sumpfe konnte es sich doch nirgends hinsetzen und ausruhen. Da sah es im Mondlicht etwas Graues liegen, gewiß ein großer Stein! Ach, wie war es dem lieben Gott dankbar dafür! Nun setzte es sich darauf und schlief ein.
Die Sonne schien schon warm vom blauen Himmel, als es aufwachte. Schnell sprang es auf, um heimwärts zu eilen, aber erst beugte es sich nieder zu dem großen Stein, auf dem es gesessen. „Du guter alter Stein,“ sagte es „wärst du nicht hier gewesen, so wäre ich elendig umgekommen. Lohne dir es der liebe Gott, daß du mich davor bewahrt hast.“ Und es legte seine weichen, warmen Ärmchen um den alten Stein und gab ihm einen Kuß. Dann sprang es auf und davon.
Da wachte Krüppelchen auf. Ja, was war denn das? Ein Paar freundliche blaue Augen, die ihn so lieb ansahen, ein Paar weiche Händchen, die ihn gestreichelt, gar ein warmer Kuß das war ihm sein leben lang noch nicht vorgekommen.
Und auf einmal fing es in seinem Herzen an sich zu regen und aus seinem Herzen brach eine silberhelle Quelle hervor und sprang als ein munteres Bächlein zu Tal und wohin es kam, da grünten die Wiesen, da blühten die Blumen, da tranken die kranken aus seinen Wellen sich gesund, und alle Menschen priesen das wunderbare, so viel Segen spendende Bächlein.
Die gute Fee aber erschien wieder bei dem steinernen Krüppel und sagte: „Siehe, nun hat eines Kindes Liebe dir Gutes erwiesen, nun kannst du mit deinem Bächlein vielen Tausenden zum Segen sein.“
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
VON DER STOLZEN TANNE ...

Vor langer, langer Zeit lebte einmal in einem wunderschönen Tal ein Tannenmütterchen mit seinen vielen hundert Kinderchen. Als Tannenmütterchen alt wurde und es zum Sterben ging, da rief es alle seine Kinderchen zu sich und sagte:
„Kinderchen,“ sagte es, „haltet immer hübsch zusammen und vertragt euch miteinander; Einigkeit macht stark! Und bleibt immer hübsch bescheiden; denn Hochmut kommt vor dem Fall!“
Das versprachen die Tannenkinderchen auch. Und als Tannenmütterchen gestorben war, da wohnten sie alle zusammen friedlich und fröhlich und ganz dicht beieinander. Freilich, je größer sie wurden, um so knapper wurde der Raum, um so spärlicher die Nahrung, um so mehr mußten sie sich recken und strecken, wenn sie einen Sonnenstrahl erhaschen wollten.
Aber sie hielten treu zusammen, und abends, wenn der Abendwind wehte, dann steckten sie ihre Köpfchen zusammen und erzählten sich leise, was sie am Tage erlebt und erlauscht hatten. Nur eine von ihren Schwestern hatte Tannenmütterchens Ratschläge schnell vergessen.
Unter den vielen Geschwistern gefiel es ihr nicht; da konnte sie sich gar nicht breit machen, da mußte sie sich nach allen anderen richten und mußte sich rücken und ducken. Das paßte ihr nicht. Da wars doch da draußen viel lustiger und schöner. So hatte sie für sich ganz allein oben am Berge ein Plätzchen gesucht; ei, wie da die Sonne warm schien, wie sie da sich strecken und sich dehnen konnte, wie sie da weit ins Land schauen und über ihre Schwestern hinweg sehen konnte!
Und wirklich, sie wurde die schönste Tanne im ganzen Lande; hoch und schlank war sie gewachsen; ihre Arme breitete sie wie zum Segen nach allen Seiten aus, ihr grünes Kleid schleppte sie beinahe bis auf die Erde, und alle Menschen bewunderten sie und freuten sich ihrer Schönheit, und sie selbst sah stolz im Wasserspiegel zu ihren Füßen ihr Bild.
Ob ihre Schwestern und Brüder nicht neidisch zu ihr aufblickten? ...
Da kam ins Land ein böser, böser Gast, das war der Riese Herbst mit seinen Dienern Sturm und Wetter. Der fuhr auf seinem schnaubenden, Schweiß triefenden Wolkenroß durch das Land, und wehe, wer sich ihm trotzig widersetzte, den schlug er mit eiserner Faust nieder und warf ihn in den Staub.
Nun kam er auf seinem wilden Ritt auch zu dem Bergtal, in dem die Tannengeschwister wohnten. Hu, wie er fauchte und drohte! Wütend stürzte er sich auf die Tannengeschwister.
Ängstlich duckten sie die Köpfe und schmiegten sich dicht aneinander, ächzend und stöhnend bogen sie sich unter seinen Streichen—aber sie hielten ihnen tapfer Stand, denn eins schütze und stützte das andere, und die draußen am Wiesenrande standen, die breiteten ihre starken Arme wie zum Schutz vor ihre Geschwister—da mußte der böse Riese Herbst polternd weiter ziehen.
Oh weh, wie sahen sie aus? Zerzaust und zerrissen waren ihre Kleider, die einen hatten ihren Arm gebrochen und die anderen hatten sich kaum noch auf den Füßen halten können. Aber sie waren doch alle mit dem Leben davon gekommen, denn sie hatten treulich zusammen gehalten.
Wie sie sich von ihrer Angst erholt hatten, da sahen sie sich nach ihrer Schwester um—aber welch ein Schreck fuhr da in ihre Glieder! Da lag die stolze Tanne am Boden mit ihrer ganzen schönen Pracht. Des Riesen Diener Sturm hatte sie gepackt und ein leichtes Spiel gehabt—denn sie hatte niemanden, der sie schützte.
Die Tannengeschwister aber flüsterten sich leise zu: „Arme Schwester, wärst du bei uns geblieben, wir hätten dich gehalten. Warum warst du zu stolz dazu?“
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
WIE DER FROSCH VOM TEICH SCHULZE WURDE ...
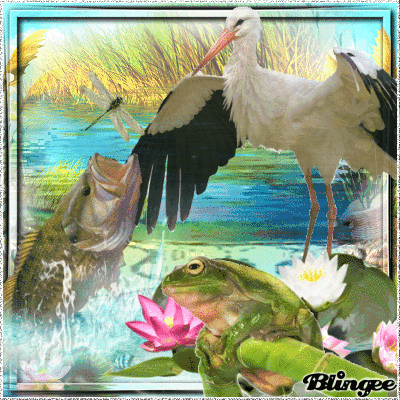
Im Teich lebten viele, viele Tiere, aber sie lebten immer im Streit miteinander.
Da war die Wasserspinne, die tanzte immer kreuz und quer über den Teich dahin; aber da kam das Fischlein und schnappte nach ihr. „Autsch, mein Bein““ schrie sie. „Du darfst mich doch nicht
beißen!“
Das Fischlein schwamm weiter und spielte im Sonnenschein aber da kam die Frau Ente und schnappte nach ihm. „Autsch, mein Schwanz!“ schrie es. „Du darfst mich doch nicht beißen!“
Die Ente tauchte wieder auf und watschelte ans Ufer; aber da lauerte der Herr Fuchs und schnappte nach ihr. „Autsch, meine Flügel!“ schrie sie. „Du darfst mich doch nicht beißen!“
Und flog eine Libelle übers Wasser, gleich kam der Rohrspatz und schnappte nach ihr, und saß der Rohrspatz auf dem Rohr, gleich kam der Habicht und wollte ihn fressen, und kroch ein Käferchen am Rande des Teiches, gleich kroch ein Salamander hinter ihm her; saß eine Fliege am Halm, gleich schnappte der Frosch nach ihr und dann kam Herr Langbein mit seinem Schnabel und wollte den Frosch verzehren.
Kurz und gut, jedes wollte den anderen beißen und doch nicht gebissen sein. Darum war immer Streit und Zank am Teich. Da kamen eines Tages alle Tiere zusammen und sagten, das könne so nicht weiter gehen; sie wollten einen Schulzen wählen, der auf Recht und Ordnung im Teiche sähe. Alle waren so zufrieden, aber wer sollte Schulze sein?
„Wer am schönsten singen kann!“ sagte der Rohrspatz, denn er wollte gerne Schulze werden, und fing gleich an, sein Liedlein zu pfeifen. „Ach nein,“ sagte die Wasserspinne, „sondern wer am schönsten tanzen kann!“ Denn sie wollte gern Schulze werden und fing dann auch gleich an, mit ihren langen Beinen ein zierliches Menuett zu tanzen.
„Nein, nein, wer am längsten schlafen kann,“ sagte der Salamander; denn er wollte auch gerne Schulze werden und war eben erst von seinem Winterschlaf aufgewacht. „Das fehlte gerade!“ rief quakend die Ente dazwischen, „sondern wer die schönsten Federn hat.“ Die hatte sie natürlich, und fing denn auch alsbald an, sie zu putzen und damit schön zu tun.
„Kinder,“ knarrte da ein alter Karpfen, der schon ganz bemoost war, dazwischen, „das ist alles Unsinn. Wer Schulze sein will, der muß flink auf den Beinen sein, damit er im ganzen Teich schnell nach dem Rechten sehen und fix überall hin kommen kann. Laßt uns einen Wettlauf machen, und wer am ersten auf dem anderen Ufer ist, soll Schulze sein!“
„Du hast recht“, riefen alle Tiere. „Also los!“ So traten sie dann alle an. „Eins, zwei, drei!“ kommandierte der Karpfen, und dann ging es los! Hui, was die Wasserspinne für Sprünge machte, wie die Ente ruderte, wie der Rohrspatz mit den Flügeln schlug, wie Reineke Fuchs am Ufer entlang in langen Sätzen dahin eilte, wie der Salamander durch den Schlamm wühlte! Wer wohl am ersten drüben sein würde?
Aber einer lief nicht mit. Gemächlich saß er auf einem breiten Stein und glotzte mit seinen großen Augen ins Wasser, wo die Wellen ordentlich hoch aufspritzten bei dem Wettrennen der Tiere; das war Herr Frosch. Da auf einmal packte ihn Meister Langbein mit seinem Schnabel, um ihn hoch aufzuheben und ihn seiner Frau Störchin als einen fetten Braten zum Sonntag zu bringen. War das aber ein Schreck!
Quakend zappelte und strampelte er, um aus dem schrecklichen Schnabel seines Feindes Storch herauszukommen und richtig! Wie der einmal ein bißchen nach Luft schnappen mußte, strampelte er sich los und plumps fiel er zur Erde, oder vielmehr auf ein großes Blatt gerade am anderen Ufer des Teiches.
Noch hatte er sich nicht von seinem Schreck erholt, da kamen die Tiere eins nach dem anderen angeschwommen, angeflogen, angekrochen, angelaufen, angesprungen. Was die aber für Gesichter machten, als sie den Frosch schon drüben fanden.
„Du schon hier?“ fragten sie ganz erstaunt. Der aber konnte nur sagen: „Quak!“
Wirklich, da saß er stolz und breit und behäbig auf seinem großen Blatt mit seinem grünen Frack und seiner weißen Weste und glotzte sie ganz erstaunt an.
Die Tiere aber waren ebenso erstaunt wie er.
Aber was half es, Herr Frosch war am ersten am anderen Ufer des Teiches gewesen. Da schrien alle Tiere: „Herr Frosch soll Schulze vom Teich sein. Herr Frosch lebe hoch!“ Herr Frosch aber saß ganz still und erstaunt da dann aber machte er einen breiten Mund und sagte: „Quak.“ Seitdem ist der Frosch Schulze am Teich.
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
IM GARTEN DER SEEJUNGFRAU ...

Es war einmal eine kleine Seejungfrau, die ganz allein in einer kleinen stillen, dicht mit Schilf und jungen Weiden bewachsenen Bucht wohnte, gar nicht weit vom großen Seedeich entfernt. Einst hatte sie draußen im großen Ozean gespielt, sich mit Delphinen getummelt und mit den plumpen, froschmäuligen Wassermännern geneckt.
Aber in einer lauen Sommernacht war sie ein wenig alleine herum geschwommen und hatte vor sich hin geträumt. Da hörte sie eine ganz leise Melodie übers Meer fahren, die Töne kamen immer näher und mit ihnen ein grünes und rotes Licht. Ein riesiges weißer Segel zog heran – das gehörte zu einer knallrot angestrichenen Tjalk.
Von daher kamen die lieblichen Töne, die lang gezogen und wehmütig übers weite Meer in den Abend klangen...Dazu glitzerten die Sterne, und die kleine Seejungfrau war so angezogen von der schönen Musik, daß sie immer hinter der Tjalk herschwamm.
Es war wunderbar, und jedesmal, wenn ein Lied vorbei war – setzte gleich eine neue Weise ein – und jede klang weich und sehnsuchtsvoll, - denn der junge Seemann, der an Deck der Tjalk auf seiner Ziehharmonika spielte, war voller Sehnsucht und Zwiespalt. War er zu Hause hinterm Deich, hatte er Lengen. Segelte er nach fremden Zonen, zu fremden Ländern, so zog es ihn heimwärts. In steter Unruhe durchsegelte er so die Meere und spielte in seiner Freiwache auf der alten Ziehharmonika, die er einmal geerbt hatte und die voll süßer Musik war.
Plötzlich merkte die kleine Seejungfrau, daß viele winzige Sterne am Himmel aufgetaucht waren – ganz tief unten standen sie beieinander in einer Reihe. Da wurde sie ängstlich, denn noch nie hatte sie so etwas gesehen. Auch sah sie die vielen Schiffe, die mit der Tjalk zogen, alle in der Richtung eines Sternes, der einmal aufblinkte, dann wieder verschwunden war, immer abwechselnd; wie von einem Magnet angezogen, steuerten alle Schiffe darauf zu.
Die Musik hörte mit einem schrillen Klagelaut auf. Da tauchte die kleine Seejungfrau vor Angst in die Tiefe. Aber sie kam schnell wieder an die Oberfläche, denn das Wasser hier war ganz flach, und unten war kein weißer Sand, keine Korallen und bunten Muscheln wie draußen am Meer – hier war alles grau und schlammig, und ein großer Bucht schob sich wühlend über den Schlick.
Da wußte sie gar nicht, was sie anfangen sollte, und sie schwamm unruhig hin und her, bis sie schließlich so müde war, daß sie in der kleinen Schilfbucht ihre Zuflucht suchte. Ganz unglücklich und verängstigt kauerte sie zwischen den Schilfbüscheln. Es war hier so flach, daß nur der Fischschwanz eben unter Wasser war.
Sie weinte leise, und ihre Tränen wurden zu Perlen und versanken zwischen den Halmen. Aber dann dachte sie an das schöne Harmonikaspiel und schlief ein. So kam es, daß die kleine Seejungfrau in der Schiffsbucht wohnte. Wohl schwamm sie am Tage und auch in den Nächten weit hinaus, um den Weg zum großen Meer zu finden – aber immer mußte sie zurück kehren, denn sie fand nie den Weg.
Einmal, es war an einem ganz nebligen Frühmorgen, hörte sie ganz in ihrer Nähe ein laut dröhnendes Horn ertönen. Da schoß sie wie ein Pfeil durchs Wasser in die Richtung, woher die Töne kamen – denn sie meinte, es wäre der große Triton, der auf der Muschel blies. Aber es war nur eine alte Galeasse, die den Weg durch den Nebel suchte, und ab und zu blies der kleine rotnasige Bootsjunge in einen Trichter, um anzuzeigen, daß sie da wären und niemand ihnen den Weg kreuzen sollte. –
Allmählich hatte sie sich daran gewöhnt, alleine in der Bucht zu wohnen, denn es gab viel zu sehen. Immer zogen Schiffe weiter, und ganz in ihrer Nähe dümpelten mitunter Fischerboote. Dann lag sie versteckt und beobachtete die Menschen, die darauf waren: wie sie die Netze auswarfen und die zappelnde Beute einzogen – und immer, wenn sie Menschen sah, hoffte sie auch wieder die Musik zu hören. Aber die Fischer riefen sich nur dann und wann mal ein paar Worte zu – namentlich, wenn sie einen besonders guten Fang getan hatten.
Denn das ist so bei den Menschen, sie wollen sich gegenseitig in Verwunderung setzen. Hat einer einen ganz großen Fisch gefangen, muß er bestaunt werden, und der Glückspilz, der ihn gefangen hat, sieht das, womit er ausgezeichnet wurde, als sein Verdienst an, was er vorher kaum zu fassen vermochte. Aber umgekehrt ist es auch wieder ein großes Verwundern, wenn einer sich verdient gemacht und was Ordentliches zuwege gebracht hat. Dann hat er eben Glück gehabt.
Der Große darf keine Schwäche zeigen, selbst wenn diese Schwäche viel kleiner ist als bei dem kleinen Großmaul. Es gibt nichts, was der eine nicht besser machen würde als der andere. Aber vielleicht ist es gut, daß man ihm gar nicht soviel Gelegenheit dazu gibt, denn er macht es sicher nicht besser... Aber von all diesen Dingen wußte die kleine Seejungfrau gar nichts. Sie wußte wirklich so gut wie nichts von den Menschen, nur, daß sie herrliche Musik machen konnten.
Eines Abends – es war genau so lind und so schönes Wetter wie damals, als sie hinter der roten Tjalk her geschwommen war – hörte sie ganz leise und zart von ferne die lieblichen Töne. Sie war ganz benommen davon und meinte zu träumen. Aber die Sterne flimmerten, und es war alles Wirklichkeit. Die Töne kamen aber nicht vom Wasser her, sondern von dort, wo der große Wall, wie eine ewig erstarrt Woge ragte.
Bis dahin war sie noch niemals gekommen, denn sie hatte ja einen Fischschwanz und konnte sich nur mühsam damit auf dem Lande bewegen. Nun aber konnte sie den verlockenden Tönen nicht widerstehen und schob sich ganz sacht aus dem Wasser auf das Nacht feuchte Wiesengras. Immer weiter bewegte sie sich zum großen Wall, und da mußte sie erst einmal richtig Luft schnappen, wie ein kleiner Fisch, der an Land geworfen ist.
Die Klänge der Musik kamen von der anderen Seite des Deiches, und so zappelte sie sich mühsam den Deich hinan. Es ging langsam, und sie fand kaum die Kraft dazu. Aber sie hatte auch nichts weiter im Kopf, als ganz nahe bei dem Harmonikaspieler zu sein und zu lauschen. –
Oh, ihre Kraft reichte nicht aus, sie konnte eben nur einen kleinen Blick über die Deichkante tun, da lösten sich ihre Hände von den Grasbüscheln und sie rollte den Deich wieder hinunter. Zitternd und zerschlagen blieb sie unten liegen.
Die Sonne stand schon hoch und strahlend am Himmel, als sie aus ihrem Traum erwachte. Die Töne der Musik hatten sie ganz weit aufs Meer hinausgetragen; dort hatte sie gespielt wie vor langer, langer Zeit. Nun lag sie steif; sie konnte kein Glied rühren im prallen Sonnenschein, und da wußte sie, daß sie nie wieder schwimmen konnte, - denn wenn die Sonnenstrahlen den Fischschwanz länger als nur einen Augenblick berührten, etwa solange, wie ein tüchtiger Delphinensprung dauert, schwand alles Leben aus ihrem Körper.
Sie konnte nie mehr schwimmen und sich tummeln in den schäumenden Wogen. Nun aber war sie traurig, wie eine kleine Seejungfrau nur sein kann. Aber das fühlte sie nur – sie konnte auch nicht mehr weinen, und keine Perle rollte ins trockene Gras.
Viele Monde gingen so dahin, und einmal kam eine große Sturmflut, die Wogen sprangen wie große weiße Wölfe heran und warfen die kleine Seejungfrau noch höher an den Deich. – Am Morgen nach der
Sturmnacht kam der alte Aalstecher, der den Deich nach Strandgut absuchte, und fand halb unter den abgetriebenen
Seealgen die kleine Seejungfrau.
Er machte einen Freudensprung in seinen groben Schlickstiefeln, als er die kleine goldene Krone aufblitzen sah, die alle kleinen Seejungfrauen tragen als Abbild ihrer königlichen Herkunft. Das gibt etwas, sagte der Aalstecher, und packte sie in einen großen Sack, den er mitgebracht hatte. Dann ging er eilig in seine Deichkate und überlegte, was er mit seiner Beute machen sollte.
Der Aalstecher hatte nicht viele Freunde, denn er war nur ein armer Mann, und es war nichts bei ihm zu holen. Die Krone war nicht echt; er hatte gleich ein wenig mit seinem Aalmesser herumgekratzt. Vergoldet! sagte er – und überlegte weiter, was er machen sollte.
Nun, in dem Ort, wo der Aalstecher wohnte, gab es nicht so viele Möglichkeiten für einen so absonderlichen Schatz. Es gab nicht mal ein Museum, sonst wäre er gewiß dort als Prunkstück ausgestellt worden. Ein paar Taler wanderten in die Tasche des Aalstechers, und die kleine Seejungfrau kam nun als Gallionsfigur an den Steven eines Schiffes, welches auch seinen Namen dazu bekam: „Die kleine Seejungfrau.“
Und dann geschieht das Wunderbare: alles ging in Erfüllung, wonach sie sich in der kleinen Bucht gesehnt hatte. Das Schiff fuhr, nachdem es wie ein Riesenfisch von der Helling ins Meer geglitten war, aufs große und blaue Meer hinaus. Da spürte sie gar nichts mehr von den harten Hammerschlägen, die wie Stiche durch ihren Körper gegangen waren, als der Zimmermann sie an den Steven des Schiffes schlug. Sie hatte alles gefühlt, trotzdem sie nun so gut aus Holz war und die Menschen sie auch für nichts anderes hielten denn für ein schön geschnitztes, bemaltes Bildwerk mit einer blitzenden, bemalten Krone.
Und noch etwas anderes war in Erfüllung gegangen. Auf dem tiefsten Leid, das damals am Deichrand über sie kam, aus der wehmütigen Melodie, der zu lauschen ihre letzte Kraft gekostet hatte und die ihr Ende wurde – dieses wehmütige Ziehharmonikaspiel hörte sie nun fast täglich und auch manchmal des Nachts, wenn die Sterne schimmerten und der Mond die sanft bewegte See in ein Silbermeer verwandelte.
Denn der junge Seemann hatte auf der „Kleinen Seejungfrau“ angeheuert, weil er sich ganz und gar in das schöne Bildwerk verliebt hatte. Oft lag er weit ausgestreckt im Netz des Bugspriets und sah, wie die Seejungfrau mit leisem, glücklichem Lächeln ihren rosigen Leib im Schäumen der Bugwellen badete, von Delphinen umspielt, immer weiter dem Unbekannten, dem Unendlichen entgegen.
Dann kamen ihm sonderbare Gedanken; er sah die endlose Reihe der ertrunkenen Seeleute, die am Grunde alle Meere rastlos wandern zwischen Korallen und zauberhaftem Meergetier, angeführt von ihren Kapitänen und mit tief liegenden hohlen Augen jeden Schiffsrumpf verfolgend, sehnsuchtsvoll im Banne der Seejungfrau ihr Lied zum Takt eines klirrenden, rostigen Gangspills anstimmend.
Er sah die gesunkenen Schiffe, die Wracks, deren Rippen plankenlos, umwachsen von seltsamen Pflanzen und Muscheln, in leise sich wiegende smaragdgrüne Wogen hinauftragen und zu den Palästen und Säulenhallen des Meeres geworden sind.....
Allabendlich von Leuchtfischen festlich erhellt, zum Fest der Seeleute, die aus Bernsteinbechern und Perlmuttschalen den schäumenden, grünleuchtenden Wein der Tiefe trinken.....Schätze der gesunkenen spanischen Karavellen liegen im leise rinnenden Sand, Gold und Silber, und neben einem Häuflein Edelsteine steckt verrostet, mit Algen verziert, der schartige Säbel eines Bukaniers, ein wenig weiter ragt ein bronzener Mörser von Nelsons Flotte –
Jahre sind vergangen – Das Schiff ist alt, mürbe, von Würmern durchbohrt, unansehnlich geworden. In einem Sturm, der seinen brüchigen Rumpf durch die Wogen peitschte, brachen die Planken, und alle, die auf dem Schiff waren, sanken hinab in die Fluten, wurden Glieder der endlos wandernden Kette.
Der junge Seemann hatte sich in seiner Not an die kleine Seejungfrau geklammert. Im selben Augenblick, da das Schiff sank, konnte sie sich von dem Steven lösen, denn das Steveholz war so mürbe geworden, daß die Schmiedenägel dem gewaltigen Anprall der Wogen nicht mehr Stand hielten. Viele Tage hielt sich der junge Seemann an dem ewig jungen Leib seiner Geliebten; hin und her gepeitscht durchtrieben sie so die Meere – aber seine Kraft wurde immer weniger, und schließlich wurde er nur noch festgehalten von den rostigen Nägeln, die ihr einstmals bittere Wunden in den Fischleib geschlagen hatten.
Dicht bei der kleinen Schilf – und Weiden bewachsenen Bucht wurden sie zusammen an den Strand geworfen. Der junge Seemann gab seinen Schatz Petrus Pernullje in Verwahrung. Ihn selbst trieb bald wieder das Weh nach weiter Ferne, bis das Meer auch ihn leise wiegend, wie von Mutterhänden behütet, zu den Säulenhallen des Grundes hinab gleiten ließ, wo sein Kapitän im blauen Mantel mit zerzaustem Bart ihm den Bernsteinbecher, den Wein der Tiefe zum Willkommen reichte. –
Die kleine Seejungfrau aber wurde in Ponulls Garten auf einen starken Eichklotz, der einmal ein Gangspill war, aufgestellt – ein verrosteter Anker daneben. Aber auch Petrus Pernullje ist auch längst auf große Fahrt gegangen, und sein treuer Diener, der Chinoman, ist mit einem kleinen Strohkoffer, seinem Vogelbauer, und einem dicken Geldbrief, aus dem Vermächtnis des Kapitäns in seine ferne östliche Heimat gereist.
Jetzt gehört das ganze Gewese, Haus und Garten, Markus Klüver, und die Sonne scheint, die Blumen duften, und Markus steht neben der kleinen Seejungfrau und spricht mit seinem Bootsmann, seinem
Papagei, der im Kirschbaum hängt. Der Papagei kreischt mit heiserer Stimme: Sett de Fock war stiever, Markus!
und schwingt sich in seinem Ring wie bei hohem Seegang hin und her.
He ist jümmers noch op grote Fahrt, gröhlt Markus zu mir ins Fenster herein, so laut, als ob er noch auf Deck seiner Galeasse stünde. Und ich nickte ihm verstehend zu und denke dabei: Do ook!, und paffe tüchtig mit meiner Pfeife drauflos, damit er das kleine Bild nicht sieht, daß ich gerade in Arbeit habe. Denn jeder nimmt sich ernster, als er ist – auch Markus Klüver, der nun mit seinem langen Messingfernrohr auf die Leiter an seinem Hause steigt.
Markus sieht nach fernen Segeln aus, und unten, zwischen Blumen, lächelt die kleine Seejungfrau, und in ihrem Lächeln liegt das Wissen um die Einsamkeit des Meeres, die unendliche Weite, die in den Himmel hinaufragt, die Beglücktheit des Alleinseins – die Erinnerung an das erstmalige Überkreuzen der ewig sich wandelnden Meeresfläche.......
Wilhelm Petersen „Ut de Ooken“
VOM ROTEN UND GELBEN FINGERHUT ...
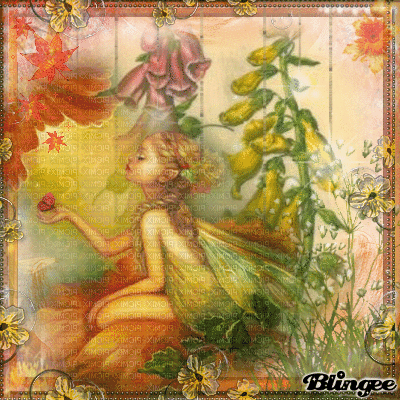
Prinzeßchen Waldtraut war zu einer lieblichen Jungfrau erblüht mit rosigen Wangen, Sonnen goldenen Flechten und Vergißmeinnicht blauen Äugelein. Da schenkte ihr ihr Vater, der Waldkönig, zwei wunderschöne Fingerhüte; einer war von rotem Rubinstein und der andere von echtem gelben Gold, und diese Fingerhüte hatten geheimnisvolle Zauberkraft. Steckte Waldtraut den roten an ihr Fingerlein und drehte ihn dreimal rechts herum und sprach:
„Fingerhut, Fingerhut,
Näh mir meine Kleidchen gut“,
so kamen aus allen Seiten die bunten Seidenstückchen geflogen, braune und rote und goldene und grüne, und dazwischen rote Perlen und weiße und schwarze und setzten sich ganz von selbst zusammen
zu einem wunderschönen, farbenbunten Kleid. Und steckte Prinzeß Waldtraut den goldenen Fingerhut an ihr Fingerlein und drehte ihn dreimal links herum und sprach dazu:
„Fingerhut, Fingerhut,
Näh mir meine Hemdlein gut“,
so kamen schnell lauter weiße seidene Fäden geflogen und woben sich zusammen zu wunderschöner, zarter, feiner Wäsche, wie nur ein Prinzeßchen sie tragen kann.
Da konnte Waldtraut ohne Mühe und Arbeit sich immer schön anziehen. Aber eines Tages waren ihre beiden Fingerhüte fort, sie hatte sie verloren, oder waren sie gestohlen? Sie wußte es nicht, und niemand wußte es.
Da fing Waldtraut bitterlich an zu weinen und klagte ihr Leid ihrer Mutter, und die sagte es dem Könige, und alle drei waren traurig, und niemand im ganzen Reiche konnte so schöne Fingerhüte wieder machen; denn der Meister, der sie einstens gemacht hatte, war schon lange tot und hatte sein Geheimnis mit ins Grab genommen.
Da ließ der König in seinem ganzen Reiche ausrufen, wer die verlorenen Fingerhüte wieder brächte, sollte Prinzeßchen zur Frau bekommen und einmal nach seinem Tode Waldkönig werden. Da fingen alle Ritter und Edle im ganzen Reich an zu suchen, aber niemand fand die Fingerhüte wieder.
Droben aber hinter dem Wurmberg, da hauste ein alter Riese, der hieß Achtermann und hatte schon einen ganz kahlen Kopf und einen krausen Bart. Der wäre gar zu gern einmal Waldkönig geworden; denn wer Waldkönig ist, dem gehören alle Schätze im ganzen großen Waldreich.
Als der hörte, daß Waldkönig werden sollte, wer die verlorenen Fingerhüte wieder brächte, rief er einen seiner bösen Kobolde, der ein geschickter Goldschmied war und im Rammelsberge wohnte, und befahl ihm, er solle einen roten und einen gelben Fingerhut machen, genau so, wie die verloren waren.
Der kratzte sich zwar erst hinter den Ohren, denn das war eine gar schwierige Sache, aber dann versprach er es und ging hin und machte sie. Und als er sie seinem Herrn brachte, da waren sie so wunderschön, daß sie niemand hätte von den echten unterscheiden können.
Da machte sich der Riese Achtermann auf und ging zum Waldschloß und kam zu Waldtraut. Als sie den alten Kahlkopf sah, erschrak sie sehr, er aber machte ein gar freundliches Gesicht und sagte: „Freuet Euch, viel edle Jungfrau, ich habe Eure Fingerhüte wiedergefunden.“
Und als er sie herauszog und Waldtraut gab, da sprang Waldtraut vor Vergnügen schnell zu ihrer Mutter, und die sagte es dem Vater, und war große Freude im Schlosse und im ganzen Waldreich. Und der Waldkönig machte Achtermann zu Ehren ein großes Fest und alle waren fröhlich und guter Dinge.
Als sich nun alle so freuten, da sagte Achtermann: „Seht, viel edle Jungfrau, Ihr freuet Euch, daß Ihr Eure Fingerhüte wieder habt aber ich habe noch viel größere Freude, daß ich die edelste und schönste und tugendsamste Prinzessin soll zur Frau haben; denn ich habe Euch lieb wie mein eigenes Leben.“
Das log er aber, denn er hatte Waldtraut gar nicht lieb, er wollte ja nur die Schätze und den Thron des Waldkönigs einmal haben. Da wurde Waldtraut sehr traurig, denn sie wollte von dem alten, kahlköpfigen, krausbärtigen Riesen gar nichts wissen und fürchtete sich gar schrecklich, seine Frau zu werden. Aber ihr Vater hatte es versprochen, und ein König darf sein Wort nicht brechen. So wurde denn die Verlobung gefeiert und bald sollte Hochzeit sein.
Da bat Waldtraut sich die Erlaubnis aus, ihre Wäsche und Kleider sich mit ihrem Zauberfingerhütchen selbst machen zu dürfen. Die Königin erlaubte es ihr. So steckte sie den roten Fingerhut an ihr
Fingerlein und drehte ihn dreimal rechts herum und sprach:
„Fingerhut, Fingerhut,
Näh mir meine Kleidchen gut.“
Aber kaum hatte sie es gesagt, da erhob sich ein fürchterlicher Sturm; von allen Seiten kamen die bunten Seidenstückchen geflogen, aber sie nähten sich nicht zusammen, sondern wirbelten wie toll durcheinander und zerrissen in tausend Fetzen.
Da zog Waldtraut schnell den Fingerhut ab aber oh weh, wie schmerzte ihr Fingerlein, ganz blutig gestochen war es von heimlichen, darin verborgen gewesenen Nähnadeln, und im Fingerhut klebten ihre Blutströpfchen ganz fest, daß sie nur mit großen, großen Schmerzen ihn abziehen konnte.
„Das ist mein Fingerhut nicht,“ schrie sie ganz laut vor Angst. „Das tut mir leid“, sagte ihr Bräutigam, daß Ihr Unglück gehabt habt, gewiß habt Ihr ihn falsch herumgedreht. Versucht es doch mit dem goldenen.“
Da nahm Waldtraut den gelben Fingerhut und steckte ihn auf ihr Fingerlein und drehte ihn dreimal links herum und sprach:
„Fingerhut, Fingerhut,
Näh mir meine Hemdlein gut.“
Aber kaum hatte sie es gesagt, da kamen von allen Seiten dicke weiße Schlangen gekrochen, die ballten sich zu fürchterlichen Knäueln und bissen sich und balgten sich und stoben dann auseinander.
„Das ist auch nicht mein Fingerhut,“ schrie Waldtraut entsetzt und suchte ihn vom Finger zu ziehen aber ach, wie weh tat ihr das, denn da saßen auch heimliche Nadeln drin, die hatten ihr Fingerlein ganz zerstochen, und ihr Blut klebte wie lauter braune Fleckchen drinnen im Fingerhut.
Da wurde der Waldkönig böse und sprach zu Achtermann: „Ihr habt mich belogen und betrogen; Ihr habt mein Kind vergiftet mit Eurer Lüge, da Ihr sagtet, Ihr hättet es lieb geht aus meinen Augen; nie sollt Ihr sie zur Frau und meinen Thron zum Erbe haben!“ Waldtraut aber warf ihm seine Fingerhüte hin.
Da schämte sich Achtermann, daß seine Lüge entdeckt war und schlich sich schnell davon. Unterwegs aber nahm er die beiden Fingerhüte und warf sie wütend fort, daß sie klirrend in tausend Stücke sprangen. Aber o Schrecken! Aus jedem Stück wuchs eine lange Stange hervor, an der sechs, sieben, zwölf gleiche Fingerhüte hingen.
Und noch heute könnt ihr sie überall sehen und könnt die Blutfleckchen von Prinzeß Waldtrauts Fingerlein drin sehen aber hütet euch vor ihnen sie sind giftig!
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
WIE DER HIRSCH ZU SEINEM SCHÖNEN GEWEIH KAM ...
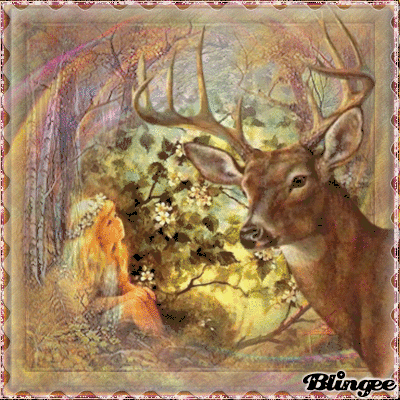
Als Prinzeßchen Waldtraut einmal im Walde spazieren ging, kam ein kleines, feines Männlein des Weges, das hatte eine schöne, hellgrau und schwarz gestreifte Weste an und einen schönen dunkelgrauen Rock und machte eine sehr artige Verbeugung und sagte: „Ei, guten Tag, schönes Prinzeßchen; ich bin der Prinz Gauch. Wollt Ihr nicht mit mir ein bißchen spielen?“
Weil nun Prinzeßchen so gern spielte, sagte es gleich „Ja“ und klatschte vor Freude in die Händchen, und gleich fingen sie an, Haschen zu spielen und sich zu verstecken. Das war nun dem Prinzen Gauch sein Lieblingsspiel. Als er am Verstecken war, da verkroch er sich ganz hinter einen grünen Baum und rief: „Kuck-kuck, Kuck-kuck! Such mich doch!“
„Ich werde dich schon finden,“ rief Prinzeßchen und lief an die Stelle, von wo er gerufen hatte. Aber wie sie dort war, da rief es schon aus einer ganz anderen Ecke des Waldes: „Kuck-kuck, Kuck-kuck! Such mich doch!“ Da lief Prinzeßchen dort hin. Aber Prinz Gauch war doch schneller, und ehe sie dort war, war er schon wieder woanders und rief aus der entgegengesetzten Ecke: „Kuck-kuck, Kuck-kuck! Such mich doch!“
So ging das Spiel eine ganze Weile hin und her und kreuz und quer im Walde, und Prinzeßchen merkte gar nicht, wie weit es von seines Vaters Schloß weg gekommen war. Und auf einmal war es ganz nahe bei des bösen Riesen Schnarcher Burg angekommen. Die stand mit ihren trotzigen grauen Mauern ganz drohend vor Prinzeßchens Augen. Da bekam es aber einen großen Schreck. Denn der Riese Schnarcher war ein arger Räuber.
Wie es noch ganz betäubt da stand, da hörte es auf einmal, wie der Riese Schnarcher ganz laut lachte und mit seiner groben, schnarrenden Stimme sagte: „Gauch, das hast du gut gemacht; nun kann ich Prinzeßchen fangen und braten; das gibt ein schönes Frühstück.“
Da merkte Prinzeßchen, daß Prinz Gauch sie betrogen und mit Absicht dahin gelockt hatte. Denn er war gar kein richtiger Prinz, sondern dem Riesen Schnarcher sein schlauer Diener.
Der war von klein auf von seiner Mutter verlassen, bei fremden Leuten aufgewachsen, hatte aber bei denen ihren eigenen Kindern das Brot weg genommen und sie alle aus dem Hause gejagt, war dann aber selbst in die weite Welt gegangen, trieb sich herum, wohnte bald hier, bald da, ein Taugenichts und Tunichtgut, der sich sein Brot damit verdiente, daß er den bösen Riesen mit seinem Versteckspielen in ihr Reich lockte, wen sie haben wollten.
Und Schnarcher hatte schon längst Prinzeßchen Waldtraut auffressen wollen, weil es so appetitlich aussah. Da hatte er den Gauch gedungen, daß er sie ihm verschaffen sollte, und das arme
Prinzeßchen war wirklich ins Garn gegangen.
Armes Prinzeßchen! Wie ihm sein Herzchen schlug! Wie sollte es nur schnell wieder entfliehen können! Seine Flüßchen waren ihm vom Laufen so müde, daß es gar nicht mehr drauf stehen konnte.
Ach, wenn doch einer käme und es mit nähme!
Da flog gerade ein schöner Schmetterling vorüber. „Ach, bitte, bitte, nimm mich auf deine Flügelchen!“ schrie Prinzeßchen, „und trag mich nach Hause!“ „Das kann ich nicht,“ sagte Schmetterling, „da würden meine schönen Flügelchen häßlich: die darf man nicht anrühren!“ Und weil er so eitel war, flog er weiter und ließ Prinzeßchen sitzen.
Da kroch ein Käferlein vorüber. „Ach, bitte, bitte, setz mich auf deinen Rücken und nimm mich mit und trag mich nach Hause!“ schrie Prinzeßchen. Aber Käferchen antwortete: „Das kann ich nicht; du bist mir zu schwer. Da würde ich müde, und dann könnten wir beide nicht weiter.“
Da hüpfte ein lustiges Wässerlein vorüber: „Ach, bitte, bitte, nimm mich mit und trage mich nach Hause.“ Aber Wässerlein antwortete: „Wie gern nähme ich dich mit, aber auf meinem Wege liegen so viele Steinchen, da würde ich mit dir stolpern, und wir brächen uns die Beinchen und kämen beide nicht weiter!“
Da wurde Prinzeßchen ganz traurig; denn es hörte schon, wie Schnarcher seinen Ofen heizte und sah schon, wie blaue Rauchwolken aufstiegen, und es hatte ganz schreckliche Angst und fing bitterlich an zu weinen. Da auf einmal stand ein schöner brauner Hirsch vor ihm, der sah es mit seinen schönen klugen Augen an und sagte:
Prinzeßchen, ich kann ganz schnell laufen. Setzt Euch nur getrost auf meinen Rücken, ich bringe Euch ganz schnell nach Hause.“ O, wie fix sprang da Prinzeßchen auf seine Füße; der Hirsch kniete vor ihr nieder und Prinzeßchen stieg auf seinen Rücken, umschlang seinen Hals mit seinen Ärmchen und fort ging es wie der Wind; hui, wie die Zweige knackten!
Wie der Hirsch über Gräben hinweg sprang, den Berg hinunter und hinauf. Der Riese Schnarcher schimpfte hinterher, aber er konnte sie nicht kriegen, denn der Hirsch lief ganz schnell bis zu Waldkönigs Schloß.
Waldkönig und Waldkönigin waren schon in großer Angst um ihr Töchterlein gewesen und hatten ausrufen lassen, daß, wer ihnen ihr Prinzeßchen wieder brächte, der sollte eine schöne Krone zum Lohn bekommen. Oh wie freuten sie sich, als sie ihr Töchterchen ankommen sahen, und Prinzeßchen ihnen erzählte, wie der gute Hirsch sie gerettet hätte.
Waldkönig aber sagte zum Hirsch: „Weil du mir mein Prinzeßchen wieder gebracht hast, darum sollst du die Krone bekommen“ und Frau Waldkönigin setzte sie ihm selber auf. Seitdem trägt der Hirsch sein schönes Geweih.
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
DIE GESCHICHTE VON DEN SIEBEN MÄUSEN ...

Vor langer, langer Zeit wohnten in Pudmin, einem Dorf auf Rügen im Swantower Kirchspiele, ein Bauer, der hatte eine schöne, fromme Frau, die fleißig betete und alle Sonn– und Festtage zur Kirche ging, auch den Armen, die vor ihre Türe kamen, gern gab.
Es war überhaupt eine freundliche und mitleidige Seele und im ganzen Dorf und Kirchspiele von allen Leuten geliebt. Nie hatte man ein hartes Wort von ihr gehört noch eine andere Ungebühr aus ihrem Munde vernommen. Diese Frau hatte sieben Kinder, lauter kleine Dirnen, von denen die älteste zwölf und die jüngste zwei Jahre alt war, alles hübsche und lustige Dingelchen.
Sie gingen übereins gekleidet, mit bunten Röckchen und ebensolchen Schürzen und mit roten Mützchen; Schuhe und Strümpfe aber hatten sie nicht, den das hätte zuviel gekostet, und so gingen sie eben barfuß. Die Mutter hielt sie nett und reinlich, wusch und kämmte sie des morgens früh bis abends spät, wenn sie aufstanden und zu Bett gingen, lehrte sie lesen und singen und erzog sie in aller Freundlichkeit und Gottesfurcht.
Wenn sie auf dem Felde was zu tun hatte oder weit ausgehen mußte, stellte sie die Älteste, welche Barbara hieß, über die anderen; diese mußte auf sie sehen, ihnen etwas erzählen und manchmal auch allerlei Märchen und Geschichten vorlesen.
Nun begab sich einmal, daß ein hoher Festtag war – ich glaube es war Karfreitag – da ging die Bauersfrau mit ihrem Mann zur Kirche und sagte den Kindern, sie sollten hübsch artig sein. Der Barbara aber und den Nächstälteren gab sie einige fromme Lieder auf die sie inzwischen auswendig lernen sollten. Darauf gingen die Eltern weg.
Barbara und die anderen Kinder waren anfangs auch recht artig. Die älteren nahmen Bücher und lasen, während die Kleinsten still auf dem Boden saßen und spielten. Nach einer Weile erblickte das eine Kind etwas hinter dem Ofen und rief: „Seht, was ist das für ein schöner, weißer Beutel!“
Der Beutel enthielt Nüsse und Äpfel, und die Mutter hatte ihn am Morgen hin gehängt, denn sie wollte ihn am Nachmittag einem ihrer kleinen Paten bringen. Die Kinder sprangen als bald auf. Sie guckten den Beutel von allen Seiten an, und auch Barbara die Älteste, stand auf und guckte mit. Die Kinder flüsterten und sprachen dies und das über den schönen Beutel, und sie fragten einander, was wohl darin sei.
Es gelüstete sie so sehr, dies zu erfahren; auf einmal riß eines der Kinder – man wußte eigentlich nicht recht, welches – den Beutel vom Nagel. Zögernd löste Barbara die Schnur, mit der er zugebunden war – und siehe da: Äpfel und Nüsse fielen ihr entgegen.
Wie die Kinder die Äpfel und Nüsse auf dem Boden dahin rollen sahen, vergaßen sie alles, auch daß es Festtag war, und was die Mutter ihnen befohlen und aufgegeben hatte. Sie setzten sich hin, schmausten die Äpfel und knackten die Nüsse und aßen alles rein und säuberlich auf.
Als nun Vater und Mutter aus der Kirche nach Hause kamen, sah die Mutter die Nussschalen auf der Erde liegen. Sie suchte den Beutel, aber so sehr ihre Augen auch hin sahen: sie konnte ihn nicht mehr entdecken. Da erzürnte sie sich sehr und ward zum ersten Male in in ihrem Leben ungehalten. Sie schalt die Kinder tüchtig aus und rief: „Potz Blitz! Ich wollte, daß ihr alle zu Mäusen werdet.“
Dieser Wunsch war aber eine große Sünde, denn es war doch ein heiliger und hoher Festtag, an einem anderen Tag hätte Gott es sicher der Bauersfrau eher verziehen, denn sie war sonst eine fromme und gottesfürchtige Frau. Kaum war der Mutter dieses schlimme Wort entschlüpft, da waren all die sieben niedlichen Kinderchen weg.
Es war, als hätte sie der Wind weg geblasen, und siehe: sieben bunte Mäuse liefen in der Stube herum mit roten Köpfchen, wie die Röcke und Mützen der Kinder gewesen waren. Vater und Mutter erschraken darüber so sehr, daß sie hätten zu Stein werden mögen.
Als der Knecht herein kam und die Tür öffnete, liefen die sieben bunten Mäuse schnurstracks hinaus und über den Flur auf den Hof. sie liefen so geschwind, daß man sie mit dem Blick gar nicht mehr verfolgen konnte. Als die Frau das sah, war sie bestürzt; sie konnte sich nicht halten, stürzte zur Tür hinaus und lief den Mäusen nach.
Diese aber eilten den Weg entlang spornstreichs zum Dorfe hinaus. Sie liefen über die Felder und kamen immer tiefer in den dunklen Wald hinein. Die Mutter kam ganz außer Atem; sie konnte weder schreien noch weinen und wußte sich keinen Rat.
Auch im Walde blieben die Mäuse nicht. Sie liefen wieder in ein freies Feld hinein, einem kleinen Busche zu. Einige hohe Eichen standen davor; etwas seitlich befand sich ein Spiegel heller Teich, über dem sich in der Sonne eine Schar Mücken spielend herumtrieb. Noch heute steht dieser Busch mit seinen Eichen und heißt der Mäusewinkel.
Als die Mäuse an den Teich heran kamen, standen sie plötzlich alle sieben still und guckten um sich, und die Bauersfrau stand dicht bei ihnen. Es schien als wollten sie Abschied von ihr nehmen, denn als die Frau so ein Weilchen die Mäuse angesehen hatte, plumps! sprangen alle sieben zu gleicher Zeit ins Wasser. Sie schwammen aber nicht, sonden gingen gleich in der Tiefe unter.
Dies geschah alles an einem sonnigen Mittag. Die Mutter blieb hilflos stehen, und konnte weder Hand noch Fuß rühren, denn auch sie war kein Mensch mehr, sondern zu einem Stein erstarrt; und auch dieser Stein liegt noch an der selben Stelle, wo sie stand und die Mäuslein verschwinden sah. Und dies ist der große Stein, an dem wir sitzen.
Und nun hört einmal, was nach diesem geschehen ist und noch jede Nacht geschieht. Wenn die Glocke zwölf Uhr schlägt und alles schläft und still ist und die Geister herumwandeln, kommen die sieben bunten Mäuse aus dem Teiche heraus und tanzen eine ganze ausgeschlagene Stunde um den Stein herum, bis es eins schlägt.
Und es geht die Sage, daß dann der Stein zu klingen anfängt, als ob er sprechen könnte. Dies ist wohl die einzige Stunde, wo die Kinder und Mutter sich verständigen können und voneinander wissen. All die übrige Zeit sind sie wie tot. Die Mäuse tanzen nun wohl schon tausend Jahre und länger um den Stein, und es geht die Sage, daß sie einmal wieder verwandelt werden sollen. Dies kann nur durch Gottes Gnade und auf folgende Weise geschehen:
Es muß eine Frau sein, die gerade alt ist, wie die Bäuerin war, als sie aus der Kirche kam. Diese Frau muß dann sieben Söhne haben, die genauso alt sind, wie die kleinen Mädchen es waren. Sind sie nur eine Minute älter oder jünger, so geht es nicht mehr. Diese Frau muß an einem Karfreitag in der Mittagszeit, da die Bäuerin zu Stein ward, mit ihren sieben Söhnen in den Busch kommen und sich auf den Stein setzen.
Sobald sich die Frau gesetzt hat, wird der Stein lebendig werden und sich wieder in einen Menschen verwandeln; leibhaftig und eben in den Kleidern, die die Mutter getragen hat, als sie den Mäusen nach lief, steht dann die Bauersfrau wieder da. Die sieben bunten Mäuse aber werden wieder zu sieben kleinen Mädchen in bunten Röcken und mit roten Mützen auf den Köpfen.
Und jedes kleine Mädchen geht dann zu einem Knaben hin, und sie werden Braut und Bräutigam. Und wenn sie dann groß werden, so halten sie Hochzeit an einem Tage und tanzen ihre Kränze ab. Es
sollen die schönsten Jungfrauen werden auf der ganzen Insel, sagen die Leute, und auch die glücklichsten und reichsten, denn all diese Güter und Höfe hier umher sollen ihnen gehören.
Aber ach, wann werden sie sich verwandeln?
Ernst Moritz Arndt
WOHER DER FLIEGENPILZ SEINE WEISSEN FLECKEN HAT ...

Früher hatten die kleinen Pilzkinderchen keine Hütchen auf dem Kopf; da wurden sie immer pitsche-patsche-naß, wenn sie im Regen in den Wald liefen. Und das taten sie doch so gern; denn da war das Moos so schön grün und frisch und die Pfützchen im Wald so schön tief, daß sie tüchtig drin herum plantschen konnten, und Pilzmütterchen hatte gesagt, wenn man in den Maienregen liefe, dann würde man groß, und sie wollten doch auch gern groß werden.
Aber einmal hatte es so fürchterlich geregnet, und sie waren so durchnäßt, daß sie alle den Schnupfen kriegten und ins Bettchen mußten. Da beschloß Pilzmütterchen, ihren Kinderchen zu Weihnachten schöne Hütchen zu schenken. Und richtig, wie Weihnachten kam, fanden sie alle auf ihren Plätzen Hütchen.
Ei, wie sie sich da freuten und stolz waren! Champignon hatte eine weiße Kapuze mit rosa seidenem Futter bekommen, Musseron ein kleines flaches graubraunes Mützchen. Baumschwamm setzte sich gleich seine breite Schirmmütze auf und lief zu seinem Freund Weidenstrunk, um sie ihm zu zeigen.
Halimasch stülpte sich seine runde, braune Lederkappe auf und rannte, was er konnte, hinaus auf die Chaussee, um sie dort von allen, die vorüber gingen, bewundern zu lassen. Reitzker schmückte sich mit einem flachen breiten Hut mit Fransen und gelblichem gefältelten Futter, und Steinpilz stolzierte gravitätisch mit seinem glänzenden braunen Helm einher.
Nur einer war nicht zufrieden mit seinem Hut, das war Monsieur Fliegenpilz. Das war überhaupt so ein Schlingel, der immer in giftigem Neid sich erbosen konnte, wenn seine Geschwister Spielzeug oder andere Sachen bekamen, die er nicht besaß.
Der hatte einen schönen weißen Hut bekommen, aber ihm war er nicht schön genug; ja Pfifferling, der kleine lustige Schelm mit seinem keck aufgekrempten Hütchen oder Morchel mit seiner schwarzen Tscherkessenmütze, die hatten es viel schöner. Wenn er doch auch einen bunten Hut hätte. Da kam ihm ein guter Einfall.
Dort im Walde wohnte ja sein Freund, der Zwerg Klecksel, der jedes Jahr im Frühling all die Blumen und im Herbst all die Blätter im Walde bunt anzustreichen hatte. Zu dem wollte er gehen und sich
seinen Hut färben lassen.
Und richtig, heimlich schlüpfte er fort und suchte Klecksel auf.
Leider traf er ihn nicht zu Hause. Aber was schadete es! Da standen ja seine bunten Farbentöpfe gelb und grün und braun und lila und rot! Ja rot, das wäre fein! Einen roten Hut hatte kein anderes Pilzkind. Also, was machte er? Flugs den Hut vom Kopfe und hineingetunkt in den roten Farbtopf und dann flink wieder nach Hause!
Als er nach Hause kam, wollte gerade Pilzmütterchen mit ihren Kinderlein spazieren gehen. Natürlich, da mußte er mit. Stolz setzte er seinen roten Hut auf und alle sagten „Ah!“ und „Oh!“, als sie den sahen. Nur Pilzmütterchen sagte gar nichts, aber sie dachte in ihrem Herzen, daß das doch gar nicht schön von Fliegenpilz sei.
Kaum waren sie ein halbes Stündchen gegangen, da fing es an zu regnen. Hei, wie sich die Pilzkinderchen freuten, daß sie ihre Hütchen auf den Köpfchen hatten und nun nicht naß wurden! Aber sie kehrten doch wieder lieber um. Zu Hause angekommen, setzten sie ihre Hüte ab, um sie an den Nagel zu hängen zum Trocknen.
Auch Fliegenpilz nahm seinen Hut herunter aber, oh weh, wie sah der aus! Die Farbe war noch nicht trocken gewesen, als er ihn in der Geschwindigkeit aufgesetzt hatte, und überall, wo ein Regentröpflein drauf gefallen war, war ein weißer Fleck! Als er das sah, fing er an bitterlich zu weinen; so ärgerte er sich.
Dann warf er wütend seinen verdorbenen Hut in die Ecke und wollte sich hinaus schleichen; denn eigentlich schämte er sich vor den anderen Pilzkinderchen. Aber Pilzmütterchen sagte: „Siehst du, wärst du hübsch zufrieden gewesen mit deinem Hute, so hättest du nun einen schönen, sauberen, weißen Hut; nun mußt du immer den roten Hut mit den weißen Flecken tragen!“
P. u. A. Blau „Wies wispert und wuspert im grünen Wald“ – Waldmärchen
DAS WEIHNACHTSFEST ...

Am 24. Dezember lag der Schnee überall Fuß hoch, und es war bitterlich kalt. Hühnchen hatte mich gebeten, recht früh zu kommen, und so machte ich mich, nach dem ich um ein Uhr zu Mittag gegessen hatte, auf den Weg zum Bahnhof.
In der Stadt herrschte um diese Zeit, wenn man so sagen darf, eine friedliche Unruhe, und fast kein Mensch wurde gesehen, der nicht irgend etwas trug. Selbst der lästigste Junggeselle und der gewissenloseste Vater sowohl, als jene bedauernswerte Klasse von Menschen, die die Bescherung für eine lästige Komödie hält, hatten sich zu guter Letzt noch in Trab gesetzt, ihren weihnachtlichen Pflichten zu genügen und aus den Spielwaren- und anderen Läden, wo an diesem Tage Greuel der Verwüstung herrschten, einiges zu entnehmen.
Die Tannenbaumhändler standen frierend, aber zufriedenen Gemütes zwischen ihren gelichteten Beständen und wurden ihre Straßenhüter an die Nachzügler los. Schaukelpferde, die vor einiger Zeit in einem traurigen Zustand der Verwahrlosung auf geheimnisvolle Weise von ihrem gewohnten Standort verschwunden waren, hatten sich auf der wunderbaren Himmelswiese des Weihnachtsmannes wieder glänzend herangefüttert, ihre Wunden waren geheilt, und mit großen blanken Augen schauten sie von den Schultern ihrer Träger in den kalten Wintertag.
Puppenstuben von märchenhafter Pracht und eingewickelte große Gegenstände von phantastischen Formen schwankten vorüber, die Transportwagen der großen Geschäfte karriolten überall und hielten bald hier, bald da; die sogenannten Kremser, die die Post zur Weihnachtszeit zu mieten pflegt, rumpelten schwerfällig von Haus zu Haus, mit Schätzen reich beladen, Lastwagen donnerten auf den bereits gereinigten Straßen oder quietschten pfeifend auf dem hart gefrorenen Schnee, wo dies nicht der Fall war, - kurz, es war umgekehrt, wie sonst die gewöhnliche Redensart lautet, der Sturm vor der Stille.
Diese festliche Unruhe erstreckte sich auch bis auf den Zug, der nach Steglitz fuhr. Die Wagen waren erfüllt von verspäteten Einkäufern, die ängstlich Pakete von jeglicher Form hüteten und mächtige Tüten, denen ein süßer Kuchenduft entströmte; wahrlich, man hätte einen Preis aussetzen können für den, der heute nichts bei sich trug.
Ich hätte ihn gewiß nicht gewonnen, denn außer einem Kästchen mit zarten Süßigkeiten von Thiele in der Leipziger Straße für Frau Lore, führte ich für Hühnchen eine Zigarrenspitze bei mir, deren Kopf aus einem Gänseschädel gebildet war, dem durch geschickte Bemalung, ein Paar eingesetzte Glasaugen und eine Zunge von rotem Tuch das Ansehen einer abscheulichen, zackigen Teufelsfratze verliehen worden war.
Ich wußte, daß dieses Kunstwerk Hühnchen in die höchste Begeisterung versetzten würde. Für Hans und Frieda, die beiden Kinder, hatte ich Robert Reinicks Märchen, Lieder und Geschichten eingekauft, ein Buch, das ich jedem Kind schenken möchte, das es noch nicht hat, und eine Puppe, die nach dem Urteil weiblicher Kennerschaft "einfach süß" war.
Ich kann also wohl sagen, daß mein Weihnachtsgewissen rein war, wie draußen der frisch gefallene Schnee, und daß ich mit jener Ruhe, die uns das Bewußtsein erfüllter Pflicht erteilt, in die nächste Zukunft sah.
Heinrich Seidel (1842-1906)
DIE JENAISCHE CHRISTNACHTTRAGÖDIE ...
In der Christnacht des Jahres 1715 versammelte sich ein Student aus Zwickau sowie ein Schäfer und Bauer in einem Weinbergshäuslein bei Jena, um dort den Teufel zu beschwören.
In jenem Häuschen nämlich, wo sich von Zeit zu Zeit auch eine Weiße Jungfrau zeigte, sollte ein Schatz vergraben liegen, den sie vom Teufel gewinnen wollten. Obwohl sie sich „Doktor Faustens Höllenzwang“ nebst einem Zaubergerät verschafft hatten, ging die Sache aber übel aus.
Am folgenden Morgen kamen die drei nicht in die Stadt zurück. Erst am Nachmittag fand man den Studenten ganz betäubt und halb wahnsinnig, den Schäfer und den Bauern aber tot in jenem Häuschen liegen. Man meldete diese Ereignis umgehend der Obrigkeit und dieser ordnete an, dass den beiden Leichnamen in der Hütte drei Wächter beigestellt werden sollten.
Den Studenten aber schaffte man in den Gasthof: "Zum gelben Engel“ hinab.
Als die drei Männer nun zusammen saßen und wachten, kratzte es arg an der Tür des Häuschens. Ein Geist in der Größe eines Knaben trat ein. Hin und her wandelte er, dann warf er die Tür mit einem
mächtigen Krach zu.
Des nächsten Morgens lagen die drei Wächter wie tot bei den Leichnamen und zwei von ihnen blieben auch tot. Alle hatten blaue Flecken und Striemen auf der Haut. Jene Geschichte erregte allenthalben großes Aufsehen und es wurde viel darüber geschrieben. Man nannte sie nicht anders als die Jenaische Christnacht Tragödie.
Deutsches Sagenbuch Grässle
STERNSPLITTER ...
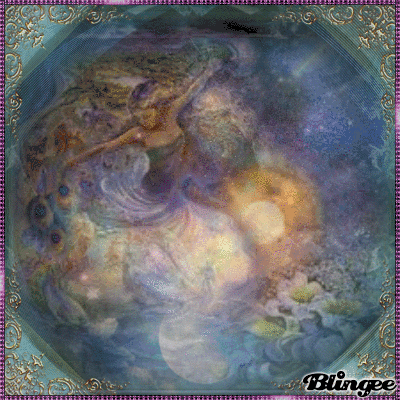
Schliesst die Augen und reist mit mir in eine Welt jenseits von Tag und Betriebsamkeit, weit, weit weg von allem, was sich so wichtig dünkt: Ansehen, Leistung, Geld und was der unabdingbaren Dinge mehr sind. Es ist das Reich von Nacht und Traum. Nichts ist dort feststehend. Ein Ding kann sich in ein anderes verwandeln im Bruchteil einer Sekunde, was sage ich? Sekunden, Minuten, Stunden, das sind dort Fremdworte, nicht von Bedeutung. Ewigkeiten dauern dort einen Lidschlag, und Universen haben in einem Fingerhut Platz. Ein Narr kann dort ein Weiser, ein Bettler König und ein Krüppel strahlend vor körperlicher Unversehrtheit sein. Wo, fragt Ihr mich, ist denn dieses Wunderland, und wie, bitte, komme ich dorthin? Wie, frage ich euch, kennt ihr eure Heimat denn nicht, von der ihr einst auszogt, um ein Abenteuer namens Welt zu bestehen, und die ihr doch in Wahrheit niemals verlassen habt? Folgt mir also zum Tor ohne Schlüssel! Es öffnet sich nur dem, der bereit ist, allen Tand zurückzulassen. Einzig der strahlende Stern auf der Stirn des Eintretenden ist erlaubt und erwünscht............aber, ich will nicht vorgreifen........Tretet nun ein.....
Nun also......das Tor brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr.......schon ist es verschwunden. Alles ist dunkel. Ist hier Nacht? Nun vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wartet das Dunkel auf unsere Wünsche, um sich zu wandeln in......was auch immer wir wollen. Also lassen wir es etwas heller werden...ja, schon besser. Oh! Seht ihr es auch? Da sitzt doch jemand, eine dunkle, üppige, weiche Gestalt, auf einem grossen Stein, wie es scheint. Ganz ruhig, unbeweglich und doch, da ist Bewegung, in ihr, um sie herum, eigentlich eine eigenartig, intensive Atmosphäre, Wellen, die von ihr ausgehen und sich zu Klang verdichten. Wer das ist? Kennt ihr nicht die Uralte Morg, Mutter der Universen, Gebärerin der Schöpfung?
So also sieht sie aus, wer hätte das gedacht? Aber nein, diese Gestalt haben wir ihr gegeben, für diese Geschichte. Ihr wisst doch, hier gelten die Gesetze des Traums!
Still und versunken sitzt sie auf dem Stein, die Augen geschlossen, in tiefer Kontemplation, versunken in ein Werk, das ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert. Es ist ihr eigentliches Werk, sie bringt Alles Was Ist hervor. Was? Jedes Staubkorn, jede Zelle, jeden Stein, jede Blume, alles? Ja und nein.
Aber, was ist das? Etwas Leuchtendes, Pulsierendes, wie ein riesiger, strahlender Stern erscheint da plötzlich wie aus dem Nichts geboren. Und in dem leuchtenden Gebilde Gestalten, nicht fest, sich immer wieder wandelnd, wie im Werden begriffen. Hier beginnt die Geschichte erst wirklich.
Wir sind am Anfang aller Zeiten, der eigentlich gerade jetzt ist, denn hier.......wir wissen es schon, hat Zeit keine Bedeutung.
Die uralte Morg hatte gerade ein wunderschönes Sternenkind geboren, strahlend, leuchtend, und sie begrüsste es mit einem Lied, einem Sternenlied. Das neue Wesen war sich seiner selbst noch nicht ganz gewiss. So viele Möglichkeiten, so viele Wege, aber welcher sollte gegangen werden? "Mein Kind", sprach die Morg zärtlich, "nicht so ungeduldig, du hast so viel Zeit vor dir, ja, alle Zeit der Welt!" "Zeit, was ist das? Ich will sofort wissen, was das ist, jetzt und gleich!" "Aber natürlich", erwiderte die Mutter. Und es entstand Anfang und Ende, Vorher und Nachher, Weg und Ziel. " Oh," sprach das Kind atemlos, jetzt muss ich mich aber beeilen! Womit beginne ich jetzt?" Auf einmal schienen so viele Wege gleichermassen einladend. Sie lockten alle zugleich und riefen: geh' mich! Nein mich! Mich! Mich! Mich! Laufe, fliege, krieche, schlängle dich oder schwimme! Nein, sei riesengross, winzigklein, schnell, langsam, schwer, leicht....aber sei! Das Ergebnis war eine fürchterliche Verwirrung. Das Kind, das Wesen aus ungezählten Möglichkeiten war nun der Zeit unterworfen, und das bedeutete, nur eines nach dem anderen erleben zu können. Aber dazu war es viel zu ungeduldig! "Mutter!" rief es verzweifelt, "hilf mir, was soll ich denn nun tun?" wieder lächelte die Alte Morg unergründlich. Dann eine Bewegung ihres Armes..........und da waren zwei aus dem Einen geworden. "Jetzt könnt ihr zwei verschiedene Wege zur gleichen Zeit gehen", meinte sie gütig. "Aber, bin ich jetzt noch......ich?" fragten die beiden entsetzt. "Das müsst ihr selbst herausfinden, und nun geht!"
Bald darauf waren die Beiden auf dem Weg ihrer Wahl. Sie wünschten und es wurde. Sie waren so vertieft in ihr aufregendes Abenteuer!
Bald aber begann das gleiche Dilemma wieder von vorne. Immer noch waren da so viele Wege, und immer noch konnten nur zwei auf einmal gegangen werden. Die zwei Wesen barsten fast vor Erlebnishunger. Alles ging so schrecklich langsam, langweilig! So kehrten sie zurück zur Alten Morg und klagten ihr ihr Leid. Die wiegte sinnend den Kopf, lange, lange. dann sprach sie ernst: " Ich glaube, ich kann euch helfen.......ja, es ist die einzige Lösung. Sie hob ihren Arm. Als sie ihn wieder sinken liess, zersprangen die beiden Sterne in ungezählte Sternsplitter. Sie flogen in alle Windrichtungen, in alle Zeiten. Sie verteilten sich buchstäblich überall, formten Welten, bildeten Universen. Gestalten von ungeheurer Vielfalt entstanden, grosse, kleine, behaarte, glatte, flinke, bedächtige, ja, alles, was nur in irgend einer Weise vorstellbar ist, wurde Wirklichkeit. Pflanzen, Tiere, Steine......Menschen. Kaum waren sie entstanden, waren sie auch schon unterwegs auf all ihren verschiedenen Wegen.
Sie führten in verschiedene Welten, in verschiedene Zeiten, und immer taten sich wieder neue auf. Die Tiere und Pflanzen behielten immer ihre Herkunft in Erinnerung, die Splitter des Sterns aber, die sich als Menschen erkannten, begannen bald, sich als einzigen Zweck des ganzen Spektakels zu sehen.
Wohl leuchtete auf der Stirn eines Jeden immer der strahlende Stern, aber irgendetwas musste mit den Augen der Menschen passiert sein. Die allerwenigsten schienen ihn nämlich zu sehen!
Nur manchmal, oder vielleicht öfter, als ihr denkt, passierte etwas:
Die Alte Morg hatte nämlich in ihrer grenzenlosen Weisheit ihr Lied im Herzen des Sternenkindes vergraben, für den Fall der Fälle. Nun, nach seiner Aufsplitterung in ungezählte Einzelwesen aber besass jedes von ihnen nur mehr ein winziges Bruchstück davon, einen einzigen Ton, der jedoch das ganze Lied in sich barg.
Jeder Mensch erklang nun in einem, nur ihm allein zugehörigen Ton, der aus ihm hervordrang und ihn umgab wie eine schimmernde Hülle, ein Sternenton.
Manche Menschen hörten den Ton in ihrem Herzen und setzten ihn in Musik um. Aus ihnen wurden Musiker und Komponisten.
Manchen Menschen erschien er wie leuchtende Farben und Formen. Aus ihnen wurden Maler und Bildhauer.
Manchen wurde er zu wirbelnder Bewegung. Das waren die Tänzer.
Vielen aber erschien er in grünenden Pflanzen, und sie behüteten und pflegten, was alle Anderen ernährte. Sie wurden Bauern und Gärtner.
Manche aber erkannten, wenn der Ton im Herzen eines Menschen verstimmt war, sodass Freudlosigkeit und Leiden daraus erwuchs. Das waren die Heiler.
Dann gab es da noch die Bauleute, die Lehrer, die Dichter, die Händler. Viele aber, und das ist sehr schade, hörten nicht mehr auf ihren Sternenton, oder setzten ihn um in das Klingeln von Münzen, das Rascheln von Geldscheinen oder Klirren von Waffen. Hier hatten die Heiler dann wieder viel zu tun und waren meistens damit sehr überfordert.
Manche aber waren all Dies und doch etwas ganz Anderes. Ihnen war es gegeben, auch manch anderen Ton als nur ihren eigenen zu vernehmen, und sie machten sich ihren eigenen Reim darauf. Sie stellten Vergleiche an, untersuchten Ähnlichkeiten, begannen mit den Tönen zu spielen, zu experimentieren.
Sie erkannten, dass es tiefe Zusammenhänge geben musste. Die stiessen auf Ähnlichkeiten, Gleichklänge, ja Harmonien, aber auch auf Dissonanzen.
Sie waren Magier.
Mancher von ihnen traf im Laufe eines Erdenlebens auch auf einen oder mehrere Menschen, die im gleichen Ton mit ihm klangen, Sternengeschwister! Welch ein wunderbares Wiedererkennen, wie Heimfinden nach langer Wanderschaft! Endlich Zugehörigkeit, endlich Verstehen, endlich nicht mehr alleine unter Fremden!
Wir aber, wir durch das Tor ohne Schlüssel Getretenen, erkennen nun die tiefe Weisheit und Liebe der Mutter. In weiser Voraussicht hatte sie geahnt, wie einsam sich die Menschen manchmal fühlen würden, wenn sie, jeder auf seinem eigenen Weg, vergessen würden, woher sie einst ausgezogen waren. Deshalb hatte sie, der es ja ohne Mühe möglich gewesen war, Töne ohne Zahl hervorzubringen, Menschengruppen mit den gleichen Tönen ausgestattet, Sternenfamilien!
Um aber nicht wieder erneut Abgrenzung und Einsamkeit zu erschaffen, erstrecken sich die Sternfamilien über alle Gruppen, quer durch alle Schichten, durch alle Geschlechter.
Aber nun weiter in unserer Geschichte. Wo waren wir stehengeblieben? Ach ja, bei den Magiern, Hexen, Schamanen, Weisen Frauen und Männern, den Sterndeutern! Bei denen, die auf ihrem Weg durch die Zeiten, dabei waren, das Lied der Mutter wiederzufinden!
Den Schamanen, den ältesten unter ihnen, erklang der mütterliche Herzschlag aus ihren Trommelschlägen, wenn sie ins Unten reisten oder ins Oben, aber eigentlich immer ins Innen.
Die Hexen sangen Fragmente des alten Liedes als Zaubergesänge, wenn sie mit Hilfe ihrer geliebten Geschwister, der Kräuter, nahe ans Reich der Alten Morg gelangten.
Die Weisen Frauen und Männer halfen ihren Brüdern und Schwestern, dem Wiederhall des Liedes in ihrem Inneren nachzuspüren.
Die Sterndeuter aber verfolgten die bedeutungsvollen Lichter am Firmament. Sie waren oftmals nahe daran, hinter die Kulissen des Geheimnisses zu blicken. Jedenfalls aber erkannten sie die Splitter des einstigen, riesigen Sternenkindes, dem alles Seiende einst entsprungen war. Sie waren es auch, die als erste die versprengten Teile des Sternes des ewigen Bewusstseins auf den Stirnen der Menschen entdeckten. Sie erkannten auch Abbilder unserer Geschwister, der Tiere, am Firmament, gleich neben den Göttinnen und Helden.
So spricht die Alte Morg, und so wird es sein:
"Sie, die Magier, die Weisen, die Hexen, Zauberer, Sterndeuter, auf all ihren Wegen durch Zeit und Raum; sie halten ihren Weggenossen den magischen Spiegel vor die fast erblindeten Augen, damit sie endlich erkennen, was sie sind.
Ihr aber, Alexandra und Sylvia, meine Töchter, ihr tragt den gleichen Ton im Herzen, und die Fragmente eures Sternes passen genau ineinander, wie Teile eines kosmischen Puzzlespieles. Deshalb werdet ihr gemeinsam, jede in der ihr eigenen Weise an der Aufgabe arbeiten, anderen Menschen diese Wahrheit in Erinnerung zu rufen:
Alle Wesen sind Sternengeschwister, meine Kinder, Kinder der Alten, Ewig Jungen Mutter, geboren aus meiner unendlichen Liebe, ausgestattet mit meinem strahlenden Licht, erfüllt von meinem herzbewegenden Gesang, der Alles Was Ist hervorbringt. Eines Tages werdet Ihr gemeinsam in den Grossen Gesang einstimmen und alle unzähligen Wege als einen einzigen grossen erkennen, der zurückführt in meine mütterlichen Arme.
Quelle:Mit freundlicher Genehmigung von Margarete Lassi
(Margarete Lassi vulgo Morgane)
DAS ANDERE LAND ...
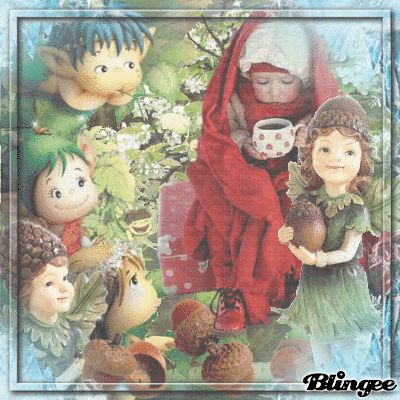
Wieder war es Winter geworden. Diesmal einer mit viel Schnee, so wie es früher einmal gewesen war, früher, in den sagenhaften Zeiten, von welchen die Eltern und Grosseltern immer sprachen wie von einem längstversunkenen Paradies.
Aber seltsam, jetzt murrten die Erwachsenen über verschneite Autos, matschige Gehsteige und hohe Heizkosten, und die Älteren zwickte die Kälte gewaltig in den rheumatischen Gelenken. Die Kinder aber betrachteten den Schnee als ihr eigentliches, wahres Weihnachtsgeschenk, eines, das ihnen buchstäblich vom Himmel gesandt worden war.
Seppi, gerade eben sieben Jahre alt geworden und seine jüngere Schwester Anna hatten zwei grosse Plastikschüsseln zum Rutschen unter dem Weihnachtsbaum gefunden. Anna meinte, das Christkind habe sich vorher mit der Frau Holle genau abgesprochen, damit für die Rodeln auch genügend Schnee vorhanden sein würde. Sie war sehr zufrieden mit den Beiden. Und nun waren alle Kinder des Dorfes hinten, beim Hüterbergl versammelt und rodelten und rutschten, dass es eine Freude war. Auf dem Hüterbergl gab es ein kleines Wäldchen aus Kiefern, Birken und einigen, wenigen, uralten Eichen, so alt, dass sich keiner mehr erinnerte, sie jemals anders als riesengross gesehen zu haben, auch nicht die Grossmütter und Grossväter, nicht einmal mehr die Urgrossmütter und Urgrossväter. Und die waren doch auch wirklich uralt, oder? Manche Kinder behaupteten hinter vorgehaltener Hand, beim Hüterbergwäldchen gehe es nicht mit rechten Dingen zu, es spuke, sagten sie. Anna wunderte sich sehr, sie sah überhaupt keine Spucke, nirgendwo. Aber Seppi, ganz kluger älterer Bruder, erklärte, das sei eben Geisterspucke, und die könne man nicht sehen. Diese Erklärung fand Anna nicht wirklich zufriedenstellend, aber mit Geistern kannte sie sich nicht aus. Sie nahm sich insgeheim vor, die Grossmutter darüber zu befragen.
Die Buben konnten noch immer nicht genug kriegen vom Auf und Ab auf dem kleinen Hügel. Anna aber wollte schon heim, sie fror gottserbärmlich. Sie nahm ihre Rodelschüssel unter den Arm und stapfte auf ihr naheliegendes Haus zu. Da sah sie, zu ihren Füssen im Schnee einige kleine, braune Becherchen liegen. Sie wusste, das waren Eichelbecher, die Fruchthüllen der Eicheln. Im Herbst war sie einmal hiergewesen, und da hatten mindestens hundert Millionen davon im Gras gelegen. Damals hatte sie nur ganz viele Eicheln gesammelt, für den Kindergarten. Dort wollte sie mit Hilfe ihrer Kindergärtnerin einen Eicheltier - Zoo basteln. Aber heute, heute schienen die kleinen Becherchen genau richtig als Hüte für ihre Playmobil - Männchen, vielleicht auch als Teetassen für ihre Barbiepuppe? Schnell sammelte Anna alle Becherchen ein und steckte sie in den Sack ihres Schneeanzugs. Dabei stülpte sich ein Eichelbecherchen wie von selbst über ihren Mittelfinger. Er passte genau, wie der rote Fingerhut, den Mama immer zum Nähen über ihren Finger stülpte.
Aber der war Anna viel zu gross. Jetzt hatte sie auch einen, einen eigenen Fingerhut!
So, jetzt war es aber wirklich höchste Zeit, heimzugehen. Aber, was war das? Anna konnte das Haus nicht mehr sehen. Aber, es war doch genau da vorne, gleich neben dem Rodelhügel, sonst hätte Mama sie nicht alleine herkommen lassen! Hier aber waren überhaupt keine Häuser, kein einziges mehr. Das war doch unmöglich, ein ganzes Dorf konnte doch nicht von einem Augenblick auf den anderen verschwinden! Und überhaupt, wo war denn der ganze Schnee plötzlich hingekommen? Die Eichen trugen mit einem Mal üppiges, grünes Laub, das Gras war grün, die Vögel sangen, und nirgends war etwas von Seppi und seinen Freunden zu sehen. Anna fürchtete sich sehr. Es stimmte also doch, das mit der Geisterspucke! Und nun war sie hier, ganz allein, in dieser fremden Umgebung, ganz ohne Seppi, ganz ohne Mama und Papa, ganz ohne Grossmutter und Grossvater, ganz alleine! Da kam ganz aus heiterem Himmel ein kalter Wind auf und blies das grüne Laub mit einem Hui von den Eichen. Es wurde fast ganz finster. Überall schienen glitzernde Augen aus dem Geäst zu funkeln. Ja, sie beobachteten sie. Sicher würden gleich irgendwelche Ungeheuer hervorstürzen, und die würden sie sicherlich auffressen oder irgendwas ganz Fürchterliches mit ihr anstellen! Anna kauerte sich zusammen, ganz klein, und dann begann sie vor Angst zu weinen.
"Mama, komm, bitte, komm' und hol' mich! Maaaammmaaaa!"
"Rinsel - pinsel, was für ein Gewinsel", sagte da ein da ein zartes, feines Stimmchen neben Anna.
Die hob erstaunt den Kopf und vergass vor lauter Überraschung ganz aufs Weinen. Sie blickte direkt in grosse, goldglänzende Augen. Die Augen waren fast das Grösste in dem kleinen, zarten Gesichtchen. Das gehörte einem winzigen Kerlchen mit spitzen Ohren und einem grünen Gewand, das Anna gerade eben bis zu den Schultern reichte, und Anna konnte nicht gerade als grossgewachsen bezeichnet werden. In ihrer Kindergartengruppe gehörte sie zu den Kleinen, obwohl sie schon fünf Jahre alt war und nächstes Jahr in die Schule gehen sollte.
"Du schnell aufhören mit Gewinsel, du nicht mehr Angst, du binse wieder froh!"
"Wer bist du, und wo bin ich hier, und wieso redest du so komisch?" fragte Anna verwundert.
"Ich nix sprichse komisch, ich sprichse Wichtelsprich. Ich binse Ilberich. Du binse in Wichtelland, daheim bei mich. Und bitte nicht mehr winsel, bitt, bitt."
Das hörte sich so komisch an, dass Anna für einen Moment ganz auf ihre Angst vergass und lauthals herauslachte. Gleich darauf schämte sie sich. Sie wollte das kleine Kerlchen nicht kränken. Mama sagte immer, jemanden auszulachen, sei ganz schlimm und ausserdem dumm. Aber sie fürchtete sich jedenfalls nicht mehr, das war schon etwas. Und sie bemerkte gleich darauf wieder eine Veränderung. Es war wieder hell, und an den Bäumen spross zartes, grünes Laub. Was, zum Donnerdrummel, ging hier eigentlich vor? Ilberich nahm Anna an der Hand und führte sie zu dem kleinen Hügel, der genauso aussah, wie das Hüterbergl zuhause. Er steckte zwei Finger in den Mund und tat einen lauten Pfiff. Daraufhin öffnete sich ein kleines Türchen. Seltsam, es war vorher sicher noch nicht dagewesen, das hätte Anna beschwören können! Es musste eine Behausung sein. Und so war es auch. Aus der Türe trat eine rundliche Frau. Sie trug ein Kleid im gleichen Grün wie das Gewand von Ilmerich, und sie war ebenso klein wie er. Freundlich lächelnd bat sie Anna in ihr Haus. Sowas! Das war ja allerliebst! Hier drinnen standen kleine Bänke, mit Moos weich gepolstert, ein winziger Tisch, der war fein gedeckt mit allerlei Speisen, die Anna sehr fremd vorkamen. Die Frau klatschte in die Hände. Da kamen fünf Wichtelkinder zur Tür herein. Sie kicherten und zupften neugierig an Annas Gewand, bis sie von ihrer Mutter freundlich aber bestimmt zur Ordnung gerufen wurden.
"Kinder, sagse guten Tag zu unsere Gast und benimmse euch!"
Jedes der Kinder machte eine tiefe Verbeugung vor Anna und stellte sich vor:
Alberich, Elberich, Olberich, das waren die Knaben und Albera und Elbera die beiden Mädchen.
Dann ging's zu Tisch. Die fremden Speisen schmeckten wunderbar, machten satt und warm....und anscheinend fröhlich, denn die Wichtelfamilie holte allerliebste kleine Instrumente hervor und begann lustige Tanzweisen zu spielen, die Anna Lust zum Tanzen und Springen machten.
Mit einem Mal aber erstarb die Musik. Es wurde dunkel und bitter kalt im Raum. Die Wichtel hüllten sich und ihren Gast in warme Decken und entzündeten Kerzen und ein Feuer im Kamin. Alle drängten sich ängstlich zusammen. Draussen heulte der Sturm wie ein wildgewordener Drache. Was in aller Welt war das denn nur, so von einem Augenblick zum anderen? Das war ja furchterregend!
Mama Wichtel nickte verständnisvoll:
"Isse ganz often, Wichtel kennse das schon. Kommse aus Riesenland."
Auf Annas fragenden Blick reichte sie dem Mädchen ein Holzstück mit einem Astloch und hiess es durchsehen. Aber......was.....was war das? Das konnte doch nicht sein! Anna blickte direkt in ihre Wohnstube daheim. Da sassen ihre Eltern und die Grosseltern. Alle vier schienen sehr ungehalten zu sein. Vater schimpfte mit Seppi:
"Wo ist deine kleine Schwester? Du solltest doch auf sie Acht geben! Kann man sich denn gar nicht auf dich verlassen?"
"Oh je", rief Anna voller Schrecken aus, "ich hab' ganz vergessen auf daheim, die machen sich jetzt schon Sorgen um mich. Und dabei kann der Seppi ja gar nichts dafür! Ich muss schnell wieder nachhause!"
Alle Wichtel sahen Anna erwartungsvoll an. Was wollten sie nur von ihr? Dann sagte Ilberich, der Wichtelvater ernst:
"Du binse aus Riesenland. Riesenland isse gleich neben Wichtelland, ganz nah. Riesen machse Wetter in Wichtelland. Wennse Riesen böse oder traurig, wennse Riesen streit, dannse Wetter in Wichtelland kalt und dunkel, duse wiss?"
So war das also! Wer hätte so etwas gedacht! Unglaublich!
"Wirse haben hergeholt dichse, duse muss wissen, was Riesen mach mit Wichtelland, wenn böse sind."
Das war ja eine schöne Bescherung. Sie, die Menschen waren zuständig für das Wetter im Wichtelreich! Anna musste das sofort daheim erzählen. Aber, würden sie ihr das glauben? Würden sie nicht sagen: ach, du hast zuviel Phantasie! Ja, gewiss, das würden sie, das sagten sie oft. Trotzdem. Sie musste es zumindest versuchen. Das war sie ihren neuen Freunden einfach schuldig.
Wie Anna wieder nachhause kam? Sie zog einfach den Eichelbecher wieder vom Finger, und da war sie.
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung von Margarete Lassi
(Margarete Lassi vulgo Morgane)
DIE SALZPRINZESSIN ...
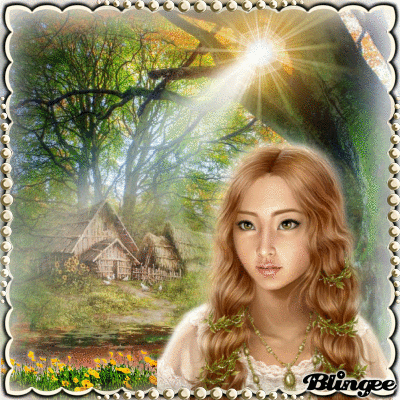
Es war einmal ein König, der hatte drei Töchter, Antonia, Martha und Mariechen, die er wie sein Augenlicht liebte. Er war schon alt und des Herrschens müde und so sann er oft darüber nach, welche seiner Töchter nach seinem Tode Königin werden sollte. Die Wahl wurde ihm schwer, denn er liebte alle drei gleichermaßen. Endlich, nach reiflichem und langem Erwägen entschloss er sich, diejenige zur Herrscherin zu bestimmen, die ihn am innigsten liebte. Er berief die Prinzessinnen vor seinen Thron und sprach zu ihnen:
“Meine lieben Töchter! Ich bin alt und schwach geworden und werde nicht mehr lange unter euch weilen. Doch bevor ich sterbe, will ich eine von euch zu meiner Nachfolgerin ernennen. Vorerst aber will ich prüfen, welche mich am liebsten hat. Sage du mir, Antonia, meine Älteste, wie liebst du deinen Vater?”
“Ach, lieber Vater, ich liebe dich mehr als Gold!” antwortete Antonia und küsste seine Hand.
“Und du, Martha, wie sehr liebst du mich denn?”
“Ach, mein gutes Väterchen”, rief das Mädchen und umarmte den König, “ich liebe dich wie mein Brautgeschmeide.”
“Und nun du, meine Jüngste, sage mir, wie du mich liebst?” fragte der König und wandte sich Mariechen zu.
“Ich, Vater, liebe dich … wie Salz!” antwortete sie nach kurzem Überlegen und sah den König allerliebst an.
“Oh, du böses Mädchen, du liebst deinen Vater nur wie Salz? Schäme dich!” riefen ihre beiden Schwestern empört.
“Ja, wie Salz liebe ich meinen Vater!” wiederholte Mariechen von neuem.
Da wurde auch der alte König zornig. Er konnte nicht verstehen, dass Mariechen ihre Liebe zu ihm mit einem so einfachen Dinge verglich, das jedermann, auch der Ärmste besaß und nur für wenige Groschen erwerben konnte.
“Geh, mir aus den Augen, du undankbares Mädchen!” rief er. “Ich will dich erst dann wiedersehen, wenn den Menschen Salz wertvoller als Gold und Edelsteine erscheinen wird. Dann kehre zurück, denn dann will ich dich zur Königin machen!”
Dass jemals eine solche Zeit kommen könnte, daran glaubten weder der alte König noch seine beiden älteren Töchter.
Ohne zu widersprechen, mit tränenüberströmtem Antlitz, verließ das stets gehorsame Mariechen das Schloss ihres Vaters. Einsam und verlassen stand sie auf der Straße und wusste nicht, wohin sie ihre Schritte wenden Schließlich beschloss sie, der Richtung des Windes zu folgen. Sie wanderte über Berge und Täler, bis sie zu einem dichten Wäldchen kam. Da trat ihr eine alte Frau in den Weg. Mariechen grüßte freundlich und wünschte der Alten einen guten Morgen. Die Alte sah die rotgeweinten Augen des Mädchens und sagte mitfühlend:
“Was bedrückt dich denn, mein Kind, dass du so bitterlich weinest?”
“Ach, Mütterchen!” antwortete Mariechen, “fragt nicht nach meinem Kummer! Ihr könnt mir ja ohnehin nicht helfen!”
“Vielleicht doch!” sagte die Alte lächelnd. “Öffne mir dein Herz und sage mir, was dich quält. Wo graue Haare sind, da ist auch Vernunft.”
Ermutigt erzählte nun Mariechen, was sich zugetragen hatte, und weinend fügte sie hinzu:
“Ich will ja gar nicht Königin werden, sondern will nur allzu gerne meinen Vater von meiner aufrichtigen Liebe zu ihm überzeugen!”
Die Alte ließ Mariechen zu Ende erzählen, obzwar sie von allem Anfang an wusste, was der Grund ihres Kummers war, denn sie war keine gewöhnliche alte Frau, sondern eine gute Fee. Freundlich nahm sie das Mädchen bei der Hand und forderte es auf, in ihre Dienste einzutreten. Mariechen war überglücklich und ging mit der Alten.
Die gute Fee führte sie in ihr Häuschen und gab ihr zu essen und zu trinken. Als sich Mariechen gelabt hatte, fragte die alte Frau:
“Kannst du Schafe hüten? Kannst du melken? Kannst du spinnen und weben?”
“Nichts desgleichen habe ich gelernt!”, antwortete das Mädchen traurig. “Doch wenn Ihr es mir zeigen wollt, will ich es versuchen und sicherlich schnell lernen!”
“Dies werde ich gerne tun und dich in allem unterweisen. Sei nur stets gut und gehorsam und tue, was ich dir sagen werde. Wenn sich die Zeit zur Zeit gesellt, wird dir Glück und Freude erwachsen!”
Mariechen versprach folgsam zu sein, und da sie fleißig und willig war, lernte sie schnell, und die Arbeit machte ihr viel Freude.
Inzwischen lebten die beiden älteren Prinzessinnen auf dem Schloss in Saus und Braus. Mit falschen Worten und vorgetäuschten Liebkosungen umgarnten sie den alten König und verlangten täglich neue und neue Geschenke. Die älteste Prinzessin stand den lieben Tag lang vor dem Spiegel und kleidete sich in prächtige Gewänder, während ihre Schwester sich mit Gold und Edelsteine schmückte und unaufhörlich tanzte. Ein Festmahl folgte dem anderen, und die Mädchen hatten nichts anderes als nur ihr Vergnügen im Sinne.
Da gingen dem alten König die Augen auf und er musste erkennen, dass seinen Töchtern Gold und Tanz lieber waren als er. Er gedachte seiner jüngsten Tochter und erinnerte sich an die aufrichtige Liebe, mit der sie ihn immer umgeben, ihn geherzt und geliebkost hatte und er wusste nun, dass er sie allein zur Königin hätte ernennen sollen. Wie gerne hätte er sie zurückgeholt, wenn er nur ihren Aufenthaltsort gekannt hätte! Kamen ihm aber ihre Worte in den Sinn, dass sie ihn nur so wie Salz liebe, wurde er wiederum ärgerlich und zweifelte an ihr. Eines Tages sollte ein Festmahl im Schloss gegeben werden. Da stürzte der Koch vor des Königs Thron und rief:
“Herr, ein großes Missgeschick hat uns befallen! Das Salz in der Küche und auch im ganzen Lande ist zerflossen und hat sich aufgelöst. Womit soll ich denn die Speisen salzen?”
“Kannst du denn nichts anderes zum Würzen verwenden?” fragte der König ärgerlich.
“Oh, Herr, welches Gewürz könnte denn Salz ersetzen?” rief der Koch verzweifelt. Auf diese Frage aber wusste der König keine Antwort. Er wurde böse und befahl dem Koch, das Festmahl ohne Salz zu bereiten.
“Wenn es dem König recht ist, mir kann es sicherlich recht sein!”, dachte der Koch und sandte ungesalzene Speisen zur Königstafel. Den Gästen wollten die Gerichte nicht munden, obzwar sie sonst schmackhaft und wohlgefällig zubereitet waren.
Der König sandte seine Boten nach allen Windrichtungen aus, um Salz zu holen, doch sie alle kehrten unverrichteter Dinge und mit leeren Händen ins Schloss zurück. Das gleiche Missgeschick hatte auch die Nachbarländer betroffen und wer noch einen kleinen Salzvorrat hatte, wollte sich nicht für alles Gold der Welt von ihm trennen.
Auf Befehl des Königs bereitete nun der Koch nur süße Speisen und Gerichte zu, die keines Salzes bedurften. Doch auch diese Speisen wollten den Gästen auf die Dauer nicht schmecken, und als sie sahen, dass keine Besserung abzusehen war, verließen sie, einer nach dem anderen, das königliche Schloss. Die beiden Prinzessinnen waren untröstlich, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Gäste ziehen zu lassen.
Doch nicht nur die Menschen, sondern auch das Vieh in den Ställen litt unter diesem Salzmangel. Kühe, Ziegen und Schafe gaben wenig Milch. Es war ein Unglück für jedermann im Lande. Die Leute wankten müde zur Arbeit und wurden schwach und krank. Sogar den König und seine beiden Töchter verschonte die Krankheit nicht. Da erst erkannten sie, welch seltene Gabe des Himmels das Salz war und wie wenig sie diese geschätzt hatten. Die Schuld, Mariechen Unrecht getan zu haben, lastete schwer auf des Königs Gewissen.
In der Zwischenzeit lebte das Mädchen in der Hütte im Walde glücklich und zufrieden. Sie ahnte nicht, wie schlecht es ihrem Vater und ihren beiden Schwestern zu Hause erging. Die weise Frau jedoch wusste nur zu genau, was sich dort zutrug!
Eines Tages sprach sie zu Mariechen:
“Stets sagte ich dir, dass wenn die Zeit sich zur Zeit gesellt, deine Stunde kommen wird. Deine Stunde hat nun geschlagen. Kehre nach Hause zurück!”
“Ach, mein gutes Mütterchen, wie könnte ich denn jemals wieder zurückkehren, wenn mich mein eigener Vater aus dem Haus gewiesen hat”, antwortete das Mädchen und fing zu weinen an.
Da erzählte ihr die gute Fee, was sich während ihrer Abwesenheit im Lande zugetragen hatte, dass nun die Worte an ihren Vater wahr geworden und Salz wertvoller als Gold und Edelsteine sei.
Ungern verließ Mariechen die gute Fee, die sie so viele nützliche Dinge gelehrt hatte. Doch ihre Sehnsucht nach dem Vater war erwacht und sie konnte es kaum erwarten, ihn wiederzusehen.
“Du hast mir treu gedient, Mariechen”, sprach die Alte beim Abschied, “und ich will dich gut entlohnen. Sage mir, was du dir wünschest.”
“Ihr wart so gut zu mir und habt mich so vieles gelehrt”, antwortete Mariechen, “ich will nichts anders von Euch, Mütterchen, als ein wenig Salz, welches ich meinem Vater bringen will.”
“Und nichts weiter wünschest Du? Ich könnte jeden deiner Wünsche erfüllen”, fragte nochmals die gute Fee.
“Nein, nichts mehr begehre ich, Mütterchen, als das Salz”, beharrte Mariechen.
“Da du das Salz so hoch schätzest, möge es dir niemals daran fehlen!” sprach die Alte. “Nimm hier diese kleine Weidenrute, und wenn einmal der Mittagswind zu wehen beginnt, folge ihm. Gehe durch drei Täler und über drei Berge, dann halte ein und berühre den Boden mit der Weidenrute. Die Erde wird sich öffnen und du trete getrost ein. Was du dort finden wirst, behalte – es sei dein Eigen.”
Dankend nahm Mariechen die Weidenrute und verwahrte sie sorgfältig. Dann gab ihr die alte Frau ein Beutelchen, welches sie mit Salz füllte. Schweren Herzens nahm das Mädchen Abschied von dem kleinen Waldhäuschen, das ihr zur zweiten Heimat geworden war und machte sich, von dem Mütterchen begleitet, auf den Heimweg. Weinend versicherte Mariechen, dass sie wiederkommen wolle, um die alte Frau zu holen und sie für immer mit sich auf Schloss zu nehmen.
“Bleibe nur stets gut und gehorsam”, sagte die Alte lächelnd, als sie den Rand des Wäldchens erreicht hatten, “und es wird dir wohl ergehen!”
Als ihr Mariechen nochmals für ihre Güte danken wollte, war sie verschwunden.
Verwundert stand das Mädchen da, doch die Sehnsucht nach ihrem Vater ließ sie nicht lange verweilen und sie eilte dem Schlosse zu.
Sie war ärmlich gekleidet und da sie den Kopf in ein Tuch gehüllt hatte, erkannte sie niemand. Die Diener im Schloss verweigerten ihr den Eintritt zum König, da er krank und schwach im Bette lag.
“Ach, lasst mich doch ein.”, bat sie. “Ich bringe ein Geschenk, welches dem König seine verlorene Kraft und Gesundheit wiedergeben wird!”
Als der König dies hörte, befahl er, das Mädchen zu ihm zu bringen.
“Gebt mir ein Stück Brot!” bat Maiechen, als sie vor dem König stand.
“Salz kann ich Dir mit dem Brote jedoch nicht reichen lassen,” seufzte der König, “denn wir haben im Schloss kein Stäubchen davon.”
“Das Salz habe ich!” rief Mariechen und sie öffnete ihren Beutel, streute ein wenig aufs Brot und reichte es dem König.
“Salz! Hört ihr Leute”, rief der König entzückt. “Wie soll ich dir nur für deine Gabe danken? Sage mir, was du dir wünschest!”
“Nichts wünsche ich mir sehnlicher, als dass du, mein geliebtes Väterchen, mich wiederum zu dir nimmst und mich ebenso liebst wie das Salz hier”, antwortete Mariechen und enthüllte ihr liebliches Antlitz.
Der König war überglücklich, als er seine jüngste Tochter wiedersah. Er bat sie um Verzeihung, doch Mariechen küsste und streichelte ihren Vater nur und hatte auch schon alles Unrecht, welches ihr geschehen war, vergessen.
Schnell verbreitete sich im Schloss und auch im ganzen Lande die Kunde, dass des Königs jüngste Tochter heimgekehrt war und Salz mitgebracht hätte. Jeder, der im Schloss erschien und um Salz bat, bekam ein wenig aus dem Beutelchen, welches nie leer wurde.
Der König wurde gesund und voller Freude darüber berief er eines Tages um die Mittagsstunde seine Edelleute, um ihnen zu verkünden, dass er Mariechen zu seiner Nachfolgerin bestimmen wolle.
Mariechen wurde gerufen und unter großem Jubel des Volkes wurde sie zur Königin ernannt. Da strich ein warmer Windhauch leise über ihre Wange und es war ihr, als höre sie die Stimme der alten Frau im Walde. Sie erkannte das Zeichen, welches ihr der Mittagswind gab und beschloss, ihm zu folgen.
Schnell vertraute sie sich ihrem Vater an, nahm die kleine Weidenrute zur Hand und schritt in der Richtung des Windes aus. Sie wanderte über drei Berge und durch drei Täler und blieb hierauf stehen, so wie es ihr die alte Frau geboten hatte. Mit ihrer Rute schlug sie auf den Boden und siehe da! Die Erde öffnete sich und Mariechen trat ein.
Sie stand inmitten eines großen Saales, dessen Wände und Boden wie aus Eis gebaut zu sein schienen. Von allen Seiten liefen winzige Männchen herbei, die alle hellleuchtende Fackeln trugen.
“Sei uns willkommen, oh Königin!” riefen sie. “Wir haben deine Ankunft lange erwartet! Unsere Gebieterin befahl uns, dir dieses unterirdische Reich zu zeigen, denn es gehört dir!”
So schnatterte und plapperte es von allen Seiten, die kleinen Wesen hüpften und tanzten ihre Fackeln schwingend um Mariechen herum. Sie kletterten auf die Wände hinauf und sprangen über die glitzernden Kristalle, die wie Edelsteine im Fackellichte blitzten.
Die kleinen Männchen führten Mariechen durch Gänge, von deren Decken silberschimmernde Eiszapfen hingen. Sie geleiteten sie in Gärten, in welchen rote Eisrosen und andere wunderbare Blumen blühten. Dann brachen sie eine der schimmernden Blüten ab und reichten sie Mariechen, doch kein lieblicher Duft entströmte ihrem Kelch.
“Was soll denn all dies bedeuten?” fragte das Mädchen verwundert. “Niemals noch habe ich solche Pracht gesehen!”
“All dies ist Salz!” riefen die Männchen im Chor. “Nimm davon, so viel dir beliebt. Der Vorrat ist unerschöpflich!”
Mariechen dankte den kleinen Wesen von ganzem Herzen und kehrte ans Tageslicht zurück. Der Eingang zum unterirdischen Reiche aber schloss sich nicht wieder.
Als sie nach Hause zurückkehrte und ihrem Vater von ihrem wunderbaren Erlebnis erzählt hatte, erkannte dieser, mit welch unschätzbarem Reichtum seine Tochter von der alten Frau im Zauberwald überschüttet worden war.
Mariechen sehnte sich nach der alten Frau, und sie eilte mit einem großen Gefolge zum vertrauten Wäldchen, um sie zu finden und für immer ins Schloss zu holen, so wie sie es ihr beim Abschied versprochen hatte. Doch so sehr sie sich auch bemühte und den Wald kreuz und quer durchsuchte – es gelang ihr nicht, die Hütte zu finden und das Mütterchen blieb verschwunden.
Da erst wurde es Mariechen klar, dass die alte Frau ihre gütige Fee gewesen war. Sie kehrte heim und wurde von ihren Untertanen stets geliebt und geehrt.
Und wenn sie nicht gestorben ist, so lebt sie vielleicht noch heute.
Märchen nach den Gebr. Grimm, (Autor unbekannt)
DER ALLERERSTE WeiHNACHTSBAUM..., Märchen von Hermann Löns

Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig bellend vor ihm herlief, merkte das und schlich hinter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit. Es war alle Jahre dasselbe. Es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und Eßwaren, das war auf die Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen, so wollte er es, das taten sie aber nur selten. Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen, eine Weihnachtsfreude, an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten durften es auch nicht sein, denn er hatte soundsoviel auszugeben und mehr nicht.
So stapfte er denn auch durch den verschneiten Wald, bis er auf dem Kreuzweg war. Dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über die Verteilung der
Gaben.
Schon von weitem sah er, daß das Christkindchen da war, denn ein heller Schein war dort. Das Christkindchen hatte ein langes weißes Pelzkleidchen an und lachte über das ganze Gesicht. Denn um es
herum lagen große Bündel Kleeheu und Bohnenstiegen und Espen- und Weidenzweige, und daran taten sich die hungrigen Hirsche und Rehe und Hasen gütlich. Sogar für die Sauen gab es etwas: Kastanien,
Eicheln und Rüben.
Der Weihnachtsmann nahm seinen Wolkenschieber ab und bot dem Christkindchen die Tageszeit. "Na, Alterchen, wie geht's?" fragte das Christkind. "Hast wohl schlechte Laune?" Damit hakte es den Alten unter und ging mit ihm. Hinter ihnen trabte der kleine Spitz, aber er sah gar nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft. "Ja", sagte der Weihnachtsmann, "die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was, ich weiß nicht. Das mit den Pfefferkuchen und den Äpfeln und Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf, und dann ist das Fest vorbei. Man müßte etwas Neues erfinden, etwas, das nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei alt und jung singt und lacht und fröhlich wird. " Das Christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht; dann sagte es: "Da hast du recht, Alter, mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe daran auch schon gedacht, aber das ist nicht so leicht." "Das ist es ja gerade", knurrte der Weihnachtsmann, "ich bin zu alt und zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh vom vielen Nachdenken, und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weitergeht, schläft allmählich die ganze Sache ein, und es wird ein Fest wie alle anderen, von dem die Menschen dann weiter nichts haben als Faulenzen, Essen und Trinken."
Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald, der Weihnachtsmann mit brummigem, das Christkindchen mit nachdenklichem Gesicht. Es war so still im Wald, kein Zweig rührte sich, nur wenn
die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schneebehang mit halblautem Ton herab. So kamen die beiden, den Spitz hinter sich, aus dem hohen Holz auf einen alten Kahlschlag, auf dem große
und kleine Tannen standen. Das sah wunderschön aus. Der Mond schien hell und klar, alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber, und die Tannen standen darin, schwarz und weiß, daß es
eine Pracht war. Eine fünf Fuß hohe Tanne, die allein im Vordergrund stand, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den
Zweigspitzen kleine Eiszapfen, und glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein. Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmannes los, stieß den Alten an, zeigte auf die Tanne und sagte:
"Ist das nicht wunderhübsch?"
"Ja", sagte der Alte, "aber was hilft mir das ?" "Gib ein paar Äpfel her", sagte das Christkindchen, "ich habe einen Gedanken." Der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte es
sich nicht recht vorstellen, daß das Christkind bei der Kälte Appetit auf die eiskalten Äpfel hatte. Er hatte zwar noch einen guten alten Schnaps, aber den mochte er dem Christkindchen nicht
anbieten.
Er machte sein Tragband ab, stellte seine riesige Kiepe in den Schnee, kramte darin herum und langte ein paar recht schöne Äpfel heraus. Dann faßte er in die Tasche, holte sein Messer heraus, wetzte es an einem Buchenstamm und reichte es dem Christkindchen. "Sieh, wie schlau du bist", sagte das Christkindchen. "Nun schneid mal etwas Bindfaden in zwei Finger lange Stücke, und mach mir kleine Pflöckchen." Dem Alten kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat, was das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfadenenden und die Pflöckchen fertig hatte, nahm das Christkind einen Apfel, steckte ein Pflöckchen hinein, band den Faden daran und hängte den an einen Ast. "So", sagte es dann, "nun müssen auch an die anderen welche, und dabei kannst du helfen, aber vorsichtig, daß kein Schnee abfällt!" Der Alte half, obgleich er nicht wußte, warum. Aber es machte ihm schließlich Spaß, und als die ganze kleine Tanne voll von rotbäckigen Äpfeln hing, da trat er fünf Schritte zurück, lachte und sagte; "Kiek, wie niedlich das aussieht! Aber was hat das alles für'n Zweck?" "Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben?" lachte das Christkind. "Paß auf, das wird noch schöner. Nun gib mal Nüsse her!"
Der Alte krabbelte aus seiner Kiepe Walnüsse heraus und gab sie dem Christkindchen. Das steckte in jedes ein Hölzchen, machte einen Faden daran, rieb immer eine Nuß an der goldenen Oberseite seiner Flügel, dann war die Nuß golden, und die nächste an der silbernen Unterseite seiner Flügel, dann hatte es eine silberne Nuß und hängte sie zwischen die Äpfel. "Was sagst nun, Alterchen?" fragte es dann. "Ist das nicht allerliebst?" "Ja", sagte der, "aber ich weiß immer noch nicht..." "Komm schon!" lachte das Christkindchen. "Hast du Lichter?" "Lichter nicht", meinte der Weihnachtsmann, "aber 'nen Wachsstock!" "Das ist fein", sagte das Christkind, nahm den Wachsstock, zerschnitt ihn und drehte erst ein Stück um den Mitteltrieb des Bäumchens und die anderen Stücke um die Zweigenden, bog sie hübsch gerade und sagte dann; "Feuerzeug hast du doch?" "Gewiß", sagte der Alte, holte Stein, Stahl und Schwammdose heraus, pinkte Feuer aus dem Stein, ließ den Zunder in der Schwammdose zum Glimmen kommen und steckte daran ein paar Schwefelspäne an. Die gab er dem Christkindchen. Das nahm einen hellbrennenden Schwefelspan und steckte damit erst das oberste Licht an, dann das nächste davon rechts, dann das gegenüberliegende. Und rund um das Bäumchen gehend, brachte es so ein Licht nach dem andern zum Brennen.
Da stand nun das Bäumchen im Schnee; aus seinem halbverschneiten, dunklen Gezweig sahen die roten Backen der Äpfel, die Gold- und Silbernüsse blitzten und funkelten, und die gelben Wachskerzen brannten feierlich. Das Christkindchen lachte über das ganze rosige Gesicht und patschte in die Hände, der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so brummig aus, und der kleine Spitz sprang hin und her und bellte. Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkindchen mit seinen goldsilbernen Flügeln, und da gingen die Lichter aus. Es sagte dem Weihnachtsmann, er solle das Bäumchen vorsichtig absägen. Das tat der, und dann gingen beide den Berg hinab und nahmen das bunte Bäumchen mit.
Als sie in den Ort kamen, schlief schon alles. Beim kleinsten Hause machten die beiden halt. Das Christkindchen machte leise die Tür auf und trat ein; der Weihnachtsmann ging hinterher. In der Stube stand ein dreibeiniger Schemel mit einer durchlochten Platte. Den stellten sie auf den Tisch und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte dann noch allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel und Nüsse unter den Baum, und dann verließen beide das Haus so leise, wie sie es betreten hatten. Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am andern Morgen erwachte und den bunten Baum sah, da staunte er und wußte nicht, was er dazu sagen sollte. Als er aber an dem Türpfosten, den des Christkinds Flügel gestreift hatte, Gold- und Silberflimmer hängen sah, da wußte er Bescheid. Er steckte die Lichter an dem Bäumchen an und weckte Frau und Kinder. Das war eine Freude in dem kleinen Haus wie an keinem Weihnachtstag. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug, nach dem Kuchen und den Äpfeln, sie sahen nur alle nach dem Lichterbaum. Sie faßten sich an den Händen, tanzten um den Baum und sangen alle Weihnachtslieder, die sie wußten, und selbst das Kleinste, das noch auf dem Arm getragen wurde, krähte, was es krähen konnte.
Als es hellichter Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandten des Bergmanns, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den Wald, um sich für ihre Kinder auch ein Weihnachtsbäumchen zu holen. Die anderen Leute, die das sahen, machten es nach, jeder holte sich einen Tannenbaum und putzte ihn an, der eine so, der andere so, aber Lichter, Äpfel und Nüsse hängten sie alle daran. Als es dann Abend wurde, brannte im ganzen Dorf Haus bei Haus ein Weihnachtsbaum, überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der Kinder. Von da aus ist der Weihnachtsbaum über ganz Deutschland gewandert und von da über die ganze Erde. Weil aber der erste Weihnachtsbaum am Morgen brannte, so wird in manchen Gegenden den Kindern morgens beschert.
WARUM DIE TANNE CHRISTBAUM IST ... Märchen von R. Wiedmann

Aus Waldmärchen
Die Bäume im Walde haben sich immer viel zu erzählen. Wenn der Wind durch ihre Kronen streicht, dann rauscht es in ihren Zweigen, dann flüstern ihre Blätter und reden miteinander von allem, was sie erlebt haben. So war es auch an einem Abend im Spätsommer. Viele fremde Leute waren im Walde gewesen, aber nun waren sie wieder nach der Stadt gezogen und im Walde war es still geworden.
“Ach,” sagte da eine lange, schlanke Birke zu ihrer Nachbarin, einer struppigen Kiefer, “in der Stadt muß es doch schön sein! Da tragen die Leute so schöne Kleider und schmücken sich mit goldenen Ketten und bunten Perlen.” “Ja,” mischte sich die stolze Buche ins Gespräch, “in die Stadt möchte ich wohl auch einmal; da kann man sogar mit der Elektrischen fahren.” – “Woher wißt ihr denn das alles?” fragte neugierig der Ahorn. “Nun”, sagte die Eiche, “hast du denn geschlafen den ganzen Sommer? Hast du nie gehört, was sich die Leute aus der Stadt da erzählten, wenn sie unter unserem Blätterdach saßen?” Kurz und gut, die Bäume erzählten sich noch allerhand von der Stadt und alle wären zu gern einmal in die Stadt gekommen, am liebsten nach Berlin. Aber wie sollte das möglich sein?
Da geschah es eines Nachts, daß ein Engelein licht und weiß durch den Wald flog, um die Waldfee zu besuchen. Das war das Christkindlein. “Waldfee,” sagte es, “mich dauern die armen Menschen in der Stadt, die gar keine schönen Bäume haben. Ich möchte ihnen zum Christfest einen bringen, er muß aber der schönste Baum im ganzen Walde sein. Kannst du mir wohl einen geben?” – “Gern,” sagte die Waldfee, “aber ich weiß nicht recht, welchen. Jeder Baum ist schön und mir gleich lieb, ich möchte keinen dem anderen vorziehen.” – “So laß uns die Bäume selber fragen,” sagte das Christkindlein. “Wir wollen ihnen sagen, daß der schönste von ihnen in die Stadt soll, dann werden wir ja sehen, wen sie dafür halten.” So gingen sie zu den Bäumen und sagten es ihnen. Aber da wollte keiner es dem anderen gönnen. Da wurde das Christkindlein traurig und sagte: So muß ich wiederkommen und mir selbst den schönsten aussuchen. In wenigen Wochen reise ich zur Stadt, dann nehme ich ihn mir mit.” Und damit flog es von dannen.
Kaum war es fort, so fing unter den Bäumen ein großer Wettstreit an, sich so schön wie möglich zu schmücken. Der Ahorn zog ein leuchtend gelbes Kleid an, die Buche ein braunes, die Eiche ein rotes, andere flickten sich aus lauter bunten Stoffen ein Kleid zusammen, daß sie aussahen wie ein richtiger Tuschkasten, und das alles so fix und flink, daß, als Christkindchen wiederkam, der ganze Wald in bunten Farben glänzte. Nur ein Baum hatte sein einfaches grünes Kleid behalten, die Tanne. Wieder flog Christkindchen durch den Wald und sah sich alle Bäume an. “Ja,” sagte es, “eure Kleider sind schön aber ihr müßt eine weite Reise machen und sie müssen lange vorhalten. Ob sie das auch können?” “Natürlich!” schrien alle Bäume. Aber da kam ein großer Wirbelwind und zupfte die Bäume alle an ihren bunten Kleiderchen brrr, wie da der ganze bunter Flitterkram in tausend Fetzen ging, und all die gelben und roten und braunen Läppchen durcheinander tanzten, wie sie müde und matt zur Erde fielen!
Da standen die Bäume im Walde da mit zerfetzten und zerrissenen Kleiderchen, und ihre ganze Schönheit war dahin. Nur die Tanne, die nicht eitel genug gewesen war, ihr grünes Alltagskleid, das der liebe Gott ihr gemacht hatte, gegen bunten Flitterstaat zu vertauschen, stand noch im Schmuck ihrer grünen Nadeln unversehrt. Da sagte das Christkindlein: “Tanne, du bist der schönste Baum im Walde, dich will ich den Menschen bringen. Du sollst Christbaum sein!
VON KLEINEM FINCHEN UND DEM ZAUBERSTÖCKCHEN ...

Einst saß Fienchen traurig auf ihrem Bett,
sie dachte an Bratkartoffeln mit Spiegelei, fein geröstet in reichlich Fett.
Auch könnten es Nudeln sein,
lecker mit Soße, Tomaten oder Paprika,
aber ihr Schränkchen war leer, kein Krümel war zum knabbern da.
Sie sank in ihr Kissen, ihr knurrte der Magen,
dann schlief sie ein und träumte von besseren Tagen.
Am nächsten Morgen, beim ersten Hahnenschrei,
ihr Hunger war noch immer nicht vorbei,
glaubte sie nicht, was sie da sah,
in ihrem Bettchen lag ein Stöckchen,
sie dachte: "Nanu, der war doch gestern noch nicht da?"
Dann ganz flink und elegant, nahm sie das Stöckchen in die Hand.
"Nicht so grob, du böses Kind", rief das Stöckchen,
"leg mich wieder hin, schnell, schnell, rasch und geschwind!
Sei ganz zärtlich auch dabei, dann hast du bei mir zwei Wünsche frei!"
Schnell legte Fienchen behutsam und sanft den Stock zurück,
deckte ihn zu und sprach: "Du kommst zur rechten Zeit,
mir knurrt mein Magen, du bringst mir Glück.
Ich habe Hunger, möchte an Kuchen, Torten und an Pudding naschen,
aber mein Schränkchen ist leer, habe auch keine Taler in den Taschen.
Mein erster Wunsch, und bitte lass mich nicht so lange warten,
ist ein riesengroßer Kuchen, mit viel Sahne und Früchten,
am besten mit denen, aus des Nachbarn Garten.
Danach würde ich ein Eisbein, einen Schweinebraten
oder auch viel Entenbrust vertragen,
und was ich dann noch möchte, werde ich dir etwas später sagen".
Es surrte und knarrte, dann kam ein großer Zisch,
und Fienchen stand vor einem reich gedeckten Tisch.
Sie machte sich daran, von all den Leckerein zu essen,
und hat darüber hinaus die Zeit für ein ganzes Jahr vergessen.
Die guten Gaben im Schränkchen und auf dem Tisch, sie wollten nicht enden,
zuerst aß Fienchen brav mit Löffel, Messer und Gabel,
später dann nur noch mit ihren Händen.
Sie wurde immer schwerer, dicker und dann unbehände,
das Fett lief ihr am Mund herunter, fettig waren auch die kleinen Hände.
Doch zum Aufhören sah sie keinen Grund,
am Ende war sie hässlich, dick und rund.
Als das kleine Stöckchen dann aus seinem Schlaf erwachte,
sah es mit Schrecken, was das kleine Fienchen machte.
"Was fällt dir ein, du dummes Kind" rief es,
"schau in den Spiegel, schnell, schnell, geschwind.
Nur gegessen hast du, ohne zu denken, immer mit Wonne,
nun siehst du aus wie ein Fässchen, ach was sag ich, wie eine Tonne.
Wie kannst du nur so etwas machen,
die anderen Kinder werden dich verhöhnen und über dich lachen.
Sei gescheit, lass die Finger vom fetten Essen und vom süßen Punsch,
überleg dir mit Klugheit, den zweiten und deinen letzten Wunsch.
Als Fienchen in den Spiegel sah, musste sie sich eingestehen,
so dick und rund wollte sie nicht bleiben,
so konnte es nicht weitergehen.
Sie sprach zum Stöckchen, flink und keck:
"Oh bitte, ich wünsch mir meine angefutterten Pfunde weg.
Möchte wieder schlank sein, wie einst in früheren Tagen,
ich verzichte auf all die schönen Leckereien,
möchte lieber ab und zu mal wieder Hunger haben.
Fort mit den süßen Kuchen und fort mit der leckeren Soße,
mir passt kein Hemdchen mehr, kein Kleidchen und auch keine Hose.
Es surrte und knarrte, dann kam wieder ein großer Zisch,
es waren fort, die süßen Kuchen, die Braten mit Soßen,
leer waren wie einst, das Schränkchen und der Tisch.
Auch das kleine Fienchen war wieder rank und schlank,
zum Stöckchen sagte sie glücklich: "Hab vielen Dank.
Nie wieder werde ich nach soviel Naschwerk streben,
werde von nun an gesund, besonnen und vernünftig leben".
Das Stöckchen stimmte dem Fienchen zufrieden zu und sprach:
"Na dann, bis bald", und verschwand dorthin, wo es einmal hergekommen,
zurück in den tiefen Wald.
Ende
GiTo
DIE GABE DER WEISEN - O. HENRY ...

Ein Dollar und siebenundachtzig Cent. Das war alles. Und sechzig Cent davon bestanden aus Penny-Stücken. Pennies, die sie durch zähes Feilschen dem Krä- mer, dem Fleischer und dem Gemüsehändler nach und nach abgehandelt hatte bis es ihr die Schamröte ins Gesicht trieb, denn sie bemerkte sehr wohl, dass man ihr diese Pfennigfuchserei insgeheim als kleinlichen Geiz anlastete. Dreimal zählte Della nach. Ein Dollar und siebenundachtzig Cent. Und morgen war Weihnachten. Da blieb nun wirklich nichts anderes übrig, als sich auf das schäbige alte Sofa zu werfen und zu heulen. Was Della denn auch tat. Und was uns zu der hoch philosophischen Überlegung führt, dass das Leben aus Schluchzen, Seufzen und Lächeln besteht, wobei die Seufzer wohl in der Überzahl sind. Während die Dame des Hauses allmählich vom ersten der genannten Stadien in das zweite hinübergleitet, werfen wir einen Blick in ihr Heim.
Eine möblierte Wohnung für acht Dollar die Woche, die eigentlich mehr die Bezeichnung Asyl verdient, denn nur wenig unterscheidet sie von den unsäglichen Behausungen, die die Fürsorge Obdachlosen zur Verfügung stellt. Im Entree befand sich ein Briefkasten, in den nie ein Brief fiel, und ein Klingel- Knopf, dem keines Sterblichen Finger jemals einen Ton entlocken würde. Vervollständigt wird dieses Bild durch ein Schildchen mit der Aufschrift „Mr. James Dillingham Jr,“. Den Namen „Dillingham“ hatte man in besseren Zeiten dort unten angebracht, als vorübergehender Wohlstand seinem Besitzer dreißig Dollar pro Woche einbrachte. Jetzt war sein Einkommen auf zwanzig Dollar geschrumpft und die Buchstaben auf dem Namens-Schildchen waren von Wind und Wetter so ausgebleicht, dass sie aussahen, als würden sie ernsthaft darüber nachdenken, ob sie sich nicht besser zu einem bescheidenen und ganz anspruchslosen „D“ zusammenziehen sollten. Jedes Mal aber, wenn Mr. James Dillingham Jr. nach Hause kam und seine Wohnung betrat, wurde er von Mrs. James Dillingham Jr. - die wir Ihnen bereits als „Della“ vorgestellt haben, stürmisch umarmt und begeistert als „Jim“ begrüßt. Was eigentlich alles sehr erfreulich ist.
Della hörte zu weinen auf und retuschierte die Tränen Spuren in ihrem Gesicht mit der Puderquaste. Sie stand am Fenster und sah betrübt einer grauen Katze zu, die in einem grauen Hinterhof, einen grauen Zaun, entlang schlich. Morgen war Weihnachten, und sie hatte nur einen Dollar und siebenundachtzig Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Seit Monaten hatte sie nach Kräften jeden Penny gespart - und das war alles, was dabei herausgekommen war. Mit zwanzig Dollar in der Woche kommt man nicht sehr weit. Sie hatte mehr Ausgaben gehabt als geplant. Das ist ja immer so. Nur ein Dollar und siebenundachtzig Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Ihrem Jim. Viele glückliche Stunden hatte sie damit verbracht, sich etwas Hübsches für ihn auszudenken. Etwas wirklich Feines, Seltenes, Kostbares, etwas, das, wenn auch halbwegs, der Ehre würdig sei, ihrem Jim zu gehören. Zwischen den Fenstern des Zimmers hing ein schmaler, langer Pfeiler-Spiegel. Vielleicht haben Sie eine solche Art von Spiegel in einer Acht-Dollar-Wohnung gesehen. Nur eine sehr schlanke und bewegliche Person kann, so sie ihr Spiegelbild in einer raschen Folge von Längsstreifen zu betrachten in der Lage ist, ein einigermaßen zuverlässiges Bild ihrer äußeren Erscheinung gewinnen. Da Della schlank war, beherrschte sie diese Kunst. Plötzlich wirbelte sie herum und stellte sich vor den Spiegel. Ihre Augen blitzten aufgeregt, doch ihr Gesicht hatte in weniger als zwanzig Sekunden alle Farbe verloren. Rasch löste sie ihr Haar und ließ es in seiner vollen Länge herabfallen.
Nun gab es zwei Dinge im Besitz von Mr. und Mrs. James Dillingham Jr., auf die sie beide mächtig stolz waren. Eines davon war Jims goldene Uhr, die zuvor schon seinem Vater und seinem Großvater gehört hatte. Das andere war Dellas Haar. Hätte in der Wohnung jenseits des Lichtschachts die Königin von Saba gewohnt, so hätte Della vielleicht eines Tages ihr Haar zum Trocknen aus dem Fenster gehängt, und alle Juwelen und sonstige Schätze Ihrer Majestät wären zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Und wären König Salomo Portier im Haus der Dillinghams gewesen und hätte all seine Reichtümer im Keller gestapelt, so hätte Jim jedes Mal im Vorbeigehen seine Uhr gezückt, und der König hätte sich vor Neid den Bart gerauft. So fiel nun Dellas schönes Haar wie brauner Wasserfall glänzend und sanft sich kräuselnd an ihr herab. Es reichte ihr bis unter die Knie und umhüllte sie fast wie ein Gewand. In nervöser Hast steckte sie es wieder auf. Einen Augenblick lang schwankte sie noch in ihrem Entschluss, während eine Träne oder möglicherweise auch zwei auf den abgetretenen roten Teppich tropften. Schnell zog sie ihre alte braune Jacke an, schnell setzte sie ihren alten braunen Hut auf. Mit wehenden Röcken und immer noch diesem Leuchten in den Augen huschte sie aufgeregt durch die Tür, die Treppe hinunter, auf die Straße. Sie blieb erst stehen, als sie ein Schild erreicht hatte, auf dem zu lesen war: „Mme. Sofronie, Haarteile aller Art“. Della rannte die Treppe hinauf und rang, oben angekommen, nach Luft und Fassung.
Die Gnädige Frau war wohl genährt, bleichgesichtig und eiskalt. Sie sah kaum so aus, als könne sie „Sofronie“ heißen. „Wollen Sie meine Haare kaufen?“, fragte Della. „Ich kaufe Haar“, antwortete Madame. „Dann nehmen Sie mal ihren Hut ab und lassen Sie sehen.“ Herunter strömte der braune Wasserfall. „Zwanzig Dollar“ bot Madame und griff mit geübten Händen in die Haarflut.“ „Schnell, geben Sie mir das Geld“. Die nächsten zwei Stunden eilten dahin wie auf rosigen Flügeln - das ist ein stilistisch nicht gerade brillanter Vergleich, vergessen Sie ihn also lieber. Della stürmte durch die Läden auf der Suche nach Jims Geschenk. Sie fand es schließlich. Es war nur für Jim gemacht und für niemand anders, das stand fest. In keinem der anderen Geschäfte hatte sie auch nur eines gefunden, das diesem hier auch nur annähernd gleichkam. Und sie hatte sie wirklich alle auf den Kopf gestellt. Es war eine schlichte, edle und in der Form vollendete Uhrkette aus Platin, deren Wert sich allein in ihrem Material offenbarte und nicht in auffälligen Verzierungen. Sie war gerade so, wie alle wirklich guten Dinge sein sollten. Sie war sogar der Uhr aller Uhren würdig. Kaum dass Della sie gesehen hatte, wusste sie, dass sie Jim gehören musste. Sie war wie er, dezent, vornehm und wertvoll - diese Begriffe treffen es wohl ziemlich genau. Einundzwanzig Dollar nahm man ihr ab, und sie eilte mit den siebenundachtzig Cent nach Hause. Mit dieser Kette an seiner Uhr konnte Jim in jeder Gesellschaft stilvoll nach der Zeit sehen. Denn wenn die Uhr auch ein Prachtstück war, so schaute er sie oft nur verstohlen an, denn sie war an einem Lederriemen statt an einer Uhrkette festgemacht.
Als Della zu Hause ankam, dämpften Vernunft und ruhige Überlegung ein wenig ihren Taumel, Sie holte ihre Brennschere hervor, zündete das Gas an und machte sich daran, die verheerenden Folgen zu beheben, die ihre Großzügigkeit im Verein mit ihrer Liebe zu Jim bewirkt hatten. Und das, liebe Freunde, ist stets eine ungeheure Aufgabe, ein wahres Mammutprogramm. Vierzig Minuten später war ihr Kopf mit winzigen, eng anliegenden Löckchen bedeckt, mit denen sie aussah wie ein bezaubernder Lausbub, der gerade die Schule schwänzt. Sie besah sich lange, sorgfältig und kritisch im Spiegel. „Wenn Jim mich nicht umbringt“, sagte sie sich, „wird er behaupten, dass ich wie ein Revuegirl von Coney Island aussehe, wenn er mich überhaupt noch eines zweiten Blickes würdigt. Aber was bitte, hätte ich tun können? Was hätte ich mit einem Dollar und siebenundachtzig Cent anfangen sollen?“ Um sieben Uhr war der Kaffee fertig und auf dem Ofen stand die Pfanne bereit, in denen die Koteletts gebraten werden sollten.
Jim kam nie zu spät. Della rollte die Uhrkette in ihrer Hand zusammen und setzte sich auf die Tischkante gegenüber von der Tür, durch die er immer hereinkam. Als sie seine Schritte unten im Stock hörte, wurde sie einen Augenblick lang ganz weiß. Sie hatte die Angewohnheit, kleine Stoßgebete gen Himmel zu richten, auch wenn es nur um Alltagsdinge ging. So flüsterte sie auch jetzt: „Bitte, lieber Gott, mach, dass er mich immer noch hübsch findet.“ Die Tür ging auf, Jim trat ein und machte sie hinter sich zu. Er sah schmal und sehr ernst aus. Armer Kerl! Er war erst zweiundzwanzig - und schon hatte er eine Familie zu versorgen. Er brauchte dringend einen neuen Mantel, und Hand- schuhe hatte er auch keine. Jim blieb an der Tür stehen, bewegungslos wie ein Jagdhund, der eine Wachtel wittert. Er fixierte Delta, und in seinen Augen war etwas, das sie nicht zu deuten vermochte, das sie aber erschreckte. Es war weder Zorn noch Überraschung, weder Missbilligung noch Entsetzen, und es war auch keines der Gefühle, auf die sie gefasst war. Er starrte sie mit diesem selt- samen Ausdruck im Gesicht ganz einfach nur an. Della rutschte vom Tisch herunter und lief auf ihn zu. „Bitte, lieber Jim, sieh mich nicht so an. Ich habe mein Haar abgeschnitten und verkauft, weil ich den Gedanken nicht ertragen konnte, kein Weihnachtsgeschenk für dich zu haben. Es wachst bald wieder nach, du bist mir doch deswegen nicht böse, oder? Ich musste es einfach tun. Mein Haar wächst furchtbar schnell. Wünschen wir uns „Fröhliche Weihnachten“, Jim, und lass uns ganz einfach glücklich sein! Du weißt ja gar nicht, was für ein schönes, ja, was für ein wunder - wunderschönes Geschenk ich für dich habe.“ „Du hast dein Haar abgeschnitten?“, stieß Jim schließlich mühsam hervor, so als sei ihm die Tatsache auch nach größter gedanklicher Anstrengung noch nicht zu Bewusstsein gelangt und als wolle er sie erst nach reiflicher Überlegung anerkennen. „Abgeschnitten und verkauft“, antwortete Della. „Magst du mich nicht trotzdem genauso gern? Ich bin auch ohne Haar immer noch dieselbe, oder?“ Jim sah sich forschend im Zimmer um. „Du sagst, dein Haar sei fort?“ fragte er, was ein wenig einfältig klang. „Du brauchst gar nicht danach zu suchen“, erwiderte Della. „Ich sage dir ja, ich habe es verkauft. Es ist weg. Und weg ist weg. Aber heute ist Heiliger Abend. Komm, sei ein wenig lieb zu mir, ich hab’s doch für dich getan. Es mag ja sein, dass die Haare auf meinem Kopf gezählt waren“ fuhr sie mit hinreißender, plötzlicher Ernsthaftigkeit fort, „aber niemand könnte jemals meine Liebe zu dir zählen. Soll ich jetzt die Koteletts braten, Jim?“ Jetzt endlich, schien Jim aus seiner Benommenheit zu erwachen. Er schloss Della in die Arme. Wir wollen daher zehn Sekunden lang in diskreter, taktvoller Weise irgendeinen belanglosen Gegenstand am entgegengesetzten Ende des Raumes betrachten.
Acht Dollar die Woche oder eine Million im Jahr – wo ist da der Unterschied? Ein Mathematiker oder ein anderer kluger Kopf würde uns eine falsche Antwort geben. Die drei Weisen aus dem Morgenland brachten kostbare Geschenke, aber jene Gabe war nicht dabei. Sie werden es bald verstehen, was mit dieser dunklen Andeutung gemeint ist. Jim zog ein Päckchen aus seiner Manteltasche und warf es auf den Tisch. „Täusche dich nicht in mir, Della“, sagte er. „Ich glaube kaum, dass ein Haarschnitt oder eine Kopfwäsche oder irgendetwas in dieser Richtung mich dazu bringen können, mein Mädchen weniger zu lieben. Aber wenn du dieses Paket aufmachst, wirst du sehen, warum ich vorhin Probleme hatte, die Fassung zu bewahren.“ Zitternde weiße Finger zogen an Schnur und Papier. Dann ein entzückter Freudenschrei, dem in echt weiblicher Manier übergangslos Tränen und Wehklagen folgten. Diese wiederum stellten den Herrn des Hauses augenblicklich vor die Notwendigkeit, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften Trost zu spenden. Denn dort lagen die schönsten aller Kämme, eine ganze Garnitur davon, seitlich und hinten einzustecken. Della hatte sie schon seit langem in einem Schaufenster am Broadway bewundert. Es waren herrliche, mit Edelsteinen und Perlen verzierte Käme aus echtem Schildpatt, die von genau der Farbe waren, die zu ihrem verschwundenem Haar gepasst hätte. Es waren teure Kämme, das wusste sie, und ihr Herz hatte sie voller Sehnsucht begehrt, doch hatte sie nie auch nur im Entferntesten zu hoffen gewagt, sie jemals zu besitzen. Jetzt gehörten sie ihr, nur waren die Flechten nicht mehr da, die der ersehnte Schmuck zieren sollte. Doch Sie drückte ihn ans Herz, und schließlich konnte sie auch mit verweinten Augen und einem Lächeln aufblicken und versichern: „Meine Haare wachsen ja so schnell, Jim!“ Da plötzlich sprang sie auf wie ein Kätzchen, das sich das Fell versengt hat und rief: „Oh, oh!“ Jim hatte ja sein wunderschönes Geschenk noch nicht gesehen. Sie hielt es ihm eifrig auf der geöffneten Hand entgegen. Das kostbare, matt glänzende Metall schien plötzlich aufzuleuchten und ihr helles kristallklares Wesen widerzuspiegeln. „Ist sie nicht prächtig? Ich habe die ganze Stadt nach ihr gesucht, bis ich sie endlich gefunden habe. Jetzt kannst du getrost hundertmal am Tag nach der Zeit sehen. Gib mir deine Uhr. Ich will doch mal sehen, wie sie dazu aussieht.“ Aber Jim tat nicht, was sie sagte. Stattdessen ließ er sich auf das alte Sofa fallen, faltete die Hände hinterm Kopf und lächelte. „Della“, sagte er, „lass uns unsere Weihnachtsgeschenke wegpacken und eine Weile aufheben. Sie sind zu schön, als dass wir sie gleich jetzt benutzen sollten. Ich habe die Uhr verkauft, um das Geld für deine Kämme zu bekommen. Und jetzt, denke ich, wäre es an der Zeit, die Koteletts aufs Feuer zu stellen.“
„Die drei Könige waren, wie ihr wisst, weise Männer - wunderbar weise Männer -, die dem Kind in der Krippe Geschenke brachten. Sie haben die Kunst erfunden, Weihnachtsgeschenke zu machen. Da sie weise waren, waren natürlich auch ihre Geschenke weise und hatten vielleicht den Vorzug, umgetauscht werden zu können, falls es Dubletten gab.
Und hier habe ich euch nun schlecht und recht die ereignislose Geschichte von zwei törichten Kindern in einer möblierten Wohnung erzählt, die höchst unweise die größten Schätze ihres Hauses für einander opferten. Doch mit einem letzten Wort sei den heutigen Weisen gesagt, dass diese beiden die weisesten aller Schenkenden waren. Von allen, die Geschenke geben und empfangen, sind sie die weisesten. Überall sind sie die weisesten. Sie sind die wahren Weisen.“
RUDOLPH, DAS RENTIER MIT DER ROTEN NASE ...

Hoch oben im Norden, wo die Nächte dunkler und länger und der Schnee viel weißer ist als in unseren Breitengraden, sind die Rentiere beheimatet. In jedem Jahr geht der Weihnachtsmann dort auf die Suche nach den stärksten und schnellsten Tieren, um seinen gewaltigen Schlitten durch die Luft zu befördern. In dieser Gegend lebte eine Rentierfamilie mit ihren fünf Kindern.. Das Jüngste hörte auf den Namen Rudolph und war ein besonders lebhaftes und neugieriges Kind, das seine Nase in allerlei Dinge steckte. Tja, und diese Nase hatte es wirklich in sich. Immer, wenn das kleine Rentier-Herz vor Aufregung ein bisschen schneller klopfte, leuchtete sie so rot wie die glühende Sonne kurz vor dem Untergang. Egal, ob er sich freute oder zornig war, Rudolphs Nase glühte in voller Pracht. Seine Eltern und Geschwister hatten ihren Spaß an der roten Nase, aber schon im Rentierkindergarten wurde sie zum Gespött der vierbeinigen Racker. "Das ist der Rudolph mit der roten Nase", riefen sie und tanzten um ihn herum, während sie mit ihren kleinen Hufen auf ihn zeigten. Und dann erst in der Rentierschule! Die Rentier-Kinder hänselten ihn wo sie nur konnten. Mit allen Mitteln versuchte Rudolph seine Nase zu verbergen, indem er sie mit schwarzer Farbe übermalte. Spielte er mit den anderen verstecken, freute er sich, dass er diesmal nicht entdeckt worden war. Und im gleichen Moment begann seine Nase so zu glühen, dass die Farbe abblätterte. Ein anderes Mal stülpte er sich eine schwarze Gummikappe darüber. Nicht nur, dass er durch den Mund atmen musste. Als er auch noch zu sprechen begann, klang es als säße eine Wäscheklammer auf seiner Nase. Seine Mitschüler hielten sich die Rentier-Bäuche vor Lachen, aber Rudolph lief nach Hause und weinte bitterlich. "Nie wieder werde ich mit diesen Blödhufenspielen", rief er unter Tränen, und die Worte seiner Eltern und Geschwister konnten ihn dabei nur wenig trösten.
Die Tage wurden kürzer und wie in jedem Jahr kündigte sich der Besuch des Weihnachtsmannes an. In allen Rentier-Haushalten wurden die jungen und kräftigen Burschen herausgeputzt. Ihre Felle wurden so lange gestriegelt und gebürstet bis sie kupfernfarben schimmerten, die Geweihe mit Schnee geputzt bis sie im fahlen Licht des nordischen Winters glänzten. Und dann war es endlich soweit. Auf einem riesigen Platz standen Dutzende von Rentieren, die ungeduldig und nervös mit den Hufen scharrten und schaurig-schöne Rufe ausstießen, um die Mitbewerber zu beeindrucken. Unter ihnen war auch Rudolph, an Größe und Kraft den anderen Bewerbern zumeist deutlich überlegen. Pünktlich zur festgelegten Zeit landete der Weihnachtsmann aus dem nahegelegenen Weihnachtsdorf, seiner Heimat, mit seinem Schlitten, der diesmal nur von Donner, dem getreuen Leittier gezogen wurde. Leichter Schnee hatte eingesetzt und der wallende rote Mantel war mit weißen Tupfern übersät. Santa Claus machte sich sofort an die Arbeit, indem er jedes Tier in Augenschein nahm. Immer wieder brummelte er einige Worte in seinen langen weißen Bart. Rudolph kam es wie eine Ewigkeit vor. Als die Reihe endlich bei ihm angelangt war, glühte seine Nase vor Aufregung fast so hell wie die Sonne. Santa Claus trat auf ihn zu, lächelte freundlich und - schüttelte den Kopf. "Du bist groß und kräftig. Und ein hübscher Bursche dazu ", sprach er, "aber leider kann ich dich nicht gebrauchen. Die Kinder würden erschrecken, wenn sie dich sähen." Rudolphs Trauer kannte keine Grenzen. So schnell er konnte, lief er hinaus in den Wald und stampfte brüllend und weinend durch den tiefen Schnee.
Die Geräusche und das weithin sichtbare rote Licht lockten eine Elfe an. Vorsichtig näherte sie sich, legte ihre Hand auf seine Schulter und fragte : "Was ist mit dir?" "Schau nur, wie meine Nase leuchtet. Keiner braucht ein Rentier mit einer roten Nase!" antwortete Rudolph. "Das kenne ich", sprach die Elfe, "ich würde gerne im Weihnachtsdorf mit den anderen Elfen arbeiten. Aber immer, wenn ich aufgeregt bin, beginnen meine Ohren zu wackeln. Und wackelnde Ohren mag Santa Claus nicht." Rudolph blickte auf, wischte sich mit den Hufen die Tränen aus den Augen und sah eine bildhübsche Elfe, deren Ohren im Rhythmus eines Vogelschlags hin und her wackelten. "Mein Name ist Herbie", sagte sie schüchtern. Und während sie sich so in die Augen sahen, der eine mit einer leuchtend roten Nase, die andere mit rhythmisch wackelnden Ohren, prusteten sie urplötzlich los und lachten bis ihnen die Bäuche weh taten. An diesem Tag schlossen sie Freundschaft schwatzten bis in die Nacht und kehrten erst am frühen Morgen heim.
Mit Riesenschritten ging die Zeit auf Weihnachten zu. Herbie und Rudolph trafen sich in dieser Zeit viele Male im Wald. Alle waren mit den Vorbereitungen für das Weihnachtsfest so beschäftigt, dass sie nicht bemerkten, wie sich das Wetter von Tag zu Tag verschlechterte. Am Vorabend des Weihnachtstages übergab die Wetterfee Santa Claus den Wetterbericht. Mit sorgenvoller Miene blickte er zum Himmel und seufzte resigniert : "Wenn ich morgen anspanne, kann ich vom Kutschbock aus noch nicht einmal die Rentiere sehen. Wie soll ich da den Weg zu den Kindern finden?" In dieser Nacht fand Santa Claus keinen Schlaf. Immer wieder grübelte er über einen Ausweg nach. Schließlich zog er Mantel, Stiefel und Mütze an, spannte Donner vor seinen Schlitten und machte sich auf den Weg zur Erde. "Vielleicht finde ich dort eine Lösung", dachte er.
Während seines Fluges begann es in dichten Flocken zu schneien. So dicht, dass Santa Claus kaum etwas sehen konnte. Lediglich ein rotes Licht unter ihm leuchtete so hell, dass ihm der Schnee wie eine riesige Menge Erdbeereis vorkam. Santa Claus liebte Erdbeereis. "Hallo", rief er, "was hast du für eine hübsche und wundervolle Nase! Du bist genau der, den ich brauche. Was hältst du davon, wenn du am Weihnachtstag vor meinem Schlitten herläufst und mir so den Weg zu den Kindern zeigst?" Als Rudolph die Worte des Weihnachtsmannes hörte, fiel ihm vor Schreck der Tannenbaum zu Boden und seine Nase glühte so heftig wie noch nie in seinem Leben. Vor lauter Freude fehlten ihm die Worte. Erst langsam fand er seine Fassung wieder. "Natürlich furchtbar gerne. Ich freu' mich riesig." Doch plötzlich wurde er sehr traurig. "Aber wie finde ich den Weg zurück zum Weihnachtsdorf, wenn es so dicht schneit?" Im gleichen Moment, in dem er die Worte aussprach, kam ihm eine Idee. "Bin gleich wieder da", rief er, während er schon in schnellem Galopp auf dem Weg in den Wald war und einen verdutzten Santa Claus zurückließ. Wenige Minuten später kehrten ein Rentier mit einer glühenden Nase und eine Elfe mit wackelnden Ohren aus dem Wald zurück. "Sie wird uns führen, Santa Claus", sagte Rudolph voller Stolz und zeigte auf Herbie. "Mit ihren Ohren hält sie uns den Schnee vom Leibe. Und sie kennt den Weg." "Das ist eine prachtvolle Idee", dröhnte Santa Claus. "Aber jetzt muss ich zurück. Auf morgen dann."
Und so geschah es, dass Santa Claus am Weihnachtstag von einem Rentier mit einer roten Nase und einer Elfe mit wackelnden Ohren begleitet wurde. Rudolph wurde für seine treuen Dienste am nächsten Tag von allen Rentieren begeistert gefeiert. Den ganzen Tag tanzten sie auf dem großen Marktplatz und sangen dazu : "Rudolph mit der roten Nase, du wirst in die Geschichte eingehen." Und es muss jemanden gegeben haben, der Santa Claus und seine beiden Helfer beobachtet hat. Sonst gäbe es sie heute nicht, die Geschichte von Rudolph mit der roten Nase.
von Monika Schüssler
DER CHRISTBAUMSTÄNDER ...
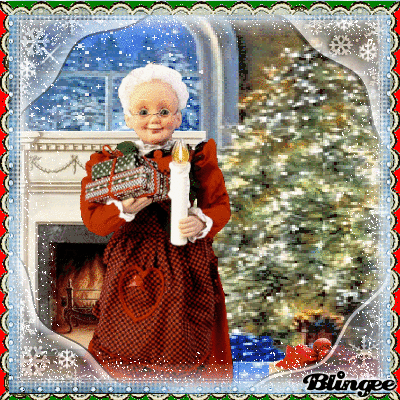
Beim Aufräumen des Dachbodens - ein paar Wochen vor Weihnachten -entdeckte ein Familienvater in einer Ecke einen ganz verstaubten, uralten Weihnachtsbaumständer. Es war ein besonderer Ständer mit einem Drehmechanismus und einer eingebauten Spielwalze. Beim vorsichtigen Drehen konnte man das Lied "O du fröhliche" erkennen. Das musste der Christbaumständer sein, von dem Großmutter immer erzählte, wenn die Weihnachtszeit herankam. Das Ding sah zwar fürchterlich aus, doch da kam ihm ein wunderbarer Gedanke. Wie würde sich Großmutter freuen, wenn sie am Heiligabend vor dem Baum säße und dieser sich auf einmal wie in uralter Zeit zu drehen begänne und dazu "O du fröhliche" spielte. Nicht nur Großmutter, die ganze Familie würde staunen. Es gelang ihm, mit dem antiken Stück ungesehen in seinen Bastelraum zu verschwinden. Gut gereinigt, eine neue Feder, dann müsste der Mechanismus wieder funktionieren, überlegte er. Abends zog er sich jetzt geheimnisvoll in seinen Hobbyraum zurück, verriegelte die Tür und werkelte. Auf neugierige Fragen antwortete er immer nur "Weihnachtsüberraschung".
Kurz vor Weihnachten hatte er es geschafft. Wie neu sah der Ständer aus, nachdem er auch noch einen Anstrich erhalten hatte. Jetzt aber gleich los und einen prächtigen Christbaum besorgen, dachte er. Mindestens zwei Meter sollte der messen. Mit einem wirklich schön gewachsenen Exemplar verschwand Vater dann in seinem Hobbyraum, wo er auch gleich einen Probelauf startete. Es funktionierte alles bestens. Würde Großmutter Augen machen! Endlich war Heiligabend. "Den Baum schmücke ich alleine", tönte Vater. So aufgeregt war er lange nicht mehr. Echte Kerzen hatte er besorgt, alles sollte stimmen. "Die werden Augen machen", sagte er bei jeder Kugel, die er in den Baum hing. Vater hatte wirklich an alles gedacht. Der Stern von Bethlehem saß oben auf der Spitze, bunte Kugeln, Naschwerk und Wunderkerzen waren untergebracht, Engelhaar und Lametta dekorativ aufgehängt.
Die Feier konnte beginnen. Vater schleppte für Großmutter den großen Ohrensessel herbei. Feierlich wurde sie geholt und zu ihrem Ehrenplatz geleitet. Die Stühle hatte er in einem Halbkreis um den Tannenbaum gruppiert. Die Eltern setzten sich rechts und links von Großmutter, die Kinder nahmen außen Platz. Jetzt kam Vaters großer Auftritt. Bedächtig zündete er Kerze für Kerze an, dann noch die Wunderkerzen. "Und jetzt kommt die große Überraschung", verkündete er, löste die Sperre am Ständer und nahm ganz schnell seinen Platz ein. Langsam drehte sich der Weihnachtsbaum, hell spielte die Musikwalze "O du fröhliche". War das eine Freude! Die Kinder klatschten vergnügt in die Hände. Oma hatte Tränen der Rührung in den Augen. Immer wieder sagte sie: "Wenn Großvater das noch erleben könnte, dass ich das noch erleben darf." Mutter war stumm vor Staunen.
Eine ganze Weile schaute die Familie beglückt und stumm auf den sich im Festgewand drehenden Weihnachtsbaum, als ein schnarendes Geräusch sie jäh aus ihrer Versunkenheit riss. Ein Zittern durchlief den Baum, die bunten Kugeln klirrten wie Glöckchen. Der Baum fing an, sich wie verrückt zu drehen. Die Musikwalze hämmerte los. Es hörte sich an, als wollte "O du fröhliche" sich selbst überholen. Mutter rief mit überschnappender Stimme: "So tu doch etwas!" Vater saß wie versteinert, was den Baum nicht davon abhielt, seine Geschwindigkeit zu steigern. Er drehte sich so rasant, dass die Flammen hinter ihren Kerzen herwehten. Großmutter bekreuzigte sich und betete. Dann murmelte sie: "Wenn das Großvater noch erlebt hätte."
Als Erstes löste sich der Stern von Bethlehem, sauste wie ein Komet durch das Zimmer, klatschte gegen den Türrahmen und fiel dann auf Felix, den Dackel, der dort ein Nickerchen hielt. Der arme Hund flitzte wie von der Tarantel gestochen aus dem Zimmer in die Küche, wo man von ihm nur noch die Nase und ein Auge um die Ecke schielen sah. Lametta und Engelhaar hatten sich erhoben und schwebten wie ein Kettenkarussell am Weihnachtsbaum. Vater gab das Kommando "Alles in Deckung!" Ein Rauschgoldengel trudelte losgelöst durchs Zimmer, nicht wissend, was er mit seiner plötzlichen Freiheit anfangen sollte. Weihnachtskugeln, gefüllter Schokoladenschmuck und andere Anhängsel sausten wie Geschosse durch das Zimmer und platzten beim Aufschlagen auseinander. Die Kinder hatten hinter Großmutters Sessel Schutz gefunden. Vater und Mutter lagen flach auf dem Bauch, den Kopf mit den Armen schützend. Mutter jammerte in den Teppich hinein: "Alles umsonst, die viele Arbeit, alles umsonst!" Vater war das alles sehr peinlich.
Oma saß immer noch auf ihrem Logenplatz, wie erstarrt, von oben bis unten mit Engelhaar und Lametta geschmückt. Ihr kam Großvater in den Sinn, als dieser 14-18 in den Ardennen in feindlichem Artilleriefeuer gelegen hatte. Genau so musste es gewesen sein. Als gefüllter Schokoladenbaumschmuck an ihrem Kopf explodierte, registrierte sie trocken "Kirschwasser" und murmelte: "Wenn Großvater das noch erlebt hätte!" Zu allem jaulte die Musikwalze im Schlupfakkord "O du fröhliche", bis mit einem ächzenden Ton der Ständer seinen Geist aufgab. Durch den plötzlichen Stopp neigte sich der Christbaum in Zeitlupe, fiel aufs kalte Buffet, die letzten Nadeln von sich gebend. Totenstille! Großmutter, geschmückt wie nach einer New Yorker Konfettiparade, erhob sich schweigend. Kopfschüttelnd begab sie sich, eine Lamettagirlande wie eine Schleppe tragend, auf ihr Zimmer. In der Tür stehend sagte sie: "Wie gut, dass Großvater das nicht erlebt hat!" Mutter, völlig aufgelöst zu Vater: "Wenn ich mir diese Bescherung ansehe, dann ist deine große Überraschung wirklich gelungen." Andreas meinte: "Du, Papi, das war echt stark! Machen wir das jetzt Weihnachten immer so?"
Verfasser unbekannt
EINE KLEINE WEIHNACHTSGESCHICHTE ...

Wie in jedem Jahr am 1. Dezember kam auch in diesem Jahr der Weihnachtsengel zu Gott, um mit ihm über die bevorstehende Weihnachtszeit zu reden. Doch diesmal war irgend etwas anders. Gott machte so ein finsteres Gesicht, wo er doch sonst die Freundlichkeit in Person war. Der Weihnachtsengel ging also hin und fragte was los ist. Gott lief hin und her. Dann sagte er " Ich weiß gar nicht, wie ich es dir beibringen soll, du wirst in diesem Jahr nicht auf der Erde die Weihnachtsvorbereitungen leiten. Du wirst hier bleiben und die himmlische Weihnacht zusammen mit den anderen Engeln vorbereiten. Der Weihnachtsengel wurde sehr traurig und wollte wissen warum. Da sagte Gott zu ihm "Die Menschen haben den Glauben, die Nächstenliebe und die Hilfsbereitschaft verloren und nach der Weihnachtsbotschaft braucht man erst gar nicht zu fragen." Der Weihnachtsengel entgegnete darauf: "Aber doch nicht alle Menschen. Lass mich wenigstens zu denen gehen, die noch daran glauben". Gott aber hatte schon was anderes beschlossen: "Es sind schon über 75%, die nur noch an ihr eigenes Wohl denken. Ich muss jetzt den Menschen eine Lektion erteilen." "Wie willst du das denn machen?" fragte der Weihnachtsengel. "Nun, ich werde sie einfach so weiter machen lassen, aber ohne deine Unterstützung in der Weihnachtszeit" antwortete Gott. "Was soll das denn bringen?" wollte da der Weihnachtsengel wissen. "Das wirst du bald sehen" erwiderte Gott darauf.
Und Gott hatte Recht! Bald darauf wurde es immer kälter in den Herzen der Menschen. Niemand war mehr da, der dem Herz mal einen Ruck gab, um einem anderen Menschen zu helfen. Alle dachten nur noch an sich selbst. Nachts konnte man sich nicht mehr auf die Straße trauen. Obdachlose haben sich zusammengerottet, um Leute zu überfallen, weil keiner mehr etwas Spendete und zu Essen hatten sie auch nichts.
Beim Weihnachtsengel, der im Himmel geblieben war, wollte keine rechte Weihnachtsstimmung aufkommen. Er grübelteständig über die Situation auf der Erde nach und er wusste, dass er etwas unternehmen musste. Es waren doch noch die anderen Menschen da, die an das Gute im Menschen glaubten. Der Weihnachtsengel beschloss sich heimlich, zu ihnen auf die Erde, zu begeben. Er machte sich sofort auf den Weg. Im Himmel war er sowieso zu nichts nütze wenn er missmutig war. Doch als er auf der Erde ankam musste er feststellen, dass auch die letzten aufrechten Menschen ihre Gesinnung geändert haben. Das traf ihn hart. Was Gott da vorhatte, dachte er, kann Jahrzehnte dauern ehe die Menschen mal zur Besinnung kommen und sich daran erinnern, wie schön doch das Gefühl war, jemandem geholfen zu haben. Er hatte schon jegliche Hoffnung aufgegeben und wollte mit hängenden Flügeln gen Himmel ziehen. Da erinnerte er sich an eine Familie, die weit draußen im Wald wohnte und vielleicht von der ganzen Herzenskälte nicht angesteckt worden war.
Es keimte in ihm ein Fünkchen Hoffnung auf und er machte sich auf den Weg zum Wald. Unterwegs musste er über Wiesen, Felder und Wälder fliegen. Auf einer Lichtung traf er Mutter Natur. Sie wirkte sehr beschäftigt. Dem Weihnachtsengel kam eine Idee. ´Ich werde Mutter Natur um Rat fragen,` dachte er, ´die weiß immer einen Ausweg.` Also flog er runter und schilderte ihr die Situation. Daraufhin sagte Mutter Natur " Ich werde mir etwas einfallen lassen, wenn ich hier fertig bin. Die Natur leidet ebenfalls unter der Hartherzigkeit der Menschen. Zuerst muss ich aber ein Tauwetter machen, denn sonst kommen die Tiere nicht mehr an das Futter ran und müssen verhungern, weil die Menschen ihnen nichts mehr bringen . Aber es darf nicht zu warm werden, weil sonst die Winterschläfer aufwachen". "Na gut", sagte der Weihnachtsengel, "ich werde erst die Einsiedler besuchen." Und er flog über den Wald. Als er zum Haus der Einsiedlerfamilie kam und durch das Fenster blickte, sah er, dass der Vater sich gerade um ein krankes Reh kümmerte. Er freute sich darüber so sehr, das er am liebsten in der Luft ein paar Loopings geflogen wäre. Nun wusste er: Hier ist alles in bester Ordnung!! Das gibt Hoffnung und Mutter Natur weiß bestimmt, was zu tun ist.
Kaum hatte er das gedacht, da tippte sie ihm schon von hinten an die Flügel. "Mir ist da was
in den Sinn gekommen," sagte sie "aber für die Menschen wird es sehr hart werden. Dafür werden sie hinterher wieder die Nächstenliebe in Person sein und einander helfen wo es nur geht." "Na dann erzähl mal!" sagte der Weihnachtsengel und Mutter Natur erzählte ihm von einem Plan. Sie wolle große Unwetter, Hochwasser und Stürme über die Menschen schicken. "Nur wenn die Menschen ihr gesamtes Hab und Gut verlieren und ihnen nur noch das nackte Leben bleibt, werden sie zur Besinnung kommen und sich gegenseitig helfen. Der Weihnachtsengel überlegte kurz und sagte dann " Das könnte hinhauen, aber irgend wie müssen wir Gott noch davon überzeugen." "Mach dir darüber mal keine Sorgen," sagte Mutter Natur " Gott ist wie mein großer Bruder. Den wickle ich um meinen kleinen Finger". Gesagt, getan: Gott hörte sich den Vorschlag an und willigte ein, weil auch die anderen Engel im Himmel zu rebellieren anfingen. Gott und Mutter Natur machten sich gemeinsam daran die Unwetter zu schaffen und der Weihnachtsengel durfte wieder die Herzen der Menschen anstuppsen, wenn sie zauderten, zu helfen. So hatten die Menschen in diesem Jahr durch ihre eigene Schuld, eine sehr ärmliche Weihnacht. Das war ihnen aber egal, weil sie sich gegenseitig gerettet hatten. Sie haben ihre Liebe wieder zueinander gefunden. Und das ist doch das Wichtigste ! Der Weihnachtsengel war zufrieden.Gott, Mutter Natur und er mit all den anderen Engeln im Himmel feierten daraufhin das fröhlichste Weihnachtsfest, das sie jemals zusammen gefeiert hatten.
Autor: Bernd Schmidt
ST. NIKOLAUS, DIE GESCHICHTE EINES BISCHOFS...

Es war einmal vor langer Zeit, da lebte in der reichen Stadt Patara ein Junge. Er hörte auf den Namen Nikolaus. Die Eltern von Nikolaus sind an einer bösen Krankheit früh verstorben. Der Junge weinte Tag und Nacht, um seine Eltern. Nikolaus erbte sehr großen Reichtum: Gold, Silber, Edelsteine, Schlösser, Paläste und Ländereien. Auch Schafe, Pferde, Esel und noch ein paar andere Tiere gehörten ihm. Außerdem hatte er viele Untertanen, die sich um ihn kümmerten. Nikolaus war trotzdem sehr traurig und konnte sich über seinen Reichtum nicht freuen. Deshalb wollten ihn seine Untertanen aufmuntern. Der Hofmeister bot sich an, ihm seine Schlösser zu zeigen. Der Stallmeister wollte mit Nikolaus auf den schönsten Pferden durch die Ländereien reiten. Der Küchenmeister machte den Vorschlag, er könne doch für alle reichen Kinder der Stadt ein köstliches Essen zubereiten. Doch Nikolaus wollte von dem allem nichts wissen. Seine Traurigkeit wurde immer schlimmer, so das auch seine Tiere es deutlich spürten, dass er sehr traurig war. Sie drängten sich zu ihm, um ihn zu trösten. Vom Weinen müde geworden, wollte er sich schlafen legen. Ungeschickt stieß er mit dem Fuß an einen Tonkrug in dem viele Schriftrollen steckten. Der Krug zerbrach. Die Schriftrollen verteilten sich auf dem glänzenden Boden. Nikolaus ergriff eine der Schriftrollen und begann zu lesen. "Da war ein reicher Mann, der lebte herrlich und in Freuden. Und da war aber auch ein armer Mann, der lag hungernd vor seiner Tür und wollte nur Brosamen, die dem Reichen vom Tische fielen. Doch dieser gönnte es dem Armen nicht. Als der arme Mann starb, wurde er von den Engeln in den Himmel getragen. Auch der Reiche starb. Doch es kamen keine Engel, um ihn zu holen".
Gleiche ich nicht dem reichen Mann in der Geschichte, dachte sich Nikolaus. Ich bin schön gekleidet, lebe in Saus und Braus. Ich habe alles, was man sich erträumt. Die Bettler draußen vor dem Stadttor sehe ich nicht. Morgen werde ich mein Leben ändern. Ich werde früh aufstehen und mich dort umsehen. Am Morgen schlich sich Nikolaus aus dem Palast hinaus. Hinter dem Stadttor fand er die Ärmsten der Stadt. Sie waren zerlumpt, hungrig und krank. Die Not und das Elend waren sehr groß. Als sie Nikolaus erblickten, streckten sie ihm die Hände entgegen. Nikolaus wollte in die Tasche greifen, aber an seinen bestickten Kleidern gab es keine Taschen. Flink löste er seine schwere Goldkette vom Hals. Er zog sich den Goldring vom Finger und gab den Armen den wertvollen Schmuck. Danach schlüpfte Nikolaus aus dem Obergewand, dem bunten Rock, den Sandalen und verschenkte auch noch seine Kleidung. Es wurde Nikolaus warm ums Herz. Glücklich ging er nach Hause. Nun war Nikolaus wieder fröhlich. Am nächsten Tag trug Nikolaus dem Hofschneider auf, auf seine Kleider große Taschen aufzunähen. Vergnügt schlüpfte er in seinen weiten, roten Mantel. Er füllte seine Taschen mit Nüssen, Äpfel und Mandarinen. Abends schlich er sich wieder aus dem Palast. Er ging zu den Armen und verteilte alles. So beschenkte Nikolaus nun fast jeden Tag die Armen der Stadt. Seine lang andauernde Traurigkeit war vorbei.
Als Nikolaus zwölf Jahre alt wurde, besuchte er eine Schule, die weit von seinem Palast entfernt war. Berühmte Lehrer unterrichteten ihn und unterwiesen ihn in der Heiligen Schrift. Wo er jedoch Not und Elend sah, gab er mit vollen Händen. Das machte er aber weiterhin im Verborgenen. Als er einmal zum Gottesdienst in der Kirche war, wurden die Worte von Jesus Christus verlesen, wie er zu einem reichen Jüngling gesagt hatte: "Willst du mir angehören, so verschenke alles was dir gehört an die Armen". Über diese Worte hatte Nikolaus oft nachgedacht. Sie ließen ihn nicht mehr los. Er rief den Haushofmeister, befahl ihm Geld und Gut an die Armen zu verteilen. Nikolaus wollte sich ins Heilige Land aufmachen, wo unser Herr Jesus gelebt hatte. Auf seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land, litt Nikolaus oft große, unvorstellbare Not. Er wurde verletzt, er hatte kaum was zu Essen und zu Trinken. Bei allem Hunger blieb er aber stets fröhlich. Er zog durch das Land und predigte das Wort Gottes. Den Kindern erzählte er Geschichten aus der Bibel.
Eines Tages kehrte er in seine Heimat zurück. In Myra war vor einiger Zeit der alte Bischof gestorben. Als die Leute Nikolaus sahen, fragten sie ihn, wer er sei. "Ich bin Nikolaus ein Diener Christi", antwortete er. Die Leute führten Nikolaus ins Gotteshaus und ernannten ihn zum Bischof. Als er wieder ins Freie trat, erblickte Nikolaus seinen alten, grauen Esel vor der Tür angebunden. Von da an wurde der Esel sein treuer Begleiter. Nikolaus sorgte für die Gläubigen wie ein Hirte für seine Schafherde. In Zeiten der Gefahr predigte er den Christen an einsamen Orten und stärkte sie im Glauben. An seinem Geburtstag kleidete sich Nikolaus in seinen kostbaren Bischofsmantel und nahm den Hirtenstab in die Hand. Seinen Esel belud er mit einem schweren Sack. Der Sack war mit Leckereien, wie Nüssen, Mandarinen, Äpfel und Honigkuchen gefüllt. Nikolaus ging durch die Strassen und verteilte die Gaben. Diesen Tag machte er zu einem großen Fest. Das hielt er bei, bis ins hohe Alter. Als die Stunde kam, da Gott ihn heimholen wollte, fiel ihm nur eines schwer, sich von seinen Kindern zu trennen. Der Bischof Nikolaus starb am 6. Dezember 352. Zum Andenken an den Bischof Nikolaus wird heute noch der Nikolaustag gefeiert. Er kündigt als Vorbote das Weihnachtsfest an.
Diese überlieferte Nikolauslegende wurde aufbereitet von:
© 2003 Sylvia Müller
© 2011 Günter Fellner (Überarbeitung)
Morgen kommt der Weihnachtsmann ...
DIE GESCHICHTE VOM MÜDEN WEIHNACHTSMANN ...

Es war ein Tag vor Weihnachten, die Kinder auf der ganzen Welt hatten sich für den Heiligabend so einiges einfallen lassen, um den Weihnachtsmann mit Gedichten und Liedern zu erfreuen, denn er brachte ihnen Geschenke und so mancherlei süße Leckereien.
Doch dieses Mal war alles anders.
Hoch oben, in der Weihnachtsmannwolke, wo sonst der Weihnachtsmann mit seinen kleinen Weihnachtselfen fleißig und emsig arbeitete, herrschte unheimliche Stille. Der große Sack, der eigentlich schon fertig gefüllt sein sollte mit all den Geschenken für die artigen Kinder unten auf der Erde, lag leer vor dem Bett des Weihnachtsmanns, und dieser lag darin und schlief tief und fest.
Keiner der kleinen Helfer war in der Lage den schnarchenden Weihnachtsmann zu wecken. Sie rüttelten ihn, schüttelten ihn und schlugen mit Hölzern auf die Suppentöpfe, aber alles vergebens, der Weihnachtsmann wollte nicht wach werden.
Als man nun endlich den Weihnachtselfenprinz um Hilfe und Rat fragte, kam dem der rettende Gedanke: „Wenn wir nicht in der Lage sind den Weihnachtsmann zu wecken, müssen wir einen anderen bitten, der die morgigen Arbeiten für ihn übernimmt. Aber wer könnte das sein, wer war in der Lage den schweren Sack zu tragen und wer konnte den Weihnachtsschlitten herunter zur Erde führen?
Alle überlegten angestrengt. Einer der Elfen rief: “Und wenn wir Weihnachten dieses Jahr ausfallen lassen würden?“ Ein anderer meinte: „Wir könnten Weihnachten auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, solange, bis der Weihnachtsmann aufgewacht ist,“ aber alle diese Vorschläge lehnte der Prinz ab.
„Weihnachten muss stattfinden“, sagte er nachdenklich, „die Kinder warten unten auf der Erde und wären furchtbar traurig, wenn sie keine Geschenke erhielten.“
Der kleinste der Weihnachtselfen rief ganz aufgeregt: „Fragen wir doch den Osterhasen, ob er für den Weihnachtsmann einspringen kann.“ „Das ist eine prima Idee“, riefen alle durcheinander, „ja, fragen wir den Osterhasen.“
Der Elfenprinz nickte zustimmend und erteilte dem Kleinsten den Auftrag schnell zur Osterhasenwolke zu eilen, und den Hasen zu fragen, ob er die Weihnachtsgeschenke an die Kinder verteilen möchte.
Gesagt, getan. Eiligst machte sich der kleine Elf auf den Weg und erreichte bald die Wolke, wo der Osterhase zu Hause war.
„Ich bin doch viel zu klein und auch viel zu schwach, um den großen Sack vom Weihnachtsmann zu tragen“, sagte verwundert der Osterhase.
„Aber wenn wir Elfen alle mit anfassen und dir somit die große Last erleichtern, müsste das doch machbar sein“, erwiderte der Kleine, „denke doch nur an die vielen Kinder, wie traurig sie wären, wenn du an den Ostertagen deine schönen, bunten Ostereier nicht verstecken würdest“.
„Das leuchtet mir ein,“ sprach der Hase nachdenklich, „also machen wir uns sofort ans Werk, denn die Zeit drängt.“
Unten auf der Erde war die Nacht hereingebrochen, und die Menschen schliefen tief und fest, als der kleine Weihnachtself mit dem Osterhasen die Weihnachtswolke erreichte. Alle begrüßten den Hasen auf herzlichste und bedankten sich bei ihm für seine Hilfsbereitschaft.
„Hurtig, hurtig,“ rief der Elfenprinz, „bis heute Abend muss alles erreicht sein. Der Sack muss gefüllt werden, und das Gewand vom Weihnachtsmann muss mit Nadel und Faden für unseren Helfer auf die passende Größe geändert werden.“
Alle Weihnachtselfen eilten hin und her, einige füllten den Sack des Weihnachtsmannes, andere machten sich an dem purpurroten Mantel zu schaffen, und der Rest polierte den himmlischen Weihnachtsschlitten auf Hochglanz.
Als alles fertig war, schauten sie sich zufrieden ihr Werk an. Der Osterhase sah prima aus in seinem weihnachtlichen Gewand, der Sack war prall mit all den Gaben für die Kinder gefüllt, und zwanzig Rentiere, mit silbernen und goldenen Glöckchen geschmückt, waren vor den Schlitten gespannt.
Der Osterhase schwang sich auf das Gefährt und fuhr mit hundert kleinen Helfern von der Weihnachtswolke in Richtung Erde. Von Ferne hörte man noch die kleinen Glöckchen klingeln und den Hasen freudig rufen: „Juchhu, ich bin der Weihnachtsosterhase und komme zu euch, um meine Geschenke zu überbringen.“
Bis alle Kinder beschenkt waren hatten sie alle Hände voll zu tun, und keiner von ihnen bemerkte, dass unter dem Gewand gar nicht der Weihnachtsmann steckte, sondern der Osterhase. Brav wurden Gedichte aufgesagt und die schönsten Weihnachtslieder gesungen, freudig die Geschenke übergeben auch ebenso ausgepackt wie bestaunt. Alles schien wie immer, ein jeder war glücklich und zufrieden.
Als die Arbeit auf der Erde für den Hasen und seine Helfer beendet war, ging es mit dem Schlitten wieder in Richtung Himmel, zurück zur Weihnachtswolke.
Dort lag der Weihnachtsmann noch immer in seinem Bett und schnarchte laut vor sich hin.
Aber die Weihnachtselfen und der kleine Osterhase waren sehr glücklich darüber, dass die Kinder doch noch rechtzeitig beschenkt werden konnten, auch wenn sie wegen dem verschlafenen Weihnachtsmann einen Trick anwenden und somit etwas schummeln mussten. Dieser aber sollte nicht ungestraft davonkommen. Der Elfenprinz und der Osterhase schmiedeten einen Plan, der für den Weihnachtsmann nicht ohne Folgen sein sollte. Er selber sollte, wenn die Osterfeiertage anfingen, statt des Hasen nun die Ostereier verteilen und verstecken.
Als der Weihnachtsmann nun endlich aufwachte und er seinen Schlaf gähnend aus den Augen rieb, hörte er von den Elfen, dass er Weihnachten verschlafen hatte und der Osterhase seine Arbeit verrichten musste.
„Ist ja nicht so schlimm“, gähnte der Verschlafene, „dann bin ich nächstes Jahr wieder pünktlich zur Stelle“.
„Nein, so einfach kommst du mir nicht davon“, sagte böse und enttäuscht der Elfenprinz, „zur Strafe wirst du Ostern zur Erde herabfahren und die Arbeit des Osterhasen übernehmen. Du wirst alle Eier schön bunt bemalen und sie unter jedem Baum und Strauch verstecken, damit die Kinder danach suchen können.“
Der Weihnachtsmann gehorchte zähneknirschend, und als die warme Osterzeit heran brach, sah man ihn schwitzend in seinem dicken roten Weihnachtsmantel auf allen vieren mit einem kleinen Körbchen voller bunter Ostereier von Gebüsch zu Gebüsch krabbeln.
„Oh wie ist mir das peinlich, oh wie schäme ich mich“, murmelte der Weihnachtsmann immer wieder vor sich hin und schwor sich für die Zukunft, nie mehr so lange zu schlafen und immer zur Weihnachtszeit pünktlich aufzustehen und fleißig seinen weihnachtlichen Aufgaben gerecht zu werden.
ENDE
Copyright: GiTo
DER SCHNEEMANN UND DIE SCHNEEKÖNIGIN ...

Es war bitterkalt. Der Winter machte seinem Namen alle Ehre. Seit Stunden schneite es. Der kleine Paul und seine Schwester Marie drückten ihre Näschen an die Fensterscheibe und schauten dem Schneetreiben mit großem Interesse zu. Sie nahmen sich vor, morgen früh, nach dem Aufstehen einen riesengroßen Schneemann zu bauen. Sie gingen zu Bett, wünschten sich eine gute Nacht und schliefen dann auch bald ein.
Als der Morgen erwachte, aßen sie schnell ihr Frühstück und machten sich eilig daran im Vorgarten ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie formten einen Schneeball und rollten ihn solange in dem Schnee hin und her, bis der immer größer und immer größer wurde. Das taten sie genau drei mal. Eine große Kugel war für den Kopf bestimmt, die zweite für den Oberkörper und die letzte und größte Kugel war dann der Unterkörper von ihrem Schneemann. Sie setzten alle drei übereinander und schauten sich ihr Werk an. Ja, er sah schon ganz stattlich aus, aber es fehlte noch die Hauptsache. Marie eilte in die Küche und Paul in den Keller. Ganz feierlich drückte Marie eine Karotte in die oberste Kugel und siehe da, die Nase vom Schneemann war fertig. Der kleine Paul, der aus dem Keller kleine Kohlenstückchen geholt hatte, drückte ihm damit Mund und Augen ins Gesicht. Oh, war ihr Schneemann schön. Damit er auch nicht zu sehr fror, spendierte Paul ihm seinen grünen Schal, und Marie trennte sich vorübergehend von ihrer heißgeliebten Pudelmütze.
Die Mutter der beiden trat vor das Haus und lachte: „Prima habt ihr das gemacht. Ein wunderschöner Schneemann. Hier habt ihr einen Besen, den könnt ihr eurem Schneemann in die Hand drücken, dann hat er noch zusätzlich etwas Halt.“ Sie gab ihren beiden Kindern einen alten, ausrangierten Besen und ging dann wieder an ihre Hausarbeit.
Paul und Marie faßten sich an den Händen und hüpften singend um ihren weißen Mann herum und sangen ihre schönsten Kinderlieder.
Am Abend, vor dem Zubettgehen, schauten sie ihren Schneemann noch einmal an, wünschten ihm eine gute Nacht und huschten dann unter ihre warme Zudecke. Marie sagte zu Paul: „Wir brauchen noch einen Namen für unseren Schneemann.“ „Hm,“ murmelte Paul nachdenklich, „wie wäre es mit Ferdinand?“
„Gut,“ sagte Marie, „nennen wir ihn Ferdinand,“ und schlief zufrieden ein.
Draußen stand nun der Schneemann. Es war stockfinstere Nacht. Der Schnee rieselte vom Himmel als wollte er nie aufhören. Ferdinand schaute sich um, und
überlegte, was er nun so alleine anstellen könnte. Er schaute auf seinen Besen und dachte sich: „Ich kann den Kindern eine Freude machen und den Weg zu ihrem Haus vom vielen Schnee freikehren.“ Er machte sich an die Arbeit und bis der Morgen erwachte war er auch schon fertig.
Marie und Paul rieben sich erstaunt die Augen, als sie den schneefreien Weg sahen und waren sich einig, daß dies nur ihr Freund, Ferdinand getan haben könnte. Beide liefen eiligst zu ihm, umarmten und herzten ihren Schneemann, dann machten sie sich auf den Weg zur Schule.
„Was ist los mit dir,“ fragte Ferdinand, „willst du mich ärgern oder weißt du nicht wohin des Weges?“ „Nichts von beiden,“ piepste die Schneeflocke, „ich finde dich wunderschön und muß dich immer wieder anschauen. Du bist so groß, so stattlich, so liebenswert, so anmutig, so...........“ „Ja ja, ist ja gut,“ lachte der Schneemann und schaute verlegen zur Seite. „Mein Name ist Flöckchen, darf ich bei dir bleiben?“ fragte die kleine Flocke und setzte sich ohne eine Antwort abzuwarten direkt auf die Rübennase vom Ferdinand. „So kann ich dir immer in deine schönen Augen schauen,“ flötete Flöckchen, „und wenn der Frühling kommt, und wir beide von der Erde Abschied nehmen müssen, gehen wir diesen Weg gemeinsam.“
„Frühling, was ist das?“ fragte Ferdinand erstaunt, und wieso Abschied nehmen?
Die kleine Schneeflocke erzählte ihm vom Frühling und daß der Schnee dann schmelzen muß. Dann wäre es warm und es gäbe auf der ganzen Welt keine Schneemänner und keine kleinen Schneeflocken mehr. „Ich möchte aber nicht schmelzen,“ klagte Ferdinand weinerlich, „ich bin doch erst ein paar Tage alt, und was soll dann aus Paul und Marie werden? Ich kann sie doch nicht alleine lassen.“ „Das ist eben unser Schicksal,“ sagte Flöckchen, „aber laß uns die Zeit genießen, in der es kalt ist. Da kann uns nichts passieren. Denke nicht an morgen, freue dich über den heutigen Tag.“
Marie und Paul kamen aus der Schule und umarmten ihren Ferdinand. Dann faßten sie sich wieder bei den Händen und sangen ihre kleinen Lieder. Der aber konnte sich nicht so recht freuen, denn er mußte immer an die Worte der kleinen Schneeflocke denken. Er schielte auf seine Nase und beobachtete die Kleine. Sie aber tanzte fröhlich auf und ab, hin und her und benahm sich so, als wenn es keine Schneeschmelze und keinen Abschied gäbe.
Am Abend kamen noch einmal die beiden Kinder, um nach Ferdinand zu sehen, aber sie waren traurig und bedrückt. Marie legte ihre Ärmchen um ihren Schneemann und fing an bitterlich zu weinen. Paul sah nur zu Boden und zog mit seinen Schuhspitzen verlegen lauter Streifen in den Schnee, ohne dabei den Ferdinand auch nur einmal anzuschauen.
„Lebe wohl, Ferdinand,“ schluchzte Marie, „morgen bist du nicht mehr da. Im Radio haben sie gesagt, daß es heute Nacht Tauwetter gibt und es mit der Kälte nun vorbei ist.
Wir werden immer an dich denken.“ Beide winkten ihrem Schneemann noch einmal zum Abschied zu und gingen mit gesenkten Köpfen in ihr Haus.
„Nun ist es soweit,“ seufzte Ferdinand, „Flöckchen, hast du gehört, was mit uns heute Nacht geschieht?“ „Ja,“ sagte sie leise, „habe doch aber keine Angst. Sieh mich genau an, erkennst du mich denn nicht?“
Ferdinand stellte seine beiden, mit Tränen verschwommenen Augen, auf volle Sehschärfe ein und sah Flöckchen verwundert an. „Ja,“ sagte er, „ja, du trägst ja ein Krönchen, bist du am Ende........bist du am Ende die Schneekönigin?“
„Na endlich hast du mich erkannt,“ sagte sie. „Ich gebe dir meinen purpurroten Zaubermantel. Der wird dich vor der Wärme schützen und dich kalt halten.
Du wirst somit nicht zu Wasser zerschmelzen, sondern direkt in mein Schneereich eintreten können.
Beruhigt legte Ferdinand den Mantel der Königin um seine Schultern und wartete auf die Nacht. Ein warmer Wind wehte um seine Nase, und wie von Geisterhand schmolz alles um ihn herum, was nur im geringsten aus Schnee war. Ja, er sah sogar kleine Blumen ihre Köpfchen aus der Erde strecken, und unter seinen Füßen kitzelte ihn saftig grünes Gras.
Er schaute sich alles mit großen und erstaunten Augen an, mußte aber feststellen, daß dies nicht seine Welt war, in der er leben möchte. Er sehnte sich nach dem Schnee, die vielen kleinen Flocken, der Kälte und nach der Schneekönigin. Er sah noch einmal zum Haus der Kinder und schloß dann lächelnd seine Augen. Dann war er wie vom Erdboden verschwunden.
Als er seine Augen wieder öffnete, war er in seiner neuen, kalten Welt. Alles war wie in silberner Farbe getaucht und Tausende von kleinen Flocken tanzten um ihn herum. Und mittendrin stand die Schneekönigin und forderte ihren Ferdinand zum Tanz auf.
Alle waren glücklich und zufrieden.
Jedes Jahr aufs neue, und immer zur Winterzeit, kommen sie alle zu uns auf die Erde zurück, um die Menschen zu erfreuen.
Dann kleidet sich die Erde in ein weißes Kleid, vom Himmel tanzt die Schneekönigin mit ihren vielen kleinen Flocken, und unser Ferdinand steht Nacht für Nacht am Fenster von Paul und Marie und winkt den beiden fröhlich zu.
Ende
Copyright: GiTo
DIE DREI FRAGEN ...

Ein König dachte einmal darüber nach, daß ihm nichts mißglücken würde, wenn er immer den richtigen Zeitpunkt wüßte, um eine Sache zu beginnen; wenn er ferner wüßte, mit welchen Menschen er sich abgeben sollte und mit welchen nicht, und wenn er vor allem wüßte, welches Werk das wichtigste von allen ist.
Danach ließ er in seinem Land verkünden, daß er einen hohen Lohn demjenigen geben wolle, der ihn lehren würde, den richtigen Zeitpunkt für jedes Werk, den richtigen Menschen und das wichtigste Werk zu erkennen.
Es kamen viele Gelehrte zum König und sie gaben ihm verschiedene Antworten auf seine Fragen.
Auf die erste Frage antworteten die einen: Um die richtige Zeit für jedes Werk zu wissen, müsse man sich vorher eine Einteilung der Tage, Monate und Jahre machen und sich streng daran halten.
Die anderen sagten zum König, man könne überhaupt im voraus nicht wissen, welches Werk zu welcher Zeit verrichtet werden müsse, und man dürfe sich nicht durch leere Spielereien ablenken lassen, sondern müsse vielmehr auf alle Geschehnisse achten und das Nötige zur richtigen Zeit beginnen.
Die dritten aber behaupteten, daß der König noch so aufmerksam alles beachten möge--ein einzelner Mensch könne doch nicht immer richtig erkennen, in welcher Zeit jedes Werk das rechte sei. Er müsse daher den Rat weiser Männer hören und danach entscheiden, wann jedes Werk am besten erledigt werden könne.
Die vierten aber sagten, daß es Dinge gäbe, bei denen einem keine Zeit bliebe, den Rat der anderen einzuholen. Oft müsse man sofort entscheiden, ob es Zeit sei, das Werk zu beginnen oder nicht. Um dies zu wissen müsse man die Zukunft kennen. Diese aber sei nur den Magiern bekannt und daher müsse man, um die richtige Zeit für jedes Werk zu wissen, einen Magier befragen.
Ebenso verschieden beantworteten auch die Gelehrten die zweite Frage.
Die einen sagten, die wichtigsten Menschen für den König seien seine Mitarbeiter, die Statthalter; die zweiten sagten, die wichtigsten Menschen seien die Priester. Die dritten behaupteten, die wichtigsten Menschen seien die Ärzte. Und die vierten sagten, die wichtigsten Menschen seien die Krieger.
Auf die dritte Frage, welches Werk das wichtigste von allen sei, sagten die einen, das wichtigste seien die Wissenschaften; die zweiten erklärten, das wichtigste sei die Kriegskunst; und die dritten sagten, das wichtigste sei die Gottverehrung.
Da alle Antworten sehr verschieden waren, nahm der König keine an. Und er gab auch niemandem die Belohnung. Er beschloß daher, um die richtigen Antworten auf seine Fragen zu bekommen, zu einem Einsiedler zu gehen, der sehr berühmt wegen seiner Weisheit war. Dieser Einsiedler lebte im Walde, verließ nie seine Wohnstätte und empfing nur einfache Leute.
Der König zog sich daher ein einfaches Gewand an und machte sich auf den Weg zum Einsiedler.
Als er in die Nähe des Einsiedlers kam, stieg er vom Pferde, ließ seine Leibwache zurück und ging allein zu ihm hin.
Der Einsiedler grub vor seiner Hütte die Beete um, als der König sich ihm näherte. Als der Einsiedler ihn erblickte, begrüßte er ihm und grub gleich wieder weiter. Der Einsiedler war mager und schwach, und wenn er den Spaten in die Erde stieß und die Schollen umwandte, atmete er mühsam.
Der König ging auf den Einsiedler zu und sagte:
"Ich komme zu dir, weiser Mann, um dich zu bitten, mir drei Fragen zu beantworten:
Welchen Zeitpunkt muß man stets im Sinn haben, um nichts zu versäumen und um hinterher nichts zu bereuen?
Welche Menschen brauchen wir am notwendigsten, mit welchen Menschen muß man sich also mehr beschäftigen und mit welchen weniger?
Welche Werke sind die wichtigsten? Welche Werke muß man vor allen anderen tun?"
Der Einsiedler hörte den König an, sagte aber nichts; er spuckte in die Hand und grub weiter.
"Du bist wohl müde?" fragte der König, "gib mir den Spaten, ich will für dich graben!"
"Danke", sagte der Einsiedler.
Er gab dem König den Spaten und setzte sich auf die Erde.
Nachdem der König zwei Beete umgegraben hatte, hielt er inne und wiederholte seine Fragen.
Der Einsiedler gab ihm auch jetzt keine Antwort, stand auf und streckte seine Hand nach dem Spaten aus.
"Jetzt ruhe du dich aus, und ich werde weiter graben", sagte er.
Aber der König gab ihm den Spaten nicht und grub weiter.
Es verging so eine Stunde und eine zweite, die Sonne begann hinter den Bäumen unterzugehen. Der König steckte den Spaten in die Erde und sagte:
"Ich kam zu dir, weiser Mann, damit du mir meine Fragen beantwortest, wenn du sie nicht beantworten kannst, so sage es mir offen, und ich werde wieder nach Hause gehen."
"Da kommt jemand gelaufen!" sagte der Einsiedler, "wollen wir schauen wer es ist."
Der König sah sich um und erblickte tatsächlich einen bärtigen Mann, der aus dem Walde hergelaufen kam.
Der Mann hielt sich mit den Händen den Leib, und Blut strömte unter seinen Händen hervor. Er lief auf den König zu, stürzte zu Boden, schloß die Augen, rührte sich nicht, sondern stöhnte nur mit schwacher Stimme.
Der König und der Einsiedler öffneten die Kleider des Mannes und sahen eine tiefe Wunde in seinem Leib. Der König wusch sie, so gut er konnte, und verband sie mit seinem Taschentuch und mit dem Handtuch des Einsiedlers. Doch das Blut konnte man nicht stillen, und der König nahm immer wieder den nassen, mit warmem Blut durchtränkten Verband ab, um die Wunde von neuem zu verbinden. Als das Blut endlich gestillt war, kam der Verwundete zu sich und bat um einen Trunk Wasser. Der König holte ihm frisches Wasser und stillte den Durst des Verwundeten.
Inzwischen war die Sonne untergegangen, und es begann kühl zu werden.
Der König und der Einsiedler trugen den Mann in die Hütte und legten ihn aufs Bett. Er schloß die Augen und wurde ganz still.
Der König war müde von dem weiten Weg und von der Arbeit, so daß er sich vor den Eingang der Hütte hinlegte und so fest einschlief, daß er die ganze kurze Sommernacht hindurch schlief.
Als er am nächsten Morgen aufwachte, konnte er es nicht begreifen, wo er sich befand, und wer dieser sonderbare bärtige Mann dort war, der auf dem Bette lag und unverwandt mit strahlenden Augen den König anblickte.
"Vergib mir!" sagte der bärtige Mann mit schwacher Stimme, als er bemerkte, daß der König erwacht war und ihn ansah.
"Ich kenne dich nicht und habe dir auch nichts zu vergeben", antwortete der König.
"Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich, ich bin dein Feind, der Rache geschworen hatte, weil du meinen Bruder hinrichten ließest und mir meine Habe weggenommen hast. Ich wußte, daß du allein zum Einsiedler gegangen warst, und ich wollte dich auf dem Rückweg töten. Der ganze Tag verging, und immer noch kamst du nicht zurück. So verließ ich mein Versteck, um nach deinem Aufenthaltsort zu sehen, und stieß dabei auf deine Leibwache, die mich verwundete.
Ich floh und wäre verblutet und gestorben, hättest du dich meiner nicht angenommen und meine Wunden verbunden. Ich wollte dich töten, aber du hast mir das Leben gerettet. Wenn ich nun am Leben bleibe, so werde ich dir, wenn du es mir erlaubst, als dein treuer Sklave dienen und auch meinen Söhnen dasselbe befehlen. Vergib mir!"
Der König freute sich, daß es ihm so leicht gelungen war, sich mit seinem Feinde zu versöhnen. Er vergab ihm nicht nur, sondern versprach ihm auch, seine Güter zurückzugeben und ihm seine Diener und einen Arzt zu schicken.
Der König verabschiedete sich von dem Verwundeten, ging aus der Hütte hinaus und suchte den Einsiedler; er wollte ihn zum letzten Male, bevor er ihn verließ, bitten, ihm doch seine Fragen zu beantworten.
Der Einsiedler war draußen und kroch auf den Knien zwischen den Beeten herum, die gestern gegraben worden waren und säte Gemüse hinein.
Der König ging zu ihm und sagte:
"Weiser Mann, ich bitte dich zum letzten Male, beantworte mir meine Fragen!"
Der Einsiedler kauerte auf seinen dünnen Beinen und schaute zu dem vor ihm stehenden König empor und sagte:
"Die sind doch schon beantwortet!"
"Wieso sind sie beantwortet?" fragte der König.
"Gewiß", sagte der Einsiedler, "hättest du gestern nicht Mitleid mit meiner Schwäche gehabt und diese Beete für mich umgegraben, sondern wärest allein zurückgegangen, so hätte dich der Mann überfallen, und du hättest es bereut, nicht bei mir geblieben zu sein.
Also war der richtige Zeitpunkt, als du meine Beete umgrubst; und ich war für dich der wichtigste Mensch; und das wichtigste Werk war, mir Gutes zu tun. Dann später, als der Verwundete hergelaufen kam, war der rechte Zeitpunkt, als du ihn pflegtest. Denn hättest du seine Wunde nicht verbunden, so wäre er gestorben, ohne sich mit dir ausgesöhnt zu haben. So war der Verwundete für dich der wichtigste Mensch, und was du an ihm getan hast, das wichtigste Werk.
So merke dir nun, es gibt nur eine wichtigste Zeit, das ist der Augenblick, denn nur in ihm haben wir Gewalt über uns. Der wichtigste Mensch aber ist der, mit dem du im Augenblick zusammenkommst, denn niemand kann wissen, ob noch ein anderer sich um ihn bemühen wird. Und das wichtigste Werk ist, diesem Menschen Gutes zu tun, denn nur dazu ist der Mensch in diese Welt gesandt."
Leo N. Tolstoi
DAS MÄRCHEN VOM KOBOLD UND DER KÖNIGSTOCHTER ...

Es war einmal ein kleiner Kobold mit Namen Adrian. Er war ein Glückskobold, denn er war in der Lage, traurigen und alleingelassenen Menschen für ein paar Stunden Glück zu schenken. Dafür hatte er drei Wünsche und sein Säckchen, vollgefüllt mit goldenem Zauberstaub, zur Verfügung. Aber er musste acht- geben, denn wenn er seinen dritten und letzten Wunsch jemandem schenkte, ohne dass der ihn aus tiefsten und reinsten Herzen liebte, musste er für den Rest seines Lebens im Wald der ewigen Finsternis verbringen.
Adrian lebte glücklich und zufrieden in seinem Wald, bis er von der schönen aber traurigen Königstochter Jolanda erfuhr. Sie sollte auf Wunsch ihres Vaters den grausamen und bösen König Aktus aus dem Land der Nöte heiraten. Den König, der durch seine Habgier sein Volk leiden ließ und bei dem Krankheit und Hungertod ein ständiger Gast war. Sie und ihr Vater waren dem mächtigen König hilflos ausgeliefert und musste sich seinen Willen beugen.
Jede Nacht weinte sich die Prinzessin in den Schlaf, und je näher der Tag ihrer Hochzeit kam, um so trauriger wurde sie.
Adrian beschloss Jolanda zu helfen. Er nahm sein Zauberstaubsäckchen, suchte sich einen geeigneten Wanderstab aus dem Gehölz seines Waldes und machte sich auf den langen Weg zu ihr.
Er war nun schon sieben Tage und sieben lange Nächte unterwegs, bis er nun endlich vor dem großen Schloss stand, in dem die Prinzessin wohnte. Er klopfte mit seinem Stab gegen das Schlosstor und bat um Einlass.
"Was willst du?" fragten die Wachen den kleinen Wicht und sahen ihn verwundert an, denn sie hatten noch nie einen Kobold gesehen.
"Ich möchte zur Königstochter" sagte Adrian freundlich "ich habe von ihrer Traurigkeit gehört und möchte ihr ein paar Stunden Glück schenken."
"Niemand hier in diesem Land ist in der Lage die Prinzessin aufzuheitern" sagte einer der Wachen "aber ein Versuch soll es Wert sein. Folge mir, ich geleite dich zu ihren Gemächern, dort kannst du dein Glück versuchen."
Nun endlich stand Adrian vor der Königstochter. Sein kleines Herz schien fast vor Mitleid und Sorge um Jolanda zu zerspringen als er sie so leiden sah. Sie lag auf ihrem Bett und hatte ihr verweintes Gesicht hinter all ihren Kissen versteckt.
"Bitte höre mir zu Jolanda" sagte Adrian leise "ich heiße Adrian und bin ein Glückskobold. Ich kann dich für ein paar Stunden von deiner Traurigkeit und all deinem Leid befreien."
Zaghaft ergriff der kleine Kobold die Hand der Königstochter und streichelte sie sanft. "Komme mit mir in meine Welt, dort findest du das Glück, nach dem du dich so sehr sehnst."
Die Prinzessin sah Adrian tief in seine gutmütigen Augen und fragte: "Gibt es denn eine andere Welt für mich? Gibt es irgendeinen Ort, an dem ich all mein Leid und Kummer vergessen kann? Kann ich mich dort auch vor dem grausamen König Aktus verstecken?"
"All deine Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit wirst du dort finden. Habe Vertrauen zu mir, ich kann dir helfen," versprach Adrian und holte sein Säckchen mit dem Zauberstaub hervor.
"Dann führe mich fort von hier," flüsterte weinend die Prinzessin "weit weit fort. Auch wenn es nur für ein paar Stunden ist, so will ich dir jetzt schon dafür dankbar sein."
"Schließe deine Augen," sagte Adrian "und vertraue dich mir an."
Die Prinzessin tat das, was ihr der kleine Kobold geheißen hatte und legte ihr Schicksal seine Hände.
Der kleine Wicht nahm eine Handvoll Goldstaub aus seinem Säckchen und blies ihn Jolanda direkt in ihr schönes Gesicht. Dann sagte er seinen Zauberspruch auf:
"Schlafe Prinzessin schlafe ein,
wirst nun im Traum wie ich ein kleiner Kobold sein.
Vergiss alle deine Sorgen alles Leid,
tausch` nun Samt und Seide ein in ein buntes Blätterkleid.
Sollst vor Glück im Tanz dich drehen
und die Welt mit meinen Augen sehen."
Nun schlief die Prinzessin tief und fest und träumte den schönsten Traum ihres Lebens.
Sie träumte, sie wäre selbst ein kleines Koboldmädchen und ginge mit Adrian Hand in Hand durch seine fremde Welt. Nur ihr kleines Krönchen auf ihrem Haupt verriet, dass sie eine Prinzessin und somit von höherer Geburt war. Adrian zeigte ihr nun seine Heimat, und sie konnte sich nicht satt sehen an den vielen wunderschönen bunten Blumen, an den geheimnisvollen Bäumen und an
dem sonnendurchwirkten Himmel, der wie ein Diamant auf sie herab zu strahlen schien.
Selbst die vielen kleinen Tiere, denen sie begegneten, verneigten sich vor ihr und hießen sie freundlich und herzlich willkommen.
Alle Vögel sangen ihr zu Ehren ihre schönsten Lieder, und so manches kleines Bienchen kam angeflogen, um ihr eine Kostprobe ihres süßesten und feinsten Honigs anzubieten. Und dabei erklang das Rauschen des Windes wie eine leise Melodie.
Jolanda war von all dem Zauber und soviel Schönheit der ihr fremden Natur so beeindruckt, dass sie am liebsten für immer geblieben wäre. Aber leider war es nur ein Traum, aus dem sie bald wieder erwachen würde. Sie nutzte die Zeit und genoss die schönen Dinge, die ihr diese Traumwelt zu geben hatte. Und dabei hielt Adrian ganz fest ihre Hand und wich nie von ihrer Seite.
Als die Prinzessin erwachte und Adrian erblickte, der noch immer vor ihrem Bett wachte, lächelte sie ihn dankbar an und sprach: "Solch eine glückliche Zeit habe ich noch nie erlebt. Ich danke dir dafür. Bitte bleibe bei mir so lange du kannst, denn allein durch deine Anwesenheit fühle ich mich sicher und geborgen."
Dann wurde ihr Blick wieder traurig und ängstlich, denn die Erinnerung an ihre bevorstehende Vermählung mit König Aktus kam zurück. Von nun an beherrschte sie wieder das Gefühl der Verlorenheit und Einsamkeit.
Der kleine Kobold blieb. Er wollte solange bleiben, bis die nächste Nacht hereinbrach. Immer und immer wieder schaute er Jolanda an und konnte seinen Blick nicht mehr von ihr wenden. Und dabei schlug sein kleines Koboldherz so laut und schnell, dass er befürchtete, die schöne Königstochter könnte dies hören.
Als der Abend hereinbrach, stand Adrian abermals vor Jolandas Bett. Und wieder weinte sie so herzzerreißend, dass der kleine Wicht nicht anders konnte und ihr seinen zweiten Zauberwunsch anbot. Sie durfte noch einmal seine Welt mit ihm für ein paar Stunden besuchen.
Unendlich dankbar willigte sie freudig ein und schloss ihre Augen, während Adrian seinen Goldstaub verblies und seinen Zauberspruch aufsagte:
"Schlafe Prinzessin schlafe ein,
wirst nun im Traum wie ich ein kleiner Kobold sein.
Vergiss alle deine Sorgen alles Leid,
tausch` nun Samt und Seide ein in ein buntes Blätterkleid.
Sollst vor Glück im Tanz dich drehen
und die Welt mit meinen Augen sehen."
Dieses mal träumte Jolanda sie säße auf einem wunderschönem Pferd, das von Adrian mit sicherer Hand durch die Nacht geführt wurde.
Sie schwebten über Bäche, die zu Flüssen wurden, und die wiederum ergossen sich hinein ins weite Meer.
Dort schien der Mond am Himmel so hell, und die Sterne leuchteten so klar, dass sie das Gefühl hatte, sie wären mitten im fernen endlos weitem Weltall. Sie lauschten beide dem Rauschen der Wellen und erfreuten sich an dem Gesang der Wale.
Adrian ließ seine schöne Prinzessin nie aus den Augen und bot ihr somit Zuversicht, Vertrauen und Geborgenheit. Und manchmal, wenn Jolanda glaubte er würde gerade nicht einmal zu ihr hinschauen, schenkte sie ihm einen liebevollen und vertrauten Blick. Sie fühlte sich zu dem kleinen Kobold so sehr hingezogen, dass sie wiederum den Wunsch hegte, mit ihm für immer den Rest ihres Lebens dort in seiner verzauberten Welt zu verbringen.
Auch dieser Traum musste zu Ende gehen, und als Jolanda von ihm erwachte, fühlte sie einen Schmerz in ihrem Herzen. Es war der süße Schmerz einer großen Liebe, einer tiefen und reinen Liebe zu Adrian.
Lange und überglücklich über das Erlebte schaute sie dem kleinen Kobold tief in die Augen, und ihr Blick hätte beinahe verraten, dass sie mehr für ihn empfand als nur eine Freundschaft. Doch sie hielt sich zurück, denn schließlich war sie ein Mensch und er ein Kobold. Eine Verbindung der Beiden in ihrer Welt schien für die Prinzessin unmöglich, deshalb hatte sie folgenden Plan und fragte:
"Oh du lieber guter Adrian, ist es dir möglich, mich heute Nacht für immer in deine wunderbare Zauberwelt mitzunehmen? Morgen ist der Tag, an dem ich mit dem grausamen König Aktus vermählt werden soll, und nur du allein kannst mir helfen und mich vor diesem großen Unglück bewahren."
Adrian, der längst wusste, dass er sich in die schöne Jolanda verliebt hatte, zögerte zuerst, sprach dann aber mit leiser ängstlicher Stimme:
"Ich kann und werde dir deinen Herzenswunsch erfüllen, muss dir aber von den Bedingungen meines dritten und letzten Wunsches für dich berichten. Solltest du mich nicht aus tiefsten und reinsten Herzen lieben, darfst du zwar in meiner Welt leben und glücklich sein, ich aber werde für den Rest meines Lebens im Wald der Finsternis verbringen müssen, und wir werden uns dann nie mehr wiedersehen."
Und während er ihr sein großes Geheimnis verriet, zitterte der kleine Wicht aus Angst vor seiner ungewissen Zukunft und weinte eine große Träne.
Jolanda zerbrach es fast ihr Herz als sie den verängstigten und traurigen Adrian vor sich sah. Sie beugte sich zu ihm herab, nahm zärtlich seinen Kopf zwischen ihre Hände und hauchte ihm einen zarten liebevollen Kuss auf seinen traurigen Mund und wischte ihm seine Träne fort.
Dieses Mal war sie es, die zu dem kleinen Kobold sagte: "Habe Vertrauen zu mir. Ich verspreche dir, du brauchst dich nicht zu ängstigen. Du wirst sehen, es wird alles gut."
Und Adrian hatte Vertrauen. Als der Abend hereinbrach, legte sich die Prinzessin auf ihr Bett, während Adrian ein letztes Mal in sein Säckchen griff und den Rest seines Zauberstaubes über Jolanda verblies.
Dann sagte er mit fester Stimme seinen Zauberspruch auf:
"Schlafe Prinzessin schlafe ein,
sollst nun für immer ein kleiner Kobold sein.
Vergessen sind all die Sorgen all das Leid,
tauschst nun Samt und Seide ein in ein buntes Blätterkleid.
Du wirst vor Glück im Tanz dich drehen
und die Welt mit deinen eigenen Augen sehen."
Als Jolanda ihre Augen öffnete, fand sie sich an der Stelle wieder, an der sie schon in ihrem ersten Traum mit Adrian war. Das Gras schien noch grüner, all die Blümchen noch bunter, und die Vögel sangen noch schöner als sie es in Erinnerung hatte. Aber sie war allein. Von ihrem kleinen Kobold war nichts zu sehen.
Immer und immer wieder rief sie seinen Namen: "Adrian oh geliebter Adrian wo bist du, oh was habe ich dir nur angetan."
War ihre Liebe am Ende doch nicht so groß, dass sie ihn vor sein grausames Schicksal bewahren konnte?
Sie setzte sich in das Gras und fing an zu weinen. Sie weinte um ihren geliebten Kobold, der, wie sie nun glaubte für immer sein Dasein im Wald der Finsternis verbringen musste.
Während sie um ihren Geliebten trauerte, hörte sie aus der Ferne einen Gesang. Sie horchte und bemerkte, dass er langsam aber unaufhörlich immer fröhlicher und lauter wurde und sich ihr näherte. Sie erhob sich und schaute in die Richtung, aus der er kam. Auf einmal klopfte ihr Herz so stark als wollte es vor Freude zerspringen, da sie nun endlich erkannte, wer dort so wunderschön sang.
Adrian hatte alle seine Freunde zusammengerufen, und alle sind sie gekommen, um die schöne Jolanda zu begrüßen und sie in ihrer Mitte willkommen zu heißen.
"Dieses schöne Koboldmädchen ist Prinzessin Jolanda," verkündete Adrian stolz seinen Freunden, "und ab heute ist sie die Königin meines Herzens."
Er umarmte sie, küsste sie herzlich und innig auf ihren roten Mund und flüsterte ihr ins Ohr: "Willkommen in meinem Leben, willkommen in meinem Herzen."
Ende
Illustriert und geschrieben von GiTo
Wer mehr schöne Märchen von GiTo lesen möchte, hier ist der Link zu seiner Märchenseite.:
DIE BERGELFE UND DIE SAAT DES ZAUBERWALDES ...

Alle einhundert Jahre wurde im Elfenland die schönste unter den Schönen zur Jahrhundertkönigin gewählt, und bald sollte dieses große Ereignis stattfinden. Alle Elfenmädchen, die meinten hübsch genug zu sein, um diesen Platz einzunehmen, schmückten ihr Haar mit Blumen zogen sich ihr schönstes Gewand an und säuberten ihre feinen Flügel. Dann war es soweit. Eine nach der anderen stellte sich zur Wahl und wartete dann voller Ungeduld auf die Entscheidung des Ältestenrates. Auch Hildegunde, eine Elfe, die schöner nicht sein konnte, mit kastanienbraunem Haar, Augen so sanft wie ein Reh und einen Mund so rot wie die Abendsonne aber ein Herz aus Stein, hatte sich zur Wahl gestellt. Sie war sich sicher, dass sie die Auserwählte sein würde, deshalb hatte sie auch keine Angst vor der weiteren Konkurrenz. Endlich, nach beinahe endlosem Warten, wurde der Name der Siegerin verkündet. Der Älteste des Rates erhob sich und verkündete mit freudiger Stimme: „Für das nächste Jahrhundert wird unsere neue Königin sein............... die Elfe Maxima“. Hildegunde stand da wie versteinert. Sie glaubte ihr Herz hätte aufgehört zu schlagen. Sie, die schönste unter aller Elfen, sollte nicht Königin werden? Sie konnte es nicht glauben, deshalb stellte sie empört den Rat zur Rede. „Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu“ ereiferte sie sich „habt ihr nicht genau hingesehen, seid ihr alle blind, habt ihr nicht bemerkt, dass ich die Schönste bin?“ Sie bekam freundlich aber dennoch ermahnend zur Antwort: „Sicherlich bist du die Schönste hier, aber allein das Äußere galt hier nicht als Maßstab, sondern es wurde auch die Schönheit des Herzens beurteilt“. Das war zuviel für Hildegunde. Total außer sich vor Wut und mit den drohenden Worten: „Schönheit des Herzens, lächerlich, ich werde euch zeigen, zu was mein Herz alles in der Lage ist“, verließ sie die Veranstaltung. Der Ruf der Elfen unter den Menschen und Tieren war, dass sie liebenswert und hilfreich sind, und genau diese tausendjährige Erfahrung wollte sie nun zerstören. Sie wollte erreichen, dass die Menschen alle Elfen so sehr hassten, dass es kein Miteinander mehr geben sollte. Hildegunde sammelte alle ihre Zauberkräfte zusammen und setzte ihre teuflischen Pläne einen nach dem anderen in die Tat um. Zuerst setzte sie den Wald in Brand und brachte damit die Holzfäller im Dorf und ihre Familien um Lohn und Brot und das Wild um dessen Behausungen. Dann ließ sie das Meer über die Ufer treten und zerstörte damit all die kleinen Häuser, Ställe und Scheunen der Menschen. Aber sie hatte immer noch nicht genug. Ihr nächster und grausamster Racheplan wurde ihr dann selbst auch zum Verhängnis. Als sie den klaren See, an dem die Kinder immer so gerne spielten und badeten, zum kochen brachte und damit alle Fische, die darin schwammen und alles andere Getier tötete, fällte der Ältestenrat eine schwerwiegende Entscheidung. Hildegunde musste ein für alle Mal Einhalt geboten werden. „Auch wenn sie eine von uns ist und uns es nicht zusteht über andere zu richten, müssen wir die Menschen und vor allem Hildegunde vor sich selbst schützen“, beschloss der Rat und verurteilte die Elfe den Rest ihres Lebens im eisernen Berg, der mitten im Meer stand, für immer eingeschlossen, einsam und allein zu verbringen. Die Elfe nahm das Urteil mit versteinerter Miene an. Willig ließ sie sich ihre Flügel abnehmen und zu ihrem eisernen Verließ geleiten. Als man sie dort eingeschlossen hatte, verriegelte der Rat den Berg und überließ Hildegunde ihrem wohlverdienten Schicksal. Viele Jahre sind seitdem vergangen. Im Land der Elfen kehrte wieder Ruhe und Frieden ein. Der Wald wuchs langsam nach und bot den Tieren, die dort lebten, wieder Schutz und Unterschlupf, und die Menschen hatten ihre durch das Wasser vernichteten Häuser neu aufgebaut, und viele Generationen sind nachgekommen. Nur ein kleines Fischerdorf ist seit Jahren nicht mehr zur Ruhe gekommen, denn die Hand des Todes hatte die Einwohner fest im Griff.
DAS LEBEN DER HOCHGRÄFIN GRITTA ...
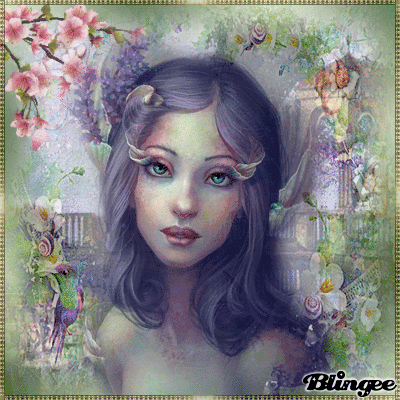
Es war einmal ein altes Schloss, umfasst von hohen Bergen, das selber auf einem hohen Berg lag, etwas niederer als die ihn umgebenden. Wie ein Ring umschloss das Tal den Berg, und in einem Ring umschlossen die dunklen felseckigen Berge das Tal. Aus ihren Moosrinden wuchs hie und da spärliches Binsengras hervor; unten im Tale lief hie und da ein Bächlein durchs Grün an hie und dort einem Gebüsch vorüber, die Wurzeln spülend. Oben im Gezweig guckten junge Vogelköpfchen aus den Halm- und Mutterfederflaum-Nestchen dem harmlosen Dahinrollen unten zu, und war der Bach artig, so erzählte er ihnen leise Märchen, und sie taten zuweilen einen Piep des Wohlgefallens dazwischen; kurz, es war ein schönes Leben in dem Gebüsch. - Bald flog eins in den Lüften oder sang lieblich; sie hatten sich hier ungestört und häuslich zufrieden niedergelassen. Es war ein Ausweg aus dem Tal, der ganz überbaut war von Felsen; manchmal sah man in Mitten der Berge in den Eingang einer engen dunklen Höhle, und an verschiednen Orten stürzten kleine Gießbäche heraus, grade hinab ins Tal, brausten dort heftig auf und verloren sich leise murmelnd. Die Grundmauern des Schlosses bauten sich dicht am Rande der Felskuppe schräg in die Höhe, in kahlen Wänden, zuweilen durch ein Fensterloch unterbrochen mit alten Eisenstäben verwahrt, mehr für Ratten als für ein Menschengesicht. So erschienen die Wände auch belebt, wenn in schönen Abendstunden die Welt hochrot gefärbt war und die dunkeln Berge von mattem Rosenschimmer bestrahlt; da regte sich die ganze Burg. Es war ein Getümmel von Begraurockten; da balancierten die jungen Ratten auf der schrägen Wand, da kam eine Rattenmutter mit sieben Jungen, die sollten die Abendluft genießen, dort ein dicker Rattenklausner oder gar ein vielköpfiger Rattenkönig; bis zuletzt ein graues Gewimmel die alten Mauern deckte. Dann sah es wohl von weitem aus, wenn sich die Abendsonne in einem Schlossfenster spiegelte, als leuchte sie den alten Steinen - denn dafür hielt man die Ratten in der Ferne - zum Abendtanz, und man hatte Angst, sie würden einmal ganz davon laufen und den Besitzer ohne Besitz lassen. Es waren auch Türme an den Ecken, aber zerfallen, außer einem, der noch zierlich an das alte Nest geklebt war; aber aus den gotischen Rosen und Linien der Verzierungen wuchs Gras und Moos.
Dies war das Schloss von einem alten Grafen Rattenzuhausbeiuns, der mit einem Töchterchen dort wohnte. Ein schmaler Steg, wie man ihn sonst über die Bächlein legt, führte von einem vorragenden
Fels aus, grade über den Talabgrund, vor die kleine Holztür des Schlosses, der ein Holunderbaum mit seinen Blüten zur Seite nickte. Der Wurm hatte viele Löcher hinein gebohrt, und die Spinnen
viele Decken darüber gewebt. - Heute tönte schon das fleißige Rädchen Grittas herab, wie es schnurrte. Es kam ein Steingang, spitz und dunkel zugewölbt, mit verschiednen Löchern für Ratten und
Mäuse; dann ein gewundnes Treppchen hinauf. Hier saß die kleine Hochgräfin Gritta, der emsig das Rädchen den feinen Faden aus den Fingern zog, während sie träumerisch zuschaute, und hier war am
Ende des Ganges eins der drei Fenster des Schlosses zu finden, das rund und halb voll grüner Scheiben, halb mit dem halben Leibe des Ritters St. Georg, im blauen und roten Gewand, und dem des
Drachen gefüllt war; auf dem Fenster stand ein Krügelchen mit Nelkenschößlingen, und die Sonne fiel durch den blau und roten St. Georg auf den hochgräflichen Goldblondkopf und spielte in
wundermilden Farbentönen auf dem Steinboden, ihn erwärmend, obwohl es noch ziemlich kalt im Gang war.
Es war eine zerfallne Tür, aus der jetzt der alte Mann Müffert, der Diener des Grafen, mit einer dampfenden Schüssel Hirse in Händen, auf das Kind blickte: "Ein Blümchen das blüht, ein Herz das
so gut ist! - Soll sie wie ihre arme Mutter hinter diesen Mauern verblühen? - Wenn der Graf noch so lange an seiner Maschine baut! - Was jung ist, braucht Junges, um mit ihm zusammen zu sein."
Dies war das halblaute Selbstgespräch Müfferts; er sah sich scheu um, als fürchte er, gehört zu werden, dann fuhr er lauter fort: "Da lauf, Kind, und trag schnell die Schüssel dem Vater hin!" -
"Schon jetzt?", fragte die kleine Hochgräfin langsam, aus den altdeutschen grauen Ritteraugen mit schwarzen Wimpern einen ziemlich hasenmäßigen Blick durch die von der Sonne durchschimmerte
Dampfwolke der Hirse zu Müffert sendend. "Ei, ich wollt auch, es wären noch vierundzwanzig Stunden davon und blieben es ewig, denn heut muss ich dran." Somit nahm die kleine Hochgräfin den Napf
in Empfang; wer diesen genauer ansah, erkannte darin den Schild eines erprobten Rittersmanns; eine halb verrostete Rose zeigte noch Kampfspuren. Hätte der kühne Ritter je gedacht, dass sein
Schild später zu so entsetzlichem Dienst gebraucht werde? - Sie ging langsam und leisen Schrittes einen Gang hinein, einen hinaus, bis sie sich einem brummenden Hämmern und Bohren immer mehr
näherte; nun trat sie vor eine wunderliche, in Eichenholz mit kleinen Drachen und Gesichtsmasken geschnirkelte Tür. - Sie fasste sich ein Herz und zog an der schweren eisernen Klinke. Es öffnete
sich die Stube, in der das zweite und vorletzte Glasfenster des Schlosses war; da hingen Hammer und Zangen und Zängchen und tausenderlei wunderliche Werkzeuge, teils an der grauen Wand, teils an
langen Bindfäden von der Decke ins Zimmer herab; alte Folianten, altes Uhrwerk und Gerümpel, von Spinnweben überzogen, vom Holzwurm zernagt, lag an der Wand entlang. Das Hauptstück war ein
weißseidner Bettschirm, mit dem Paradies darauf gestickt in greller Seide; die Äpfel lachten recht daraus hervor. Der Hochgraf hatte sie zum Ziel seiner Bolzen gemacht, und Adam und Eva waren
dabei in höchst invaliden Zustand geraten. Der Graf, in Schweiß, heftigen Zorn im Gesicht, mit einem Instrument in der Hand, stieß es hie und da in eine sonderbare, fast wie ein alter
Großvaterstuhl aussehende Maschine, die davon sich dehnend zu bewegen und zu krümmen schien, bis zuletzt das Sitzkissen emporsprang - sprang, sprang und wieder sprang, wobei der Graf allemal ein
sehr zufriedenes Gesicht machte. Er warf einen Seitenblick auf die kleine Hochgräfin: "Kommt Müffert bald?" - "Vater, ich setze Euch hier das Essen auf den Stuhl hin." - Sie setzte den Napf auf
den einzigen im Zimmer befindlichen Stuhl und holte einen alten Krug aus der Ecke, den sie dazu setzte. "Und", fuhr sie nachdem fort, "dürft' ich nicht heute für den alten Müffert springen? - Ich
bin so leicht", sagte sie, sich furchtsam ihm und der Maschine nähernd. - "Nichts da!" sagte der alte Graf zornig, indem er die Augenbrauen bis zur Spitze seiner Nase herabzog. "Nichts da,
Müffert springen! Nichts da! dummes Zeug!" - Es traf sie sein zorniger Blick. - "Dummes Zeug!" - Sie flog zur Tür hinaus.
Der Graf hatte das Maschinenwerkwesen, als er jung war, nicht aus Lust erlernt, aber es war eine alte Sitte in der Familie. Er hatte nämlich einen Ururururgroßvater, der, weil er viermal Ur war,
das Uhr- und Maschinenwerk von Grund auf verstand; er wurde wegen einer Maschine, mit welcher er Peter dem Vorersten einen Leibschaden heilte, zum Grafen zu Rattenweg ernannt, welche Familie
damals vom Hofkammerjäger verjagt und ihres Standes oder ihrer Löcher entsetzt war wegen eines majestätsverbrecherischen Komplotts oder vielmehr Zuckerfressereiversammlung; als diese aber nach
dem Aussterben der Familie vom Hofkammerjäger sich wieder häuslich eingenistet hatte, blieb dem Grafen, der von einer Belehrungsreise, zum Beherrschen vieler Untertanen, die er vor seiner Abreise
noch gehabt hatte, zurückgekehrt war, nichts übrig als das alte Schloss, belastet mit vielen Ansprüchen, welche die ausgebreitete Rattenfamilie dort geltend machte, und darum nannte er sich Graf
zu Rattenzuhausbeiuns. Hier fällt ein Schleier über seine öffentliche Geschichte. Er verheiratete sich mit einer jungen Gräfin Mauseöhrchen, wohnte mit ihr auf dem alten Schloss, und mit
Leidenschaft trieb er dort bei verschlossenen Türen etwas, wovon selbst sein alter treuer Diener nichts wusste, denn es waren nur Bücher und Werkzeuge darin; bis eines Morgens Müffert vor der
Türe erschien und meldete, der Hirsevorrat, von dem sie bisher gelebt hätten, sei alle geworden. Der Graf machte jetzt aus der Not eine Tugend und arbeitete fleißig an einer Haferschneidemaschine
für einen reichen Bauern, der ihm den Bedarf an Erhaltungshirse darauf vorstreckte; er legte große Ehre mit dieser Maschine ein.
Um diese Zeit schrieb Seine Majestät der König an verschiedene Maschinenwesengesellschaften seines Reiches, sie möchten eine Rettungsmaschine anfertigen lassen, und wem es gelänge, dem werde der
Maschinenwerkmäßigorden erster Klasse mit Eichenlaub erteilt. Der Graf hatte davon Nachricht erhalten und arbeitete viele Zeit, bis auf diese Stunde daran. Es hatte indes keiner vor ihm dies
Kunstwerk zu Stande gebracht, und der Monarch zitterte noch auf seinem Thron. Während dieser Zeit war ihm ein Kind geboren, sein Weib gestorben, Gedanken gekommen und wieder gegangen, während der
Winterwind um das alte Schloss tobte, und der Frühling knospte, und der Herbst seine Laubblätter abstreifte; während der Schnee die Türmchen und Zinnen des Schlosses schön verzierte, und die
kleine Gritta das verfrorne Näschen nur selten aus der Fensterluke steckte. Er hatte sich nach einer durchforschten Nacht oft am frühen Morgen aus tief mystischen Büchern einen Gedanken
ausgegraben und ihn den Tag bei seiner Maschine mit durchgearbeitet. Deswegen sei er wohl klüger wie andere Leute, meinte Müffert.
Eben erschien Müffert mit einem kläglichen Gesicht; er hatte nun schon ein Jahr lang, einen Tag um den andere mit Gritta in der Rettungsmaschine Springversuche machen müssen. Sie war ein leichtes
Ding und flog so, dass sie gewöhnlich bloß mit vielen blauen Flecken und aufgestoßnem Ellbogen am Kümmeleckchen davon kam; aber Müffert erwartete jedes Mal seinen Tod von der Rettungsmaschine,
weil er jedes Mal hart fiel beim Fliegen. - Jeden Tag wurde die Rettungsmaschine etwas höher geschraubt; sie bestand nämlich darin, dass sie einen im Augenblick der Gefahr von der gefährlichen
Stelle durch einen leisen Druck wegschleuderte. Der Graf laborierte seit einem Jahr daran, dass die Maschine bei diesem Wegschleudern einem nicht wehe tue; dies sollte durch den wohlberechneten
Bogenschwung bewerkstelligt werden. Alles was in die Nähe des gestrengen Herrn kam, musste springen, Mensch und Tier. - Es stellte sich der Graf in einiger Entfernung; heute war die Maschine
höher als je gespannt. Müffert setzte sich auf den Sessel, nahm Mut, wenn er welchen fand, drückte und sauste durch die Lüfte hoch - und blieb an einem weit aus der Wand ragenden Stock hängen,
der, schön ausgeschnitzt und mit eingelegten Messingfiguren verziert, wahrscheinlich früher zum Halter einer Ampel gedient hatte. Jetzt hing ein langer Faden mit Fliegenleim daran herab, und
Müffert hing in Gesellschaft der Summenden und Brummenden, ängstlich in die Tiefe schauend, über die er sonst in einem Bogen weg flog; aber jetzt war er in höchster Höhe hängen geblieben; so
schwang er sich rittlings auf den Ampelhalter. Der Graf sah mit großen Augen zu, war zornig, und rief "Kuno Gebhardt Müffert, du gleichst schier einem Lämplein, dass du so hängen bleibst." -
"Jetzt komm einmal, Kleine, du bist von meinem Fleisch und Blut, spring ordentlich!" - Der Graf hob die kleine Gritta auf die Maschine: "Da", sagte er, "ich will sie auch ein wenig niederer
schrauben." - "Vater", rief Gritta, "sie ist doch heute so hoch." - "Ach was", sagte der Graf und brummte; fix griff die kleine Gritta zu dem Knopf, drückte und sprang; aber es ward ihr so angst,
des armen Müffert Beine schwebten dicht über ihr, sie griff zu und blieb aus dem Schwung gebracht daran hängen. "Oh", schrie der Vater zornig, "war das mein Bein, was da hängen bleibt, mein Bein
und Fleisch?" - Während dieser Worte hatte Müffert die zitternde Gritta zu sich aufgehoben und setzte sie nun in ein kleines Mauernischchen neben an, zu einem uralten zerbrochenen
Muttergottesbild. Da saß sie, unten der erzürnte Vater; grad herab konnte sie nicht springen, ohne Hals und Beine zu brechen; das sah er ein. - Zürnend setzte er sich zur Hirse: "Und wenn du
herunterkommst", fuhr er fort, "so schmeckst du die Rute, so viel Reiser werden doch wohl am hochgräflichen Rutenstammbaum draußen wachsen, um einer kleinen mutlosen Dirne das Blut etwas
schneller zum Hasenherzen zu treiben." - Ein Löffel Brei nach dem andere verschwand hinter den zürnenden Lippen des Grafen, indem er sich noch bedachte, wie er sie wieder herab kriegen solle.
Nachdem die Hirse alle war, entfernte sich der Graf, einen Balken oder sonst etwas zu finden, um eine Leiter daraus zu machen. Ach, Müffert wusste wohl, dass im vorigen Winter alles, was sich nur
von solchen Dingen im Schloss vorfand, wegen der großen Kälte, verbrannt worden war.
Der Mond schien durch die Fenster in den alten Saal; das Gerümpel warf sonderbare Schatten, und oben hob sich ein leises Geflüster, zwischen dem alten Müffert, der auf dem Ampelhalter ritt, und
Gritta im Wandnischchen. Sie saßen noch so, weil sich nichts zum Heruntersteigen gefunden und ihnen noch bis jetzt nicht eingefallen war, wie sie herunter sollten kommen. "Kind, du bist wohl
hungrig", hob Müffert an, "ich hatte dir doch das Töpfchen zum Auskratzen hingestellt." - "Nein, ich bin satt, aber, Vater Müffert, es wird dir wohl recht schwer auf deine alten Tage zu reiten,
willst du nicht hier in das Loch kriechen?" - "Ich sitze hier zwar sehr schlecht, aber bei dir würde ich auch gar zu krumm sitzen." - Sie schwiegen wieder eine Weile. - "Horch, mir ist, als läuft
da was!" sagte Gritta. - Es huschte etwas durchs Zimmer! Alles war still. - Der Holzwurm pickte. - Es nagte am alten Gerümpel. - "Guten Abend, Ringelschwänzchen", tönte eine sonderbare kleine
feine Kehlstimme; da ging eine Wolke vor dem Mond weg, eine dicke graue Ratte mit glänzenden kleinen wunderschwarzen Augen, saß da im Mondlicht. - Gritta stand das Herz still vor Angst und
Staunen. Bald kam eine andere in die Mitte des Saales dazugelaufen. "Guten Abend euch wieder, was machst du, alte Muhm", pfiff die zweite Ratte mit feiner Stimme. "Nur nicht zu laut! - Ich bin
heute traurig. Weißt du was? - Es sind jetzt gerade sieben Jahre, da lag eine kranke junge Frau hier; das war die Frau des alten Grafen. Sie war krank und schwach. Der Mond schien auch so durch
die Fenster. Neben ihr lag ein Kindchen, das war sechs Wochen alt, und sie schob den Vorhang von ihrem Bette, obschon sie sehr schwach war, und schaute das Kindchen an. Der Mond schien auf ihr
bleiches Gesicht, und sie sah voll tiefer Liebe auf das Kind. Eine kleine Zähre entfloß dem Rattenauge. "'Wer wird es schützen, wenn ich gestorben bin? Keiner wird es erziehen und führen auf der
Bahn des Lebens, die oft so traurig ist', sagte sie leise. Ich hüpfte auf des Bettes Rand", - die Ratte trocknete eine Träne mit ihrem Schwänzchen ab, und Gritta rührte sich weinend voll stummen
Staunens, - das musste ihre Mutter gewesen sein. - "Hörst du nichts, Kind?" sagte die alte Ratte. "Ach nein, Muhme, ich werde mit meinen jungen Ohren doch wohl besser hören als Ihr mit Euren
alten!" - "Nur nicht zu vorschnell, Naseweis", sagte die alte Ratte und erzählte weiter: "Ich legte meinen Schnauzbart dicht an und machte ein so mildes Gesicht wie möglich. Sie erschrak zwar
erst, aber ich sprach: 'Liebe Fraue, hochgeehrte Frau und Hochgräfin, liebe Erdenbürgerin: zwar ist eins von uns nur ein kleines Geschöpf, aber zusammen vermögen wir viel. Wir sind auch mit
Weisheit, Spitzfindigkeit, Speckfindigkeit, Klugheit und Bohrkraft von Gott begabt. Was wir Ratten tun können für Euch und Euer Kind, das verspreche ich Euch in meinem und meiner Brüder Namen;
denn Ihr seid ein gar holdselig Geschöpf Gottes, unverdorben aufgewachsen, Eurer Natur nach wie die Blume auf dem Feld, und die Ratte im Löchlein hat still gelitten von Eurem oft zornigen
Gemahl.' Sie schaute mich freundlich an und sprach gar liebliche Worte, ich sollte für ihr Kindchen dort sorgen; sie vertraue auch zumeist auf Gott, und so weiter. Ich versprach es ihr heilig und
teuer mit einem Rattenschwur; sie dankte so viel und strich freundlich über meinen Pelz - Ach, wie tat mir die sanfte Menschenliebe von ihr wohl! Ein paar Tage darauf trug man sie hinaus." - Es
war eine Pause, während welcher Gritta Zeit hatte, sich leise auszuweinen. "Das Kindlein schrie alleine, und der Graf ließ es auch und war halbe Tag lang hinweg; wie oft steckte ich meinen
Schwanz in den Milchtopf und flößte ihm die Milch in den Mund oder bepuderte mein Bärtlein mit Zucker und ließ es davon genießen; wie oft schüttelte ich sein Kopfkisschen auf und brummte es halbe
Nächte durch in Schlaf. - Du weißt, jetzt wuchs es und wurde größer; wir ließen es nun, denn es gedieh gut, höchstens lief ich hinter ihm her; und wenn es drohte zu stolpern, biss ich schnell in
sein Röcklein und hielt es fest. Ich habe oft in alten Büchern nachgesucht, die Sonnenstäubchen gefragt, die lang in alten Büchern gelebt und studierte Leute sind, über die kommenden Jahre; auch
die alte Spinne dort in der Ecke hat mir geholfen. Es kommt ein schlimmes Jahr für uns und das kleine Burgfräulein, und das andere Jahr um diese Zeit wird ein lustiges Fest, aber am Anfang -
bst!" - Der alte Müffert drehte sich um auf seinem unbequemen Sitz und ritt nun wie eine Dame. - Augenblicklich waren die beiden Ratten verschwunden. "Hast du gehört?" rief leise Gritta. - "Was?
- Die beiden Ratten hab' ich gesehen; aber du weißt, ich höre schlecht, haben sie gepfiffen?" - Gritta schwieg. - "Ach", sagte Müffert, "es wird mir gewaltig schwer, hier zu reiten, und ohne
Schlaf." So verging die Nacht. Gritta schlief in ihrer Mauernische ein, trotz ihrer Aufmerksamkeit, etwas mehr zu hören. Am Morgen schien die Sonne durchs Fenster. Es war ihr wie ein dunkler
Traum, der vor den Sonnenstrahlen nur noch mehr zerstiebte und sich ganz verlor, als sie den alten Müffert erblickte, der so jämmerlich hauste. Endlich erschien der Graf; er machte die Tür auf,
lief auf seine Maschine zu und fing an zu hämmern; es summte und brummte, die beiden Gefangnen saßen oben, schon eine halbe Stunde hatte es gedauert. "Ach", sagte Gritta, die den bleichen Müffert
ansah, "der Vater erinnert sich nicht mehr an uns, soll ich etwas hinunter werfen, damit er aufsieht?" - "Ach, er wird sehr zanken, lass mich, ich will Lärm machen." - "Nein!" sagte Gritta. Es
erhob sich ein edler Wettstreit, endlich nahm Gritta den Fußschemel der Maria und ließ ihn herunter fallen, das einzige, was da war. Der Graf hörte nicht. "Hm, Hm!" räusperte sich Müffert; Gritta
suchte um sich, nach etwas, das sie bewegen könne. "Miau!" machte Müffert "Miau!" sagte Gritta. Der Graf schaute um und auf. "Ach, ich hatte euch vergessen!" lachte er, halb grinsend vor
Vergnügen, als er die mühsame Positur des Müffert sah. Nachdem er sich einige Zeit besonnen hatte, sagte er, dass er ins Tal gehen wolle und den Müllersknecht vor dem Durchgang holen. Er ging
hinaus, öffnete die kleine Pforte, schaute sich um vom Fels aus in die Weite und wanderte dann den steingewundenen Pfad, der um den Berg führte, zum Tal hinab; unten im Tal lag noch der Nebel,
die Vögel sangen oben drüber, und die Gräser blitzten vom Tau. Je tiefer er herab kam, je dichter war der Nebel, nur einzelne Sonnenstrahlen brachen hindurch, auch durch des Grafen Seele, durch
alten Staub des Missmutes, durch den Rost der. - Aber siehe da, seine Füße standen im Wasser, und gleich zornig wieder, rief er, "Potz alle Nebel nicht nochmal!" Darauf flogen noch mehrere sehr
unglaubliche Reden aus seinem Munde. - "He! Herr! Hier!" rief eine frische Knabenstimme. Der Nebel zerteilte sich im Augenblick, und die Sonne erhellte das runde rote Gesicht eines Bauernknaben,
in dem die dunklen Kohlenaugen gleich Wundersternen funkelten, welch ergötzliches Gesicht von einem weißen Zipfelmützchen nebst rotem Rand eingerahmt; er war mit einer blauen abgeschabten Jacke
und von Tau und Schmutz bis an die Knie reichenden Hosen bekleidet. Kurz: Sonne, Regen und Wind hatten an dem Kleinen ihre weitberühmten chemischen Kunststücke und Prozesse vollführt.
................................................................................
Die Augen des Knaben ruhten auf dem Grafen, mit erstauntem Erstaunen über die seltsame Gestalt. - "Dummes, bauernhaftes Schafsgesicht", rief der alte Graf, der jetzt auf einem Steine stand, "hilf
fix!" Der Junge, wahrscheinlich nicht erwartend, in der Morgensonne ein so erzürntes Gesicht zu sehen, rief langsam seinen Hund zur Bewachung seiner Gänse und las Feldsteine, die er schrittweise
in den Sumpf warf. "Kleiner Bauernflegel", rief der Graf mit großer Herabschätzung, "eil' er sich, ich lasse nichts ohne Belohnung." - Der Knabe war fertig, und der Graf setzte von Stein zu Stein
herüber. Die Gänse kriegten einen so großen Schreck, dass sie schnatternd nach allen Seiten entflohen. Nachdem der um seine Gänse in große Angst geratne Knabe dem Grafen den Weg gezeigt, murmelte
dieser ein paar ärgerliche Flüche, griff in die Tasche und wollte etwas herausholen, griff sehr tief und fand endlich etwas, was er dem sich sträubenden Bauernjungen in die Hand drückte, mit der
nochmaligen Bedeutung, er nehme nichts ohne Belohnung an. Dieser fand in seiner Hand einen alten abgerissenen Knopf, den er dankbar einsteckte, aber lieber ein freundliches Wort als Lohn gehabt
hätte, und seinen Gänsen nachlief. Der Graf war am Ende des Felsganges, als er meinte, deutlich das Stampfen von Roßhufen zu hören; er spitzte die Ohren, und bog um die Ecke. Die Sonne schien in
aller Pracht vor den erstaunten Augen des Grafen auf einen glänzenden Reiterzug herab, vor dem Müllerhaus. Pagen mit runden, rosenrot angehauchten Wangen, blauen, braunen, schwarzen Augen, grün
und rot wehenden glänzenden Federbüschen, saßen auf jungen frischen Gäulen, in der Mitte eine Dame, fröhlichen stolzen Mutes mit einem milchweißen zartgefärbten Angesicht, wiegte sich im grünen
Kleide mit silberbesponnenen Knöpfen auf einem schönen Fuchspferd. Der erstaunte Graf knöpfte seinen Rock, der aus den schweinsledernen Einbänden der Schloßbibliothek bestand, über seiner Weste
von Pergament zu, die in schöner Schrift mit Schnörkeln gemalt war, und näherte sich dem Zuge des jungen Fräuleins. Das Fräulein schnitt ein Gesicht; die Pagen schnitten es ihr nach, als der Graf
ihr eine echt ritterliche, vielleicht etwas veraltete Verbeugung machte; sie streckte ihr Näschen in die Morgenluft, als wittere sie etwas was ihre Lachlust reizen könne. Unter den Pagen
offenbarte sich ein fröhlicher Mut ihr nachzukommen; sie streckten alle die dünnen, dicken, kühnen, stumpfen und gebognen Nasen eben so in die Luft, aber mit dem Mund waren sie bereits schon im
Lachen. Die Dame verwies dies mit einem derben Ellbogenstoß einem dicht neben ihr reitenden Pagen, der diesen weiter sendete, bis sie alle mit ernsten Gesichtern auf ihren Rossen saßen. Der alte
Müller wendete sich jetzt an den Grafen und sagte, die Dame habe sich verirrt; sie wolle gern den Weg wissen; er habe aber noch nicht erfahren, wo sie her sei. - "Hochverehrtes und gnädiges
Fräulein, wenn Ihr mir sagen wollt", hob der Graf an, "von welchem Orte Ihr ausgeritten, so werde ich Euch einen - meiner - Diener zum Geleite geben. Wollt Ihr jedoch hier auf der Mühle erst
ausruhen oder auf mein Schloss, welches sehr schön gelegen, kommen, so lade ich Euch aufs Dringendste ein." - Er glaubte wohl, dass dies nicht geschehen konnte, weil sie, ein junges Fräulein
doch, zu ihren Eltern zurück musste; aber zu seinem großen Erstaunen sagte sie zu, sie wolle nur erst etwas Milch in der Mühle trinken, und legte ihre zarte weiße Hand auf des Grafen Schulter
beim Herabsteigen. Der Graf, entzückt darüber, vergaß auf einmal eine Wegweisermaschine, die ihm die ganze währende Zeit im Kopf rumorte, und sah mit ungewöhnlich sonnigen Blicken der jungen Dame
ins Angesicht. "Erlaubt, Fräulein, dass ich erst jemand hinaufschicke, Euren Empfang zu bereiten. - Nachdem er sie hinein gebracht, schickte er den Müllerknecht fort mit einem Strick für die
Gefangensitzenden und mit der Weisung, die Diener sollten alles in Bereitschaft halten.
Oben saßen die Zwei noch im Saal und schauten von der Höhe, als der Müllerknecht mit lachendem Gesicht beiden verkündete, der Herr Graf von Rattenzuhausbeiuns lasse seinem getreuen Diener sagen,
er möge alles in Bereitschaft halten zum Empfang einer jungen Gräfin; er möge nichts sparen und alles seinem Stande gemäß ordnen. "Ah!" sagte Müffert sehr ernst, "ich habe den Schlüssel zur
Schatzkammer verloren." - "Der Müller", fuhr der Knecht fort, "lässt Euch hier ein paar Brote schicken, wenn man etwa der Gräfin etwas vorsetzen wolle; die Bezahlung ist nicht nötig", setzte er
treuherzig hinzu, und reichte ihnen an einer Stange den Strick hinauf. Müffert befestigte ihn an dem Ampelhalter und fuhr daran herab, Gritta ihm nach. - Er wurde neugierig gefragt, wie die
Gräfin aussehe, die das Schloss besuchen wolle. Dann musste er Wasser holen aus dem Schloßbrunnen, und die kleine Hochgräfin schwemmte damit recht tüchtig vom höchsten Gang bis an die
Schloßpforte den Boden ab, so dass alles reinlich glänzte. In des Vaters Zimmer, wo sie nun endlich räumen durfte, fanden sich unter dem Gerümpel noch manche schöne Sachen, die stellte sie alle
in Reih' und Glied auf. Es wurden Kränze gewunden und alles damit geschmückt. Aber nun, was sollte werden, wenn die Gräfin hier schlafen sollte! Gritta kannte nur Moosbetten, aber Müffert war
verlegen! "Ei was", sagte Gritta, "wir machen ihr ein recht schönes Moosbett mit Rosenblättern bestreut!" - Und so geschah es. Nachdem die kleine Brücke auch mit Blumengewinden verziert und der
kleinen Hochgräfin ihr Röckchen von Bibliothekseinband frisch eingeölt war, stellten sie sich vor die Tür. Endlich kam der Zug durchs Tal, der Graf zeigte schon aus der Ferne der Dame an seiner
Seite das Burgschloß; hinter ihnen die jungen Pagen fingen an zu zischeln, die junge Dame machte aber ein so ernstes Gesicht, dass es ihr bald alle nachmachten, obwohl sie zu glauben schienen,
die Gräfin verstelle sich, der Hauptspaß komme erst, und sie habe irgend einen lustigen Streich im Sinn. So kamen sie an die Brücke; ein kleines Lächeln überflog die Züge der jungen Dame, als sie
vom Grafen geleitet hinüberging und die kleine Gritta im Schweinslederröckchen erblickte. Die Pagen wollten das Lächeln in Lachen übersetzen, es wurde aber durch einen Ellbogenstoß verhindert;
die Gräfin gab ihr einen fröhlichen Kuss und wendete sie hin und her. Das Wunderbare, was ihre Aufmerksamkeit erregte, war, dass aus den Falten hier und da gepresste, oder goldne Schrift in
bunten Schnirkeln hervorsah; auf der linken Seite guckte aus den Falten "Das Leben und die Taten des hochedlen Herrn Ritter Kunz von Schweinichen, ihm nacherzählt --"; hier versteckte sich die
Schrift in die Falten. Auf dem Magen stand "Christliches Paradiesgärtlein zum Herumspazieren für christliche Lämmer von Johannes". - Nach hinten "Das Leben der christlichen Jungfrau Anna Maria
Schweidnitzer" und links "Das Buch, was da handelt von den Hexen und denen, so aus ihnen gefahren", ein ganzes gedrucktes Kapitel; indem sie das las, folgte sie dem Grafen ins Schloss, bis zu
seinem Saal mit dem einen Stuhl. Der Graf behauptete, das geschehe aus Ehrfurcht, dass bloß ein Stuhl da sei, damit die Herren in der Dame Gegenwart sich nur knien und zu ihren Füßen setzen. Die
Gräfin fand das sehr artig, die Leute zur Höflichkeit zu zwingen. "Und was ist denn das?" rief sie, vor dem aufgestellten Gerümpel stehend.
"Das sind fremde Merkwürdigkeiten; dies ist der Köcher eines Indianers", sagte der Graf. Er sähe einem von Würmern zerfressenen Stuhlbein nicht unähnlich, behaupteten die Pagen; aber ein Wort der
Gräfin machte es zum Köcher sogar mit Pfeilen, und der Graf erklärte noch bis zu Tische alle japanischen, hottentottischen Merkwürdigkeiten. Hier hieß es aber nicht zu Tische, sondern zu Boden;
denn der Graf ließ die Tische durchaus nicht aus der Möbelkammer, weil es hier im Schlosse Sitte sei, dass man zur Verehrung der Dame auf dem Boden sitze beim Essen. Die Gräfin freute sich sehr
darüber; die Pagen fragten, ob diese Sitte aus Paris wäre oder aus dem Paradies, wo bekanntlich Eva den Apfel angebissen, weil sie kein Messer gehabt. So aßen denn alle auf dem Boden; der Graf
hielt der Gräfin den Teller vor. Das Geschirr war nicht sehr vollständig, darum aßen einige aus Töpfen, andere aus Helmen, einer gar aus der Mausefalle; auch waren die Speisen nicht sehr
mannigfaltig, sie bestanden aus Hirsebreisuppe, Hirsebreiklößen, Hirsepudding u. s. w. Doch der Graf meinte, aus einfachem Geschirr schmecke alles am besten, und vielerlei Speisearten verderben
den Magen. Und somit war's gut. Die kleine Hochgräfin half draußen kochen und wollte nicht unter die neckenden Knaben, die immer riefen: "Komm, klein Paradiesgärtlein! He, Herr Ritter Kunz von
Schweinichen!" Am Abend ward den Pagen ein ganzer Gang voll Heu gestreut, wo sie wie ein Regiment neben einander Parade schliefen. Die Gräfin versteckte sich lachend in ihr Mooslager, und die
goldne Ruh' kam dazu.-- Am andern Tag sagte die Gräfin, die Leute brauchten nicht so großen Respekt vor ihr zu haben, wenn der Graf nur ein paar Bänke habe zum Sitzen; aber der Graf hatte den
Schlüssel zur Möbelkammer verloren. So war ein lustiges Leben in der alten Burg eingezogen, sie tanzte des Abends, sie sang dem Hochgrafen Lieder, lachte und machte Sprünge und - der Graf vergaß
seine Maschine. Die Pagen liefen in allen Gängen und Plätzen umher, alles mit munterem Geschrei erfüllend. Gegen Abend wohl des dritten Tags stand die kleine tolle Gräfin an der Seite des Grafen
vor dem großen Fenster und schaute in den Himmel, der mit sanftem Rosenrot glühte über den Bergen mit dunklen Tannenwäldern. Ihr kleines Herz schlug höher, und die zärtliche Hand lag auf des
Grafen Arm; die Pagen spielten im Hintergrund mit den japanischen Merkwürdigkeiten Ball, eine rötliche Dämmerung erhellte alle, nur einige hatten sich in eine der dunklen Wandtiefen gesetzt und
plauderten leise. Da auf einmal öffnete sich die Tür, Gritta steckte den Kopf herein, wollte etwas sagen, wurde aber gleich verdrängt. Ein kleiner dicker Herr, mit weißer Perücke, aufgepudert,
mit stolzem Vorbau, stand schweißtriefend, wie vom Donner gerührt da, als er in die wilde Wirtschaft des Zimmers sah. - "Ziemt sich das?" - presste er heraus, noch außer Atem. "Kaum lässt man Sie
allein mit dem Gebot, recht artig zu sein, ja kaum lässt man Sie allein, so laufen Sie davon. Eine Gräfin vom altadeligen Geschlecht der Rattenwege davon. --" Er musste einen Augenblick
verschnaufen. Die Pagen stellten sich ängstlich in eine Reihe hinter ihre Herrin auf, die den Mann auf seinen Bauch ansah, als könne sie sehen, was er heute gespeist. - Zürnend fuhr er fort.
"Ich, Ihr Vormund, von der wohlweisen Ratsversammlung zu Prag dazu eingesetzt! - Ich! - Ich finde Sie nicht zu Hause auf dem Schloss und den Verwalter muss ich fragen! Ich! - Wo ist das Fräulein?
Alle sagen, sie ist seit zwei Tagen fort, fort, fort!" - Er stampfte bei jedem "Fort" heftig auf den Boden. -- "Es waren schon Boten nachgeschickt, die aber bloß mit Nachrichten zurückkamen, was
wir zu bezahlen hatten wo Sie durch die Saatfelder geritten, bis ein - ja, ein Bauer die Botschaft brachte, er habe Sie hier gesehen, - und bei einem Feinde Ihres Geschlechtes, Ihrer Familie!"
"Kommen Sie einmal mit, Herr Vormund", sagte sie, indem sie ihn zwischen den erschrocknen Pagen durch neben an in eine alte Rüstkammer führte. - Bald darauf ertönte das heftige "Ich will" ihrer
Stimme und des Vormunds Geschrei: "Sind Sie toll?" - Alles stand gespannt! - Erzürnt zog nach einer Weile der Vormund sie ins Zimmer. "Und ich will und ich will den Grafen heiraten, und wenn Sie
auch nicht wollen, so ist mir es einerlei!" - Der Graf fasste verlegen an seine Nase; ihr kleiner Mund erstickte fast vor "Ich will!" - "Aber Sie sollen jetzt mit", sagte der dicke Herr. - "Ja,
jetzt, aber ich komme wieder, wenn ich mit den zwei andern Vormündern gesprochen habe, und wenn sie nicht wollen, so laufe ich davon." Sie warf noch dem Grafen einen listigen Blick zu, dann bot
ihr der Vormund den Arm und geleitete sie die Treppe hinunter, wobei sie mit zornigem Herabtrippeln mehrere Male den kleinen Herrn zum Stolpern brachte - "Aber bedenken Sie doch, meine Liebe, die
Sie den Schönsten bekommen könnten, mit einem so schönen Schnurrbart, und so vielen Goldstücken in der Tasche, denken Sie doch, Kind, so ein Zuckermännchen! -" sagte er fast weinerlich. - "O was!
Den kann ich mir von Zucker backen lassen. Ich will den Grafen." Die Pagen folgten, der Zug ging den Berg hinab. Der Graf stand allein in seinem Saal; es kamen ihm wunderliche Gedanken von einer
Maschine, womit man Vormünder durchprügeln konnte. Die kleine Gritta trat ein, die Sonne ging langsam unter, - leise das Zimmer färbend, - rötlich über die kühlen dunklen Berge hinabsinkend. -
Sie kam zum Vater und legte zum ersten Mal ihr Haupt an sein Herz. - "Wo ist meine Maschine?" fragte er. - "Dort steht sie!" - "Rücke sie heran!" Sie zog sie herbei. "Die Pagen haben den kleinen
Mops so viel darauf springen lassen; wenn sie nur nicht verdorben ist!" sagte Gritta. Der Graf holte sein Werkzeug und setzte sich an die Arbeit; bald hämmerte und raspelte und rumpelte es wie
früher im alten Schloss, und der Graf summte ein altes arabisches Lied von der Herrlichkeit des Paradieses. "Die wilde Gräfin wird wohl nie wieder kommen?" fragte Gritta den alten Müffert. "Nein,
die Vormünder lassen die wohl so leicht nicht wieder fort", sagte er. - So verstrich von da an die Zeit ruhig. Gritta ging so früh wie die Hühner zu Bett in ihr Ecktürmchen, das naseweis aus der
alten Ruine hervorstand und weit in den Gau hinaussah, als das einzig erhaltene; und sie stand eben so früh, wie die Sonnenstrahlen das Türmchen begrüßten, wieder auf. - Und nach vierzehn Tagen,
- da war alles vergessen.
Gritta und Müffert saßen eines Abends in der Küche, die ein kleines rußiges Gewölbe war. Ein Feuer brannte auf dem Herd, vier große Töpfe kochten, und die weißen Nebelwolken vermischten sich mit
dem schwarzen Rauch, zogen hinauf und flogen mit ihm davon. Es war heut zum ersten Mal nach langer Zeit stürmisch, der Wind trieb manchmal den Rauch wieder hinab. Die kleine Gritta saß neben den
Töpfen auf dem Herd. Sie schien an etwas zu denken, was sie ängstigte, denn sie sah von Zeit zu Zeit zu Müffert auf, der in Gedanken vertieft vor einer Speckseite stand, die im Schornstein neben
einem paar nachbarlichen Würsten an einem Bindfaden bammelte; er schien sich zu besinnen, ob er sie anschneiden solle, denn das säbelförmige Messer guckte zwischen seinem Zeigefinger und seinem
breiten Daumen wie ein angerufener Ratgeber hervor, mit einem entsetzlich begierigen Gesicht, in dem sich das Feuer spiegelte. - "Ach, Müffert", hob Gritta an, "glaubst du wohl, dass der Vater
noch an die Birkenrute denkt? Glaubst du wohl, dass noch Birkenreiser draußen am Birkenbaum sind?" - "Nein, Kind, ich glaube, der wird vertrocknen; das hat einmal seine sonderbare Bewandtnis mit
dem Baume gehabt." - "Ach, erzähle!" bat Gritta. - Müffert machte das Messer zu, und Gritta sah mit Vergnügen, wie ihre lieben blonden Würstchen heute noch vergnügt hängen blieben; er setzte sich
auf den Herd neben sie, und Gritta schaute, während er erzählte, in die weißen Wolken der Töpfe, wie sie mit den schwarzen Rauchmassen davon wirbelten, in denen sich, was in der Geschichte
vorkam, ihr bildete.
.................................................................................
"Dein Ururururgroßvater hatte seine Kinder gar artig erzogen, bis er Graf wurde; da bekam er aber noch ein Mägdlein und meinte, weil er Graf geworden, dürfe eine kleine Gräfin doch nicht mehr die
Rute kosten; so wurden denn die Rutenbäume hier um des Herrn Grafen Schloss gar nicht mehr gepflegt; die kleine Gräfin wuchs auf in aller Unart. Der Graf wusste kein Mittel, sie zu strafen, das
nicht das Gräfliche in ihr verletzte. Er kannte noch nicht den Spruch, der jetzt in mehreren Familien gang und gäbe ist: "Heute kriegst du nichts zu essen!" - und dachte, es werde immer bei den
kleinen Unarten bleiben. Aber das war Irrtum; sie entwuchs der Rutenzeit, ward wild, lief in den Wald, blieb Nächte lang aus, kam des Morgens mit wilden Dornenranken, Moos und Nachttau in den
fliegenden Haaren stolz nach Haus. In der Frühsonne regte sich besonders ihre Lustigkeit, wenn sie den betauten Gräserfußpfad hinauflief, ihren stolzen Gliederbau dem Himmel entgegen hob und
Frühluft trank, dann sang sie die im Walde selbst erfundenen Weisen. So kam sie eines Morgens auch mit einem jungen Bären bepackt, der sie im Walde angefallen und den sie mit ihren festen und
starken Gliedern erwürgt, gerade als ihr Herr Papa mit einem jungen Manne sprach, den er ihr zum Bräutigam erwählt. Der Bär mit seinem dunklen Fell hing ihr über die weiße Schulter, und das Blut
tröpfelte aus einer Wunde, die seine Tatze ihr geschlagen. Ihre Stimme, die wie die des Windes war, der um die Burg des Nachts sang, erschallte; der junge Graf mit seinem blassen Angesicht und
schwarzen Bart schaute sie freundlich an. Sie hatte fast einen kalten Blick, weil alles Feuer ihrer Augen sich tief in sie zurückgedrängt hatte. Aber, meldet die Sage, als sie ihn angeschaut,
brach es aus, das Feuer ihres Herzens, ihrer Seele; darum auch, meldet sie ferner, dass sie das Fräulein vom Feuerauge hieß. Jetzt liebte sie den Grafen mit Leidenschaft; sie war nicht seine
Braut, das durfte man nicht sagen, sie war sein Geselle, - aber das konnte ihrem Herrn Papa keine Freude machen. Fröhlich eilten sie nebeneinander mit Wurfgeschossen über die Berge und durch
Schluchten und auf moosigen Pfaden unter Gebüschen hinweg. Die rauschenden Waldeslüfte strömten ihnen voran, dem Wilde nach; sie sangen zusammen; studierte er, wozu er besondere Neigung hatte, so
lernte sie mit ihm. Bis spät in die Nacht saßen sie oft vor den alten Folianten, die Arme in einander verschlungen, eins dem andern helfend. - Ach, der gute, alte Vater wusste gar nicht, wie er
sich dabei anstellen solle; er hatte Sorge, dass dies einer jungen Hochgräfin böse Nachrede machen werde; auch bekümmerte ihn das sehr, dass sie so tief in frühere Zeiten sich bewanderten, wo die
Welt noch auf der linken Seite mochte gelegen haben. Dies verdross den Grafen sehr; er mochte nun einmal durchaus nicht leiden, dass sie in den alten Büchern herumsuchten, aus denen die
Staubwolken beim Umwenden der Blätter aufstiegen und die alten Bilder mit grinsenden Gesichtern schnell herausguckten; kurz, er wurde immer unzufriedner. Besonders schrieb sich sein Unwille gegen
dieses Bücherdurchsuchen daher, weil er einmal in Gemütsruhe im Keller unter dem offnen Kranen am Weinfasse liegend, während der Wein wie ein Bächlein durch die Gebirge und Wiesen seines Innern
floss, es ihm vorkam, als ob die Bücher aus der Bibliothek dahergetrampelt kämen und knurrten ihn an und öffneten ihre Blätter und klappten wieder zu, worauf allemal große Staubwolken
herausfuhren, die sich zu alten Mönchen und andern dergleichen wunderlichen Gestalten formten, dann umherspazierten und feine Liedchen auf seine Trunkenheit sangen. Diese Spottgesichte konnte er
nicht vergessen, und oft schaute er nach dem Rutenstammbaum hinüber, der mit seinen Blättern säuselnd, ihn zu mahnen schien, dass er seinen Einspruch bei der Erziehung der Gräfin abgelehnt habe.
- Es brach Krieg aus, der junge Graf zog mit einem Fähnlein Reiter fort. Jetzt glaubte der alte Herr die junge Gräfin unter seiner Regierung zu haben; er wollte, sie solle still zu Hause sitzen
und einen Kaminschirm sticken. Ihr pochte es in allen Gliedern, und wenn sie durch die Schloßfenster hinausschaute auf die blauen Berge, die gleich einer Mauer vor einem tatenkräftigen Leben ihr
lagen, wurde es ihr oft so eng, dass sie die Vorhänge ihres großen Himmelbettes aufriss und mit den Kissen zu bombardieren anfing, so dass die Federn stiebten; bald ließ sie diese wider die
goldnen Engel fliegen, die die Federkrone des Betthimmels trugen, bald in die und jene Ecke. Kam nun der alte Graf in solchem Augenblick, wo alles krachte und knarrte, in ihr Zimmer, so zog sie
schnell die Gardinen ums Bett und steckte sich unter ein großes Federbett, was sie fest um sich wickelte. Da stand nun der Graf und predigte ihr Stunden lang vor. So kam er auch wieder eines
Morgens, mit einem Arm voll Seide zu jenem Kaminschirm, den sie noch nicht angefangen hatte; da lag wieder das große Federbett; der Graf stellte sich davor und zankte, aber heut blieb das
Federbett besonders ruhig liegen; - sonst hatte sie zuweilen ihren Kopf hervorgestreckt und ihn dann schnell wieder zurückgezogen. Endlich ward der Graf über ihren Mangel an Anteil zornig, dass
er sich Mut fasste und das Federbett herunter riss. Aber siehe, der Fleck war leer und nichts dahinter. Während der Graf am Abend vorher in Gemütsruhe unter dem Kränchen eines uralten Fasses lag,
öffnete sich das Tor des Schlosses und die Gräfin mit einem Bündelchen schritt heraus. Ganz still und für sich schaute sie umher auf die nachtenden Berge, und ihr lichtbraunes Haar floss leise im
Abendwind daher; sie zog zur Armee. Als sie anlangte, empfing sie der junge Graf mit großen Freuden. An seiner Seite zog sie mit zu Felde, focht neben ihm und verfolgte ihn mit den Augen, dem
entgegentretend, der das Schwert gegen ihn schwang. - Am Abend saßen sie an den Wachfeuern, die müden Glieder ausgestreckt auf ihren Mänteln; da wehte der kühle Nachtwind über die lustige Schar
hin und kühlte die heißen Köpfe. - Die Soldaten rauchten, sie sang, erzählte alte Weisen, und alle waren fröhlich und gut in ihrer Gegenwart. Es verglimmten nach und nach die Kohlen, der Himmel
breitete seinen Nachtmantel aus mit den unzähligen Sternen. Da wusste die junge Gräfin erst, wozu sie geboren war; sie erhob sich leise und betrachtete den schlummernden Grafen und vertiefte sich
in die Ruhe seiner edlen Züge und las wie in einem Buch die schönsten Lieder an den Frühling, an die aufgehende Sonne oder den Mond, je nachdem das Antlitz des Grafen oder auch ihr eignes Gemüt
gestimmt war; sie schrieb dies alles mit ihrer Messerspitze in die Rinde der Bäume umher. Dann schlummerte sie ein Weilchen, während Göttinnen, man nennt sie Musen, ihrer sind Neune, voran ein
schöner Musenjüngling, einen schwebenden Tanz über ihrem Haupte aufführten und allerlei Träume ihr zusendeten.
Eines Morgens zogen sie aus dem Quartier, die Trommel tönte; sie hatte die dem Tambour abgenommen und trommelte einen Marsch, zu dem sie sang von der Kriegslust. Die Soldaten hörten begeistert
zu, sonderbar wirbelten die Trommeltöne wie ein Lied, aus ihrer Brust geschaffen, in den blauen Himmel empor. Da kam eilig des Weges ein Bote, der sagte, der alte Graf liege auf dem Todesbett;
zwar habe er verboten sie zu rufen, aber der alte Schloßkaplan habe ihn ausgeschickt. - Schnell reichte Gräfin Bärwalda dem Grafen zum Abschied die Hand und ritt davon. Eine unnennbare Trauer
erfasste sie, als sie das Schloss, auf dem selbst die alten rostigen Wetterhähne die Flügel zu hängen schienen, erblickte. Es sagte ihr alles, ihr Herr Vater lebe nicht mehr. So war es auch, das
ganze Schloss war leer; alle Diener und Hausleute waren furchtsam geflohen und hatten die alten Mauern allein stehen lassen. So zog sie in ihr Erbe ein, das einzige was ihr blieb; rasch sprang
sie vom Pferde und klopfte leise seinen Hals, als wolle sie sagen: "Bald reiten wir wieder davon!" Dann warf sie ihm die Zügel auf den Bug, und es trabte mit lautem Hufschlag in den leeren
Schlosshof. Der Schloßkaplan schlich in den leeren Gemächern herum, halb als wenn er sich vor ihr scheue, halb als wenn er sie bemitleide; ängstlich übergab er ihr die Schlüssel und ging eilig
davon. Die Gräfin stellte sich an ein hohes Fenster und schaute hinaus auf die dunklen blauen Berge in der Ferne. Sie liebte ihr altes Erbe so, und doch war es ihr, als drücke ihr etwas schwer
auf dem Herzen. Die Sonne ging unter, sie erhellte das Gemach und die braune Ledertapete mit einem leisen Schimmer. Da kam der alte Schloßkaplan herein, wich aber scheu zurück vor ihr; sie
verlangte, er solle bleiben und alles sagen, was er auf dem Herzen habe. - Nach langem Zagen sagte er endlich, der Graf hätte immer zornig über sie geschwiegen; aber in der letzten Stunde habe er
gesagt, es sei gesündigt, dass er nicht die Reiser vom Rutenbaum zu ihrer Erziehung gebraucht; darum habe er den Gram erleben müssen, dass sie davon und unter die Soldaten gegangen sei. Er
verwünsche sie, dass sie selbst im Grabe keine Ruhe finde, bis der Rutenbaum vertrockne, und der solle nicht eher vertrocknen und mit frischer Kraft fortblühen, bis ein Mädchen aus ihrem
Geschlecht so gut sei, dass es nie eine Rute verdiene. Der alte Mann hatte ausgesprochen; die junge Gräfin schwieg und schaute nach der sinkenden Sonne; ihr Glück sank mit ihr. Da tönten Schritte
die öde Burgtreppe hinauf, der Bote trat ein mit einem Schreiben. Der junge Graf war in der Schlacht gefallen; sie schwieg und ging in ihr Turmzimmer, was auf die Gegend hinausschaute, von wannen
der Bote gekommen war. Die alten Bücher, in denen sie studierte, lagen um sie her. So saß sie im Lehnstuhl, dem Fenster gegenüber, bis in ihr spätes Alter. Niemand traute sich in die Nähe dieses
Gemachs. In den Wald ging sie noch oft, und fortgewirkt hat sie noch lange. Woher kommt es, dass jetzt jenseits der Berge blühende Wiesen und Felder liegen? Oft kam sie von den Bergen herunter
geschritten, wenn die Bauern im Schweiße ihres Angesichts unten arbeiteten, mit traurigen Blicken die Stücke messend, deren widerspenstigen Boden sie glaubten nicht bearbeiten zu können. Sie
lehrte ihnen diese fruchtbar machen; sie baute sogar ihnen einen eignen Pflug. Die Leute liebten und fürchteten sie. Und doch war es ihnen, wenn sie weg gegangen, als habe sie kein Wort mit ihnen
gesprochen, keinen angesehen. Selbst als sie ganz alt war, kam sie an einem Stabe gebückt und schaute mit ihren wunderbaren Augen wie segnend alles an. Die Kinder hatten vor ihr keine Scheu; sie
besuchte diese oft im Walde, aber wenn sie gegangen, war es ihnen wie ein schöner Traum, der wieder verschwand. Ich weiß nicht, auf welche Weise sie mag gestorben sein, aber", sagte Müffert
leise, "man will sie nachdem manchmal gesehen haben. Es ist noch kein Kind aus dem Geschlecht so gut gewesen, dass es nicht eine Rute verdient hätte. -- Ich glaube gar, dass der Rutenbaum
vertrocknet! Ach, was für eine kleine artige Gritta wir haben!"
"Wo weißt du denn alles her?" fragte Gritta, deren Augen ganz groß vom vielen Erstaunen und Zuhören geworden. "Ja, Kind! Sieh, das kenne ich erst, seitdem ich Schneider geworden, und die großen
Bände aus der Schloßbibliothek zum Zeug verbrauchte."
Er schwieg ein Weilchen - dann sagte er nachdenklich: "Ich weiß eigentlich nicht, was Fräulein Bärwalda gesündigt hat; dass sie die Faulheit nicht liebte, gefällt mir, aber was den bösen Worten
des Grafen Wirkung gab, war wohl, dass sie dem alten Herrn davon gelaufen war. Die Brüder des Fräuleins sahen sie nicht und hatten sie auf dem alten Schloss, ihrem Erbe, allein gelassen." Gritta
schüttelte sich, wie ein Vögelchen seine Federn schüttelt: "Horch, mir ist, als klopfe etwas!" Ein Windstoß fuhr durch den Schornstein hernieder, es pochte unten, und eine jugendliche Stimme
schien hie und da durch den Sturm zu dringen, als suche sie ihn zu überbieten. "Ach, die Ahnfrau vom Rutenbaume!" sagte Gritta zu Müffert, erschrocken aufschauend; es war jedoch anders. Seit
einer Viertelstunde ungefähr stürzte ein strömender Regen herab, als zwei Gestalten den Weg zum Schlosse emporstiegen. Eine Mädchengestalt mit einem Schleier von feinen Spitzen. Das Gewebe hing
durchnässt herab, sie lehnte sich auf die Schulter eines schlanken Knaben, dessen Atlasrock und Puffen vom Regen trieften; die Federn seines Huts hingen geknickt dem Wetter preisgegeben. "Ach,
Elior", sagte sie leise vor Frost zitternd, "es ist doch ein zu böser Weg, ich patsche im herabrieselnden Wasser. Aber siehst du, oben auf des Grafen Zimmer scheint Licht." Sie hatten bald nur
noch eine kleine Strecke zurückzulegen, da drehte sich die Mädchengestalt um und schaute wie eine kleine Regenfee ins Tal, das voller Nebel war. "Hier will ich wohnen!" sagte sie, dann schritten
sie rüstig zu, bis zur Pforte des Schlosses. Sie klopften an, wieder und wieder, und riefen; endlich sahen sie durch eine Spalte der alten Türe Licht herabkommen. Es war Gritta. "Wer will
herein?" fragte sie. Hätte es geantwortet: "Ein Dieb!" oder "Ein Mörder!", sie hätte ihn auch eingelassen; denn ob man sich vor denen hüten müsse und sie weniger lieben wie andere, davon hatte
sie noch keine Gedanken. - An dem "Ich will herein!" erkannte Gritta sogleich, wer draußen war. - Eine lange Wasserstraße lief von der Schleppe, als die Gräfin mit größter Schnelle die Treppe
herauf gerade in des Grafen Gemach lief, wo dieser arbeitend bei einem kleinen Lämpchen saß. Seine spitze Nase sah aus der Dunkelheit hervor. Das Licht erhellte kaum die Gräfin und ihre goldnen
Locken, die triefend herabhingen, während Perle für Perle über ihr gerötetes seelenvergnügtes Antlitz rann. Als der Graf zum großen Erstaunen Müfferts, der acht Tage hinter einander seinen Augen
nicht traute, zu ihren Füßen lag, lachte sie mutwillig und schüttelte sich so, dass der Regen von ihren wilden Locken, gleich einem Regenschauer den Grafen überfiel. Dann kauerte sie sich an ein
kleines Feuer, das der Graf in dem großen rußigen Kamin anmachte und anblies, so gut er konnte. Endlich sagte sie: "Ich habe meinem Herrn Vormund viel zu schaffen gemacht. Jetzt holt er sich die
beiden andern zur Hülfe; derweil bin ich davon gelaufen!" Als der Graf mehr fragen wollte, wurde sie auf einmal ganz müde, Schloss die Augen und schnarchte anmutig, während der Graf vor ihr die
Nacht durch auf- und abspazierte. Das lustige Leben im Schloss fing wieder an; auf des Grafen Fragen, wie sich die Gräfin los gemacht, gab sie nie Antwort, sondern lachte, war fröhlich und guter
Dinge. Andern Tages kamen die kleinen Pagen mit bepackten Eseln. Da wurden über die Steinboden viele bunte Teppiche gebreitet mit herrlichen Blumen, singenden Vögeln und springenden Hasen
durchwebt, schöne Polster entlang den Wänden gelegt. Zierliche goldne Konsolen aufgestellt, mit Becken zum Weihrauch. Bald war die Wirtschaft im Gange. Der schöne Page Elior war in Ermangelung
einer Kammerzofe zum Friseur ernannt; er kämmte der Gräfin ihr langes Haar; blieb er zufällig in den langen goldenen geringelten tausend Fäden hängen, so hatte er, klapps! eine Ohrfeige. Alle
übrigen Pagen standen auch unter den fünf Zeptern ihrer feinen zarten Hand, die oft brannte auf ihren Wangen. Alles flog herbei und zerstieb wieder nach allen Ecken auf ihren Wink, mit Sendungen
etwas zu holen, zu schaffen; alles lachte, trieb toll durch einander, bis es zur Stelle war, wie sie es wollte. Nur wenn sie übler Laune war, dann war's ein übles Ding; da hing der Pagenhimmel
voll Regenwolken. - Ein Page war über den Wedel, einer über den Besen gesetzt, jeder hatte was zu fegen, zurechtzurücken, Blumen zu begießen, Staub abzufächeln. Der alte Müffert sah mit größtem
Erstaunen den jungen rotbackigen Wirtschaftsführern zu, die den Mut hatten, eine Flinte loszudrücken, zogen auf die Jagd, wagten sich in die dunkeln Wälder und kamen des Abends müde voll Staub
heim, luden in der Küche ihre Spatzen, nein, Hasel- oder Rebhühner ab und erzählten dem alten Müffert, der mit großen Augen drein sah, ihre Jagdabenteuer. - Die Gänge des Schlosses entlang wurden
Reihen fremder Gewächse gepflegt. In goldnen Bauern hingen die Kanarienvögel dazwischen, die beim Sonnenschein aus Leibeskräften schmetterten. Das Schloss war voll Papageien, die lärmten,
schrieen und riefen: "Ich will!", - woraus man wohl sah, dass sie bei einem verzognen Kinde in der Schule gewesen. Der Graf sah allem zu, und - vergaß die Maschine. Des Abends saßen alle in
seinem Saal, und die Gräfin sang und erzählte schauderliche Geschichten, dass sie eine Gänsehaut überlief vor Schauerplaisir. So schön konnte sie sein und singen, wenn sie wollte. Die kleine
Gritta kroch aber immer wie sonst so früh wie die Hühner ins Bett oder Heu. Heute ging sie erst an das kleine Fenster, als sie in den Turm trat, es war zwischen beiden dicken Mauem des Türmchens
eingeengt, das gleich einem Erker hinausschaute ins Tal. In einem Fensterflügel war das Bild des kleinen Johannes im blauen Kleidchen mit Hirtenstab, wie er ein Paar Lämmer hütete. Der Mond
schien bunt durch und malte das stille Bild des Knaben mit den Lämmern gelb, blau und rot auf ein Gärtchen von Heideblümchen für Marienkäferchen im Loch einer fehlenden Steinplatte. Der andere
Fensterflügel war geöffnet, und die Luft ganz monddurchflossen davor. Ging man näher, so konnte man herunter schauen in das zauberumnebelte Tal. Bloß die Spitzen der Tannenwälder waren zu sehen,
unter dem Türmchen der dunkle Fels mit Gräben und Moos, auf denen der Tau glänzte. Gritta lehnte sich hinaus und sah ein Tautröpfchen, das blitzend kühl im Mondlicht an einem gebogenen Hälmchen
über den Abgrund zitterte und herabfiel. Sie ging zurück, guckte in die Höhe nach dem Nest, das Frau Schwalbe an die Mauer geklebt und die Wand mit vielen Wandverzierungen bedeckt. - Sie
zwitscherte und unterhielt sich mit ihren Jungen. - Darauf nistete sie sich ins Heu ein und schob ein kleines brokatnes Kissen, das sie noch von ihrer Mutter hatte, unters Ohr.
"Willst du?" fragte im Schatten des Fensterkreuzes hinter dem Bettlein ganz leise eine Stimme, - "wenn du dich fürchtest, will ich gehen." Es lief durch das Mondlicht eine lange schmale Ratte zu
Grittas Lager. Die kleine Gräfin wendete noch einmal den Kopf und schaute mit schläfrig verliebten Augen den Mond an. Und der Mond, der dachte:
"Hätt' ich das runde Mägdlein!" und lachte.
Und der Mond, der dachte: "Über das runde Mägdelein
Sollte die Sonne neidisch sein!" Und lachte.
Es raschelte im Stroh, sie drehte sich zur Seite; da fing eine feine zimperliche Stimme an: "Wir zwei Hof- und Zimmer-, Saal- und Speisekammer-Fräulein der hochgeehrten Ratzenfürstin wollen dich,
kleine Gräfin, etwas fragen." - "Na!" sagte Gritta, die schläfrig glaubte zu träumen.
"Unsere Fürstin ist mit sieben jungen, einen Tag alten Thronerben hier, und es ist im Schlosse kein altes Federwerk mehr, worin die zarten Kindlein wohnen könnten. Das neue wird zuviel
ausgeklopft. Ob du wohl erlaubtest, dass die Fürstin in dem Brokatfederkißlein unter deinem Kopf mit ihren sieben jungen geliebten Häuptern sich einnisten könnte?" - Gritte nickte entschlafend;
denn sie meinte noch immer, dass sie träume. Kaum schnarchte sie, als ein langer Zug von Mäusen und Ratten durchs Zimmer wimmelte.
Vier Ratten zogen einen alten Holzpantoffel von Müffert, in welchem die Rattenfürstin mit goldner Krone saß. Ihre Jungen ruhten vor ihr, sie quartierte sich ein in das Federkissen unter Grittas
Kopf; das war ein großer Rumor im Kissen. Frau Schwalbe guckte neugierig über den Nestrand, begann aber, da es schon etwas spät, ihren Abendsegen zu beten; sie geriet in Streit mit ihren Jungen
über die zehn Gebote, die Kleinen behaupteten, es gebe nur neune. "Potz Wetter", sagte ein alter Holzkäfer, der aus einer Ritze hervorguckte, "Ihr treibt es so, dass ordentliche Leute nicht
einmal schlafen können." Frau Schwalbe schien sich gar nicht darum zu kümmern, bis er sagte, "Du wirst das Kind aufwecken!" Da schwieg sie und bat eine Mücke, die sorglos in der Nähe herumflog,
weil sie genug Futter von Gritta erhaltend keine Tierfresserin war, sie möge doch herabfliegen und Gritta wieder einschläfern. Der kleine Nachtmusikant flog eilig herab und lud noch drei andre
ein mitzumusizieren; doch diese sangen in der Prozession mit, welche die Marienkäferchen nach einer blauen Glockenblume hielten, aus Dank, dass der Rattenzug sie nicht beschädigte. Und sie sang
allein. So lebte und webte alles um Gritta, bis es später wurde; da kam die Nachtstille, und der müde Musikant ruhte auf Grittas Ohrläppchen, der Versuchung mit Macht widerstehend, von dem süßen,
süßen Blut zu naschen, aus Liebe zu dem Kind.
...............................................................................
Als sie am andere Morgen erwachte, fühlte sie unter ihrem Kopf sich etwas regen im Brokatkissen; sie war erst bestürzt, da sie sich nur undeutlich des nächtlichen Besuches erinnerte, aber bald
besann sie sich auf die große Artigkeit der liebenswürdigen Rätzinnen und fühlte Verwunderung und Freude über die neue Einwohnerschaft. Sie nahm das Kissen und legte es an die Sonne und stellte
sich dann ans Fenster. "Sag einmal", fragte sie den alten Müffert, der eben mit einem Krügelchen Wasser ins Zimmer trat, um seines Lieblings Blumen zu begießen. "Sag, holst du mir morgen frische
Blumen aus dem Tal?" Sie überhörte seine Antwort und schaute hinab in den Wiesengrund, der von dem azurblauen Himmel bestrahlt mit seinen grünen Büschen und Grasflecken vor ihr lag. Kleine
bewegliche weiße Fleckchen, in denen sie erst nach längerem Hinschauen Gänse erkannte, weideten im Grünen, und ein kleiner Bauernbube war dabei; sie sah nicht, wie er auch so freundlich nach dem
Erker blickte. "Siehst du da den kleinen Jungen?" fragte sie. "O ja", sagte Müffert. Gritta schwieg. Als sie zu den Übrigen herunter kam, fand sie alles in Not durcheinander: eine unberufene
Katze hatte den Papagei gerupft, darüber erhielt alles Ohrfeigen. - Es war etliche Tage später, an einem schönen Morgen, als der kleine Bauernjunge, der vor dem Felstor die Gänse der reichen
Müllerin hütete, bitterlich weinte. "Nun ist's aus mit dir", rief sie, "erst lässt du eine Gans laufen, um dem alten Grafen aus dem Sumpf zu helfen, und heute wieder eine, um dem Müffert Blumen
zu suchen. Jetzt geh, aus dir wird nichts!" In gesteigertem Zorne gab sie ihm einen Puff, dass er nicht wusste, wie er sich vor der Tür befand. "Da hast du ein Stück Brot und deinen Lohn, nun
lauf." Der Junge ging in den Stall zu seinen Gänsen und setzte sich auf einen Stein, der sich in der Mitte desselben befand; es war eine angenehme Federviehwärme. Die eine stand unbeholfen auf,
die andere schüttelte ihr glänzendes Gefieder; sie zogen den Kopf ein und streckten ihn vor, fielen von der auf jene Seite, bis sie alle bei ihm waren, dann legten sie den Kopf auf seine Knie, wo
sie Platz fanden, die hinteren streckten ihren Hals über die vorne standen, von Zeit zu Zeit ihn erhebend, um zu schnattern. So waren sie auf der Wiese gewöhnt zu tun, wenn er auf einem kleinen
Rohr blasend in ihrer Mitte saß. Er weinte, streute ihnen sein empfangenes Brot und hielt eine lange betrübte Abschiedsrede. Eine küsste er auf ihren schönen, weiß und weich befiederten Flügel,
stopfte seinem Liebling den letzten Bissen Brot in den Hals und ging. Sie schnatterten ihm nach und verfolgten ihn bis zur Tür. Er guckte sich um: - sie wussten nicht, dass er morgen nicht
wiederkomme. Der Span war vor die Klemme gesteckt, und nun wohin?
Da stand er vor der Tür; es wehte ein kalter Herbstwind, und die Blumensterne wiegten sich auf ihren Stengeln, als wollten sie bald ganz davon fliegen und die Stiele leer lassen. Er ging durch
den Hohlweg, um die Burg noch einmal zu sehen: da lag sie auf dem felsigen Bergkegel! Dort das Türmchen der kleinen Gräfin. - Wie viel hundertmal zog er mit seinen Gänsen da vorüber! - Wie lange
hatte er oft hinauf geschaut! - Er ging ohne Besinnen und pflückte Blumen. Beinah war ein Strauß zusammen gepflückt, da fiel ihm ein, er wollte sie dem alten Müffert bringen und ihm Adieu sagen;
so ging er hinauf zu. Von ferne schon sah er Gestalten vor dem Schlosse stehen und hörte den Takt von einem Liede. Es war ein Mann, der ein Marmottchen tanzen ließ und große Wunder von sich und
seinem Tierchen erzählte. Da kam die Gräfin angesprungen, mit dem Brokatkißlein Grittas in der Hand, ihr nach Elior und alle andern Pagen mit großem Lärm. "Ei sieh einmal, Gritta", rief sie
dieser zu, die sich mit Müffert an den Sprüngen des kleinen Marmottierchens freute, "ich kroch da oben in dein Mauseloch, deinen Turm; da liegt ein Kissen in der Sonne, es ist ein Leben und eine
Bewegung darin, und wie ich nachsehe, da sind es Ratten." - "Pfui! Und das sind Ratten!" riefen alle Pagen mit großem Geschrei. "Ich werfe Kissen und Ratten in den Abgrund." Die Gräfin, dies
sagend, näherte sich ihm. "Ach, um des heiligen artigen Johannes Willen, was machst du? - Das Kissen ist von der Mutter, und die Ratten sind die Rattenfürstin mit ihren sieben fürstlichen
Söhnen!" "Hinab mit der Brut!" rief die Gräfin Krautia, denn so hieß sie, "was hast du für komische Einbildungen." "Gebt sie mir", sagte der Marmottenmann, "ich kann jetzt gerade ein paar
brauchen zum Kunststücke Lernen." "Da!" sagte die Gräfin, reichte sie hin und drehte um ins Schloss; die Pagen folgten mit Gritta, die bittend ihr zur Seite lief, Müffert verschwand traurig, dass
er nichts hatte, sie auszulösen. Der Marmottenmann packte das Kissen zusammen und machte sich bereit zu gehen. Der Bauernknabe nahte sich ihm. "Gebt mir die Ratten mit dem Kissen für das Geld",
bat er. Der Mann sah ihn verwundert an. - "O ja, mein Junge, die kannst du haben, ich finde überall Ratten und nahm sie bloß, weil sie gleich bequem eingepackt sind." Peter gab seinen Lohn und
erhielt das Kissen; er wollte eine Weile warten, bis Müffert vielleicht käme. Da kam in stürmischer Eile Gritta den Gang entlang gerannt, sie schaute sich um nach dem Marmottenmann. "Ach!" rief
sie, da sie ihn nicht sah, "ach, ich wäre ihm zu Füßen gefallen, er hätte es mir gewiss gegeben." Schon machte sie sich bereit, den Felsweg hinab zu laufen, ihm nach, da nahte sich der Knabe, das
rotberänderte Mützchen schwebte zum Gruß durch die Luft. Er gab ihr das Kissen; ohne etwas zu sagen, drehte sie sich freudig auf dem kleinen Absatz um und verschwand in der Burg, während er mit
großen Augen nachsah. Er wäre jetzt fortgegangen und in die weite Welt gelaufen, wäre Müffert nicht gerade herausgekommen. "Ich stand hinter der Tür, Bube, und sah, wie du den Mann bezahltest; wo
hast du denn das Geld her?" - "Es war mein Lohn, die Müllerin hat mich fortgejagt." - "Ach!" sagte der alte Müffert, indem er sich traurig an seinem Haupte kratzte, "warte noch. - Nun ja, jetzt
fällt es mir ein; - kannst du nicht Page werden?" - Er besah ihn sich vom Kopf bis zu den Füßen. - "Ei, warum kannst du nicht? - Ich will dich zur Gräfin führen, du musst dich keck und munter
anstellen, musst einen Diener machen, gleich nach ihrer Hand greifen und sie küssen. Ach Gott, bei unserer früheren Herrin, da brauchte einer nur zu sagen 'Gott, wie arm bin ich', so tat sie, was
sie konnte, ihm zu helfen." - Sie gingen ins Schloss; in einem Gang trafen sie die Gräfin, die erhitzt und rot bis an die Stirne war. Der Graf hatte auf die Bitten Grittas vorher gewagt, eine
Einwendung gegen das Weggeben des Kissens zu machen, und die Gräfin war jetzt heftig erzürnt auf sie. Der Gänsejunge stellte sich vor sie, zog sein Zipfelmützchen ab und küsste ihr die Hand.
Obwohl er nachher sich den Mund abwischte, wie es Kinder gewöhnlich tun, schaute sie ihn doch freundlich an. "Was will der Junge?" fragte sie. "Page werden!" sagte Müffert. "So? Nun, einen
kleinen Pagen mehr können wir immer brauchen. Pfui, wie schmutzig ist er! Lass dich anders ankleiden. - Du sollst", sagte sie nach einigem Besinnen, "Turmwart werden, ja, dies ist am besten. -
Lass dir ein kleines Horn geben und wohne auf einem der Türme unserer Burg." - Der kleine Gänsejunge wurde also Turmwartel, blies morgens und abends vom Turm herab in den Gau und schaute sich um
in die Weite, wo ihm der Wind unter die Nase pfiff. Gritta hatte sich schon bei ihm bedankt. Der kleinen Hochgräfin wurde nicht wohl unter ihrer Stiefmutter und der Pagen Regiment; sie gewann den
Turmwart lieber als alle andere nach Rosenöl duftenden Paglein. Sie spielte mit einem goldnen Ball, einem alten Erbstück der Rattenzuhausbeiuns'schen Familie, die Treppe nach dem alten Turm
hinauf. Wenn so der goldne Ball hinaufflog in den spitzgewölbten Turm und der Peter schrie: "Ich hab ihn!" und der Ball dann die alten Stufen wieder herabrollte und Gritta lachte und selbst über
die Stufen fiel, um ihn aufzuhalten, so waren beide guter Dinge. Der Turmwart durfte nicht hinweg von seinem Platz; so kletterte denn die kleine Gritta die Stufen des Abends hinauf. Wenn sie um
den Wendelstock bog, so schaute sie durch ein Loch der Mauer in seine Hirtenknabenkammer. Das Licht schien durchs Gaubloch auf das Heu des guten Hirtenknaben; die Peitsche stand dabei, und auf
einem Brettchen an der Wand lag seine Pfeife; ein zahmer Vogel, den er halbtot mit einem zerbrochnen Beinchen gefunden und geheilt hatte, saß gedankentief in einer Ecke und zirpte für sich hin.
War er nun hier nicht, so streute sie dem Vogel ein paar Körnchen und lauschte; - hörte sie nichts unter sich regen oder die Gräfin Krautia nach ihr rufen, so stieg sie weiter; nach einer zweiten
Wendung sah sie den Knaben schon auf- und abmarschieren, aber nun ging's noch an einem alten Steinbilde an der Seite der Wendeltreppe vorbei, und dazu gehörte Mut. Der ernste Steinkopf ragte in
einer Halskrause mit spitzer Nase aus der Wand. Müffert hatte oft von diesem Bilde als von der Frau Gote erzählt. Gritta machte jedes Mal einen sehr artigen, furchtsamen Gruß, wenn sie vorbei
kam, und bat: "Frau Gote, sei sie so gut und behüte sie mich vor den Pagen, dass keiner herauf kömmt!" Da war es denn auch sonderbar, dass kein Page, wenn er nach ihr rief, sie finden konnte,
weil eine neckende Stimme sie immer von einem Ort zum andern lockte. - Dann hielt Gritta noch auf der vorletzten Stufe an, in deren Ecke sie einen kleinen Garten angelegt von Moos und den
schönsten Gartentempelchen aus alten Scherben; darin weidete Topfhenkel, die Kuh, und Topfdeckelknopf war der Hund. Hier wehte ihr höhere Luft entgegen, die kühl um den Turm blies. Sie legte ihre
runden Ärmchen, nachdem sie Peter begrüßt hatte, auf die alte Steinmauer und schaute hinaus in die Ferne; die Vöglein flogen unter ihr um den Turm, der mit vielem Moos und Gras auf den Felsen an
den Mauerritzen bewachsen war. Dann ging's tief, tief hinab. - Unten waren all die silbernen Seen, die grünen Büsche im Tal, gegenüber die Berge, die so weit in die Ferne gingen, und drüber der
Himmel, so dicht am Turm, und doch sah es sich so hoch hinauf.
Peter erzählte Gritta, wenn sie all diese Herrlichkeiten anschaute und bald dort bald dahin zeigte, wo sie gern sein möchte, von seinen Gänsen. Hatte sie nun recht tief gefühlt, wie schön seine
Lieblingsgans, die lange Grasknapserin, sei, so ging er mit ihr und half ihren Garten noch schöner bauen; nicht selten hatte er ihr eine Hängebrücke gemacht oder ein Tempelchen mit schönen
Bäumen. Wenn es so weit gekommen, dass die Luft kälter um den Turm wehte und die Sonne allmählich unterging, schied Gritta. "Morgen!" sagte sie vergnügt, und "Morgen!" sagte Peter und lachte noch
vergnügter. Gritta lief schnell die Treppe herab, aber noch schneller an der Frau Gote vorbei; der Turmwart lauschte noch lange auf den Tritt ihrer Füßchen: hatten sie ausgetrappelt, so wendete
sich seine Nase wieder dem Tal zu. Und sie schliefen beide ruhig die Nacht durch, wenn Gritta nicht gescholten wurde. - Eines Morgens blies der kleine Turmwart besonders laut, kam dann herunter
zur Gräfin ins Kabinett gelaufen und meldete einen Zug Menschen. Die Gräfin flog vom Sopha auf, gab ihm eine Ohrfeige, lief dann viermal im Zimmer umher und rief, indem sie ihm unter Tränen einen
Kuss gab: "Ach was machen wir? - O wenn's die Vormünder sind!" - Alle Pagen wurden zusammen gerufen. "Verrammelt die Türe", rief die Gräfin. "Ach und könnte man doch die Brücke schnell
abbrechen!" "Ohne in den Abgrund zu stürzen, braucht es ein Hänggerüst", sagte der Graf, "um sie von unten los zu machen." - Es wurde also für jetzt nur alles, was zu finden war, zum
Türverrammeln gebraucht. Die Pagen schleppten aus allen Ecken und Enden das Gerümpel herbei; als alles, was im Schlosse gefunden, vor der Türe aufgepackt war, lagerten sie sich dahinter.
Es verging eine Weile, bis sich Schritte über die Brücke nahten. Sie horchten auf, - es wurde geklopft. - Da keine Antwort erfolgte, begann eine Stimme: "Das vom wohlweisen Rat eingesetzte
Gericht, nämlich Summa drei Vormünder, verlangten mit der Gräfin und Fräulein zu Rattenwege zu sprechen!" Es pochte nochmals an. - "Ich spreche nur durch die Türe", rief die helle Stimme der
Gräfin. - "Selbmäßige Gräfin soll morgen mit ihren Herrn Vormündern, zeitjetzigen Herren, auf das ihr zur Wohnung angewiesene Schloss reisen, bis zu ihrer Mündigkeit dort verharren, auch sich
nicht in dieser Zeit ohne derselben Willen vermählen, noch sonst etwas von dem tun, was diese für untunlich halten. In Folge dieses hat sich die Jungfrau Nesselkrautia Bollena Anna Maria
Rattenweg, Gräfin, binnen heut und morgen früh zur bereitwilligen Fügung in alles, was rechtens, ihren Herren Vormündern zu stellen." - Hier endigte der Bierbass des wahrscheinlich ältesten und
dicksten, in seiner Allongeperücke schwitzenden Herrn Vormundes. - "Ich will nicht!" rief die Gräfin. Der eine Vormund wollte in Zorn ausbrechen; der andere hielt ihm den Mund zu; der Schreiber
trat vor und fuhr mit trockner Stimme fort: "Sollte benannte Jungfrau Nesselkrautia Bollena Anna Maria Rattenweg, Gräfin, sich binnen der festgesetzten Zeit nicht stellen, so wird sie und der sie
ihrer Pflichten enthält, durch ihre Herren Vormünder gestraft. Fiat!" - Hierauf wendeten die Leute um und ihre Schritte verhallten auf der Brücke.
Es war am Abend dieses Tages, als sich die kleine Gritta in ihrem Türmchen zur Ruhe gelegt hatte. Der eine Fensterflügel stand offen, und die Nacht mit ihren Sternen sah herein; da unterbrach den
Wind, der um den Turm sauste, eine feine Stimme, die etwas zornig klang: "Weißt du, kleines Mädchen, dass ich damals in großer Angst war mit meinen geliebten thronerblichen Häuptern? Weißt du
auch, wie schrecklich ich die Gräfin jetzt strafen kann?" - Es wurde Gritta angst und bange, sie hielt sich die Händchen vors Gesicht; denn die Augen der Ratte, die zur Seite herüberguckte mit
einem goldnen Krönchen auf, sprühten gar wunderlich funkelnd. - "Ich weiß wohl, was morgen geschieht, wie man die Gräfin wegschleppen und deinen Vater bestrafen wird." - Hier fing Gritta an zu
weinen vor der gräulich bösen Stimme. - "Aber", fuhr sie fort, indem sie unter ihrem Kopfe in dem Brokatkissen auf und ab spazierte, "aber wegen dir könnte ich dies alles ändern, um deiner
gastlichen Aufnahme willen, und ich will es auch. Die Ratte, die dich erzogen, rät zwar davon ab und redet von allerlei künftigen Zufällen, auch bliebe dann die böse Dame hier; sie gehört
indessen zu den leichtsinnigen ihres Geschlechts und denkt nicht viel darüber nach, uns mit Falle und Gift zu schaden." Die Ratte verschwand; als Gritta etwas beruhigt, schlief sie ein.
Alles war den andern Morgen auf den Beinen. Mit allem was von Messern im Schlosse war, bewaffneten sich die Pagen. Auch mussten die Stuhlbeine herhalten, die sie oben mit Nägeln spickten, so dass
sie wie Streitkolben aussahen, die man Morgensterne nennt. - Kühn schwangen sie sie durch die Luft, rannten mit erhitzten Köpfen treppauf treppab, wider einander und vorbei, indem der Mut
gewaltig in den Pagenherzen pochte. Die Türe zu verrammeln half nichts. Die Brücke konnte auch nicht abgebrochen werden, weil das hängende Gerüst fehlte. So hatte die Gräfin eine offene
Verteidigung vor der Tür zu Stande gebracht. "Stellt euch hinten an, kleine Mannschaft!" rief und kommandierte die Gräfin, mit einer in der Eile geschärften Feuerzange bewaffnet, den kleinen
Pagen zu, "lasst etwas Breite zwischen euch, dass Müffert das heiße Geschütz hindurch tragen kann." Sie stellte sich dann vorn auf, an der Brücke und dem Abgrunde zunächst, Gritta zur Seite mit
Kochtöpfen, die sie vor sich aufgereiht, um auf der Gräfin Befehl sie loszuschleudern. Die andern hatten auch solche Wurfgeschütze um sich stehen. Der Graf erschien mit dem alten Gerümpel und
türmte ein Bollwerk davon in die Höhe, das zu letzter Not zum Werfen benutzt werden konnte: japanische Waffen, alte Uhren, künstliche Schnitzereien, Blechhandschuhe, Tapeten, rostige
Rüstungsstücke, Porzellanaufsätze, Allongeperücken und andere Sachen der verschiedensten Art. - Alles war fertig. Die Gräfin Krautia kam vom Anordnen zurück und stellte sich an ihren Platz, indem
sie noch einmal das Ganze nach hinten zu überschaute. - Man harrte in atemloser Stille mehrere Minuten; es waren nur noch 5 bis Schlag 10 Uhr, da bog der Zug langsam um die Ecke im Tal. Die
Gräfin lauschte über das Gerümpel. Der Zug war sehr groß, sie rief die Heiligen in ihrem Herzen an; denn dass es so viele waren, das hatte sie durch die Türspalte gestern nicht gesehen. - Doch
sie schwieg und alles um sie. Indem lief etwas blitzschnell zur Tür heraus, zwischen den Beinen der Pagen hindurch auf den Steg hinüber. Sie gaben nur auf den Zug Acht, den man auf einer etwas
hohen Felsplatte gehen sah. Aber Gritta hatte gesehen, dass es eine Ratte war, die unter das Ende der Brücke lief. So viel sie sehen konnte, nagte das Tier an alten Binsen und Gras, und Erde und
kleine Steine rollten in die Tiefe. Doch nun blickte sie auch nach dem Zug, der schon ganz nah war. Der dicke Ratsherr und älteste Vormund mit Allongeperücke, scharlachner Weste mit über den
Bauch herablaufenden zwei Reihen goldenen Knöpfen und schön besetztem Rock. Dann die beiden andern Vormünder folgend, auch bepudert und frisiert. Hierauf Gutsknechte und sogar Stadtmiliz
hinterher. Sie langten auf dem Gipfel an und gingen dem kleinen Holzsteg zu. - Die Gräfin Krautia blickte sich um, die hintersten Reihen der kleineren Pagen waren gelichtet; eben lief noch einer
mit zusammengehaltenen Höschen davon, die Angst usw. - Mit dem Mute der Verzweiflung drehte sich die Gräfin um. Jetzt stand der Zug vor der Brücke; da sah sie, dass der vorderste Ratsherr
zusammenschauderte, seine Glieder zitterten vor Schrecken, die Knöpfe seiner Weste wackelten blinkend hin und her, sein Fuß weilte auf dem Brückenrand. "Kaaaanonen!" - stotterte er mit matter
Stimme hervor. "O Herr Ambrosius Zipperlein! Nein! Nein!" Doch stieß ihn der Hinterste an und flüsterte ihm etwas ins Ohr, was wie Kochtöpfe klang, worauf er die Tramontane ein weniges
wiedergewann. Es waren die von Gritta auf das Bollwerk in Reihe gepflanzten Kochtöpfe, deren runder Schlund nach außen stand und die Henkel nach oben; es sah in der Tat sehr gefährlich aus.
Gefasst wollte der Herr Vormund weiter schreiten, da wankte vor ihm das Brett und stürzte sausend in die Tiefe. Es sprang etwas Schwarzes blitzschnell hinab. "Die Ratte!" schrie Gritta voll
Freude, wurde aber gleich wieder blass vor Angst über den schwankenden Herrn Ratsherrn. "Herr Kollege!" riefen die hinter ihm, "halten Sie sich und schwindeln Sie nicht! - Er wendete sich zu
ihnen: "Fürchterliche Hinterlist! Grässlich angelegter Plan!" Die drei flüsterten jetzt eine Weile zusammen. Zuletzt wies er auf einen Vorsprung unter der Burgtür, indem er rief. "Sie sehen! Sie
sehen! Es geht!" und der Zug ging wieder ab. - Auf der anderen Seite war alles in Verwunderung über das Wunder. Jeder schrieb es seinem Heiligen zu, und die kleine Gritta schwieg, weil niemand
ihr geglaubt hätte. Sie hatte richtig erraten, dass die Belagerung von unten angehen werde. Alles harrte in Erwartung, die Gräfin über den Rand des Gerümpels gebogen. - Sie wussten, dass ein
schmaler Felspfad, kaum zu erklettern, von unten heraufführe auf den Vorsprung unter ihr. Zwei, drei Stunden vergingen; da erschien um die Ecke biegend auf dem Vorsprung, sieben Ellen unter der
Schloßtür, die Perücke des magersten und, wie es schien, ernstesten und eifrigsten Herrn Vormundes, in Schweiß gebadet. Müffert holte seinen ganzen Vorrat kochenden Hirsebreis herbei. Die Gräfin
befahl dem Grafen, Gritta und Elior das Herabwerfen der Töpfe und heißer Grütze. Die Übrigen blieben in Ordnung stehen, für den Fall, dass der Block erstiegen werde. Die Soldaten hatten bloße
Säbel, nur einer hatte ein Gewehr. Der dicke Herr gab den fürchterlichen Befehl, vor dem er selbst erschrak, zu feuern, aber ja nicht auf die Gräfin. Eine Kugel pfiff daher und dicht an der
Gräfin Kopf vorbei; sie hob ihn stolz auf. Hatte sie vorher das Kanonenfieber gehabt, so hatte sie jetzt das Kriegsfeuer. Ungeschützt stellte sie sich auf den höchsten Aufsatz des Gerümpels.
Gritta mit den kleinen, von der Arbeit feurigen Bäckchen, hatte nun auch Mut, schleuderte vereint mit dem Grafen, Peter und einem Pagen alle möglichen Dinge auf jeden Soldaten, der herauf zu
klettern suchte, während Müffert von Zeit zu Zeit kam und heiße Grütze auf ihre Köpfe ausleerte. Mit einiger Wehmut, wenn er wieder einen zurückgetrieben hatte, schaute er jedes Mal seinen
schwarzen Kochtöpfen nach. Doch nun kamen sechse zu gleicher Zeit. Die Gräfin sprang von der Barrikade herab, befahl, der Graf solle mit Gritta, Elior, Peter und ihr Hand anlegen. In einem
vereinten Stoße flog das Gerümpel in die Tiefe, die Soldaten bis auf den Absatz mitnehmend. Der kleine Peter hatte sich Venus und Amor, einen porzellanenen Kaminaufsatz, gerettet und schleuderte
ihn auf den fern am Ende des Felsabsatzes sich gesichert haltenden ältesten Herrn Vormund, mit der halblauten Gedankenfolge: "Der lässt die andere für sich fechten und stellt sich selber ins
Trockne". Er zerbrach mit großem Geprassel an ihm. In demselben Augenblick streifte ein wohlgezielter heißer Kellenwurf seine Wange und ein Teil blieb an seiner Nase hängen. "Haltet ein!" ertönte
seine Stimme. Die Soldaten mit Brandflecken und Blaumalen hörten auf, in die Höhe zu klettern, sämtlich mit der Idee, lieber ins Kriegsfeuer zu gehen als länger diese Kitzeleien auszuhalten. "So
mag sie denn in ihr Unglück rennen! So heiraten Sie, heiraten Sie, kleiner Engel", rief er ihr zu, während er heftig seinen getroffenen Backen rieb. "Die Zeit wird kommen, die Zeit wird kommen,
wo die Reue folgt. - O, müssen sich nicht die steinernen Ureltern auf ihren Gräbern herumdrehen! - Soldaten, blast Trauerfanfaren! Wie wird das schöne rote Gold jetzt rinnen?" setzte er privatim
für sich hinzu. - "Wär's nach mir gegangen, so hätte sie nie geheiratet!" "Ach, hätte ich sie nur und nicht der Graf gekriegt!" murmelte der Zweite für sich. "Wäre sie nur Nonne geworden, dann
wäre es nach meinem Willen!" sagte heimlich der Dritte zu sich selber. - Die Soldaten hatten unterdessen die Reste der Grütze so gut wie möglich abgekratzt, und alle zogen ab. Die Gräfin lachte
ihnen nach, und der älteste Vormund, mit Tränen auf den speckigen Wangen, rief. "Frevle nicht! O frevle nicht!"
.................................................................................
Die kleine Gritta lief emsig mit dem Rauchfass hin und her: heut war Trauungstag. Die Rauchwolken durchzogen den Saal, der schön geschmückt war mit seidenen Tapeten, die Fenster geöffnet nach den
Bergen zu. Endlich blieb sie vor dem Traualtar stehen, der mit einer bunten Decke belegt war. Auf ihm lag ein kleines Gebetbuch mit altem silbernem Beschlag; sie dachte an die Ehe, dass die ein
Band sei, was aneinander binde, wie der Herr Pfarrer sagte. So freute sie sich schon, dass morgen die Gräfin nicht werde wie sonst davon können laufen, wenn der Vater vom Maschinenwesen spreche.
Da trat auf einmal der Bauch des Herrn Pfarrer herein, und dann folgte das Übrige nach. Es versammelten sich allmählich alle. Die Gräfin mit ihrem kleinen goldnen Krönchen auf dem Kopfe und
weißem Schleier sah gar lieblich aus. Das war eine Traurede. Die Pagen sollen sich einen Teil ihrer Beine abgestanden haben. Die Gräfin und der Graf knieten hin, sie mit lächelndem Gesicht, er
mit ernsten, gerührten Blicken. Als es an das Jasagen kam, stieß ihn die Gräfin an, denn er hatte die Augen ein wenig zu sehr für das Gerührtsein zugemacht. "Freiherr Ortel von
Rattenzuhausbeiuns", rief der Herr Pfarrer, "willst du selbige benannte Jungfrau Nesselkrautia Bollena Amaria als deine andere Hälfte und Herrin anerkennen, wie sie dich als ihren Herrn
anerkennt, so sprich ein deutliches und vernehmliches Ja!" - "Brrrrrmm, das Räderwerk steht still", sagte der Graf aus dem Schlaf auffahrend und erschrocken umhersehend. Endlich besann er sich
und sagte Ja! Dann endigte die Predigt schnell. Den Abend bliesen noch Flöten und Klarinette. Die Pagen drehten sich und sprangen und waren voll süßen Weines. Gritta schlich in ihr Türmchen und
schaute den Sternen zu, während der kleine Turmwart von oben herab ein Abendlied blies. Unten lag still im Nebel begraben das Tal, und ihr schienen aus den dunklen Höhlen inmitten der Berge
kleine Flöckchen zu fliegen, aus denen sie sich Gestalten bildete. - Am anderen Morgen ging die Gräfin zur Kirche; ein veilchenblauer Atlas sank von den Schultern zur Erde, ein feiner Schleier
umgab sie und wurde nur hie und da von Diamantsternen aufgenommen. Die Glocken der Dörfer läuteten zusammen den blauen Bergen zu durch die Sonntagsluft. Der Gräfin zur Seite schritt der Graf, in
stattlicher Puffenkleidung von grünem und gelbem Atlas; die Pagen folgten hinter her. Der Graf war entzückt darüber, wie die Gräfin so sanft auf das kleine Gesangbuch in ihrer Hand blickte.
"Weißt du was", sagte sie, "deine kleine Tochter will ich in ein Kloster zur Erziehung geben." Der alte Graf runzelte die Stirn. "Ich kann sie nun einmal nicht erziehen." - "Hast es auch nicht
nötig, Frau Gräfin." "Aber was soll aus ihr werden, wenn sie nicht sticken, weben, spinnen kann, und mir gehorcht sie nicht, denn sie ist ein wildes Ding." - Der Graf bedachte sich heimlich, und
als er die Gräfin so fromm einhergehen sah, sagte er endlich Ja! - Aber die Gräfin dachte: "Hab' ich sie erst dort, so soll sie Nonne werden." - Gritta sollte fort, fort von der Burg ihrer Väter.
Zwei Tage blieb sie noch, sie vergingen schnell. Den alten Grafen sah sie nicht, die Gräfin ließ sie nicht zu ihm; aber sie war oft beim kleinen Turmwart, tausendmal trug sie ihm auf, dass er für
die kleinen Tierchen in ihrem Turme sorge. Am Morgen des dritten Tages stand sie endlich vor dem Schloßtor. Sie guckte, als sie weiter ging, hinauf nach der alten Zinne, drehte sich dann um und
wanderte, ihr Bündelchen an einem Stecken über der Schulter, eilig an Müfferts Seite davon. Der Turmwart schaute von der Höhe hinab ihr nach; er blies eine so fürchterliche Trauerfanfare herab,
dass alles im Schloss zusammenlief, meinend, es brenne. Als sie durchs Felstor waren, gingen sie dem Walde zu. "Ach!" hob Gritta an, "ich habe gebeten, sie sollen mich nicht im Kloster vergessen,
und der Peter hat es mir versprochen; vergäßen sie mich, so wollte er mich holen!" In der Hochgräfin grauen Augen standen Tränen, die an den schwarzen Wimpern gleich Perlen hängen blieben.
Müffert schnitt ein fürchterlich Gesicht, um seine Tränen zu verschlucken, und rief. "Wer hat dich Weinen gelehrt? - Ich hole dich schon und vergesse dich nicht."
Der Wald wurde immer dichter, und der kleine Fußpfad war kaum zu unterscheiden; es ward schon spät. Sie gingen still neben einander: "Horch! - Es raschelt etwas!" rief Gritta. Einen Augenblick
dauerte es, da guckte ein dicker, dunkler Kopf aus dem Gebüsch mit seinen drohenden Augen, vor sich hinbrummend. Wie der Blitz lief Gritta davon; ihr Herz klopfte, ihr Kleidchen blieb an den
Dornsträuchern hängen, das Päckchen unter ihrem Arm fiel zur Erde. Da blieb sie stehen, sie wurde rot bis über die Ohren: sie war davon gelaufen. - Sie - die Tochter eines Ritters, die Enkelin so
vieler mutiger Ahnen, von denen drei mit Hosenbands-, drei mit Knopflochverdienstorden erster Klasse versehen waren! Sie war davon gelaufen! - Ein schlimmer Gedanke in der Einsamkeit! Aus jedem
Busch schien die Allongeperücke eines Ahnherrn zu winken. "Und wenn mich der Bär frisst, - ich gehe zurück!" - Sie ging kreuz und quer, rief und schrie; doch vergebens. So irrte sie hin und her,
und zuletzt fiel ihr ein, sie könne sich verirrt haben. So war es. - Nur dadurch, dass hie und da ein Häschen weggesprungen oder das Laub geknittert, hatte sich vorher noch der hochgräfliche
Ahnen-Hosenbands- und Knopflochverdienstordens-Mut aufrecht erhalten, aber nun war alles still! - Sie zitterte vor Frost, als sie in eine Gegend kam, wo die Bäume lichter wurden. Endlich an eine
Baumlücke gelangt, stand vor ihren erstaunten Augen ein großes, kahles Gebäude. Es hatte nach beiden Seiten Flügel, auch zog sich eine Mauer herum, die dem Anschein nach es ganz umschließen
musste; eine runde, dunkle Eingangstür lag vor ihr, die tief in das Gebäude hinein ging. Von Zeit zu Zeit befand sich hoch oben ein Fenster, mit Eisenstäben verschlossen. Eine öde Stille um das
ganze Haus; endlich entdeckte sie an der Tür einen Draht mit einem Ring daran. - Da es immer finsterer wurde, nahm sie sich ein Herz und zog; laut hallte es wider und schien sich in fernen Gängen
zu wiederholen, bis es zuletzt verhallte. Sie zog noch einmal und klopfte dann; es nahten Schritte, nach einer Weile fiel ein Schiebfensterchen rasselnd herab. Ein paar graue Augen blitzten
hindurch; darauf öffnete sich die Tür, eine magere Knochenhand langte heraus und holte Gritta hinein in eine tiefe Dunkelheit. Es deuchte ihr, als höre sie die Töne einer fernen Musik, als eine
schnurrende Stimme fragte: "Was willst du?" Die kleine Gräfin fing jetzt wie ein aufgezogenes Rädchen an, ihre Geschichte herzuschnurren. Die Alte hörte brummend zu, nahm ihr dann den Brief aus
den Händen und zog sie hinter sich drein durch viele Gänge, bis sie vor eine hohe Tür kamen; hier ließ die Alte sie in der Dunkelheit allein. Nach langer Zeit erst kam sie wieder, ihre lange Nase
ragte beim Aufgehen der Tür aus dem schwarzen Schleier hervor. "Da, sehen Sie, ist die kleine Hochgräfin im windigen Röckchen, wie ein hergelaufnes Ding!" Die Alte richtete diese Worte an eine
alte Dame, die im Sessel mit hoher Lehne saß; sie hatte die Schultern eingezogen und schaute gleich einem grauen Jahrhundert vor sich hin, dann hob sie die Augen und starrte Gritta an. Die Alte
fing an, mit ihr heimlich zu zischeln, nur zuletzt sagte sie etwas lauter: "Sie hat mir erzählt, dass der alte Müffert, ein Diener des Schlosses, nicht wisse, wo sie sei; daher ist es für unsere
Pläne sehr gut, wenn wir es auch nicht sagen." Gritta hatte während des Gesprächs Zeit sich umzusehen. Es war ein hohes, dunkles Zimmer, mit einer alten Ledertapete. Nussbraune Schränke an den
Wänden. Eine heilige Maria von schwarzem Ebenholz mit Elfenbeinaugen und diamantnen Augensternen schaute graulich aus einer hohen Ecke herab. Die Alte erweckte Gritta aus ihrem Traume, nahm sie
an der Hand und zog sie wieder durch eine Menge von Gängen fort; am Ende derselben öffnete sie eine Tür und trat mit ihr in einen Saal. Der Mond schien durch die Fenster auf eine Menge kleiner
Bettchen, die mit weißen Linnen gedeckt umherstanden. Es war eine Stille und ein leises Atmen; die Alte hob sie auf ein Bett und ging. Gritta glaubte sich erst allein in dem großmächtigen Saal,
doch im Mondlicht wurde sie einiger Kinderköpfchen in den Betten gewahr, sanft lächelnd vom Schlafe. Sie hockte auf dem Bettchen, um alles zu betrachten; ihr blondes Haar strahlte im Mondlicht,
da fühlte sie, dass sich etwas dicht neben ihr rege. "Ach, ein Kind, so groß wie ich!" Und wirklich war es eins, es hatte die weißen Glieder in schlafender Bequemlichkeit weit von sich gestreckt,
ein brauner Zopf hing hinten herab; es hatte ein besonders weltweises Gesichtchen, die schwarzen Wimpern ruhten auf den rotgeschlafenen Wängchen, die vollen roten Lippen geöffnet. Gritta, nachdem
sie das kleine Mädchen noch betastet hatte, versank in Schlaf.
Gritta erwachte zuerst am anderen Morgen; sie sah das Kind neben sich liegen, da fiel ihr gleich wieder alles von gestern ein. Sie wollte das Kind ermuntern, aber wie? - Sie kniff es erst ins
Ärmchen, - es erwachte nicht; sie zog es an seinem langen Zopf, aber es schlief fort; endlich fiel ihr ein, ihm ins Ohrläppchen zu beißen. "Au!" schrie die Kleine auf und sah sie halb schlafend
und fragend an. - "Wo bin ich denn eigentlich?" fragte Gritta. - "Wo du bist weiß ich nicht", erwiderte die andere, "aber ich bin im Kloster." - "Ach!" rief Gritta, "so bin ich doch ohne Müffert
glücklich angekommen. Wie heißt du denn?" - "Margareta, und du?" - "Gritta". Ein Glöckchen fing an zu läuten; die Kinder erwachten, alle streckten die Köpfe verwundert aus den Betten, als sie
Gritta sahen. "Ein kleines Mädchen wieder?" fragten sie. "O, sie hat bei mir geschlafen", rief die Weise, "heute Nacht habe ich sie ausgebrütet; ich will's euch nur heimlich sagen, ich habe
gestern das Ei im Garten gefunden. - Die andern lachten, aber die Jüngste, ein Mädchen mit lichtblauen Augen und blondem Haar, reckte ganz ernsthaft den Kopf empor und fragte: "Hat sie denn auch
Federn?" "Ja, ja", sagte die Weise, "nun, du kleines fremdes Ding, steh auf!" Sie war mit einem Satze aus dem Bette. Die Glocken läuteten stärker; es begann ein eiliges Treiben, die Kinder liefen
alle zu der Weisen. Diese hatte den Kran über einem Steinbecken geöffnet. Da standen sie zu vielen in den weißen Hemdchen und spülten sich die Arme und das Gesicht im Wasser, das in der
Morgensonne hell blinkerte. Die Weise rief, wer zuerst kommen sollte, und erzählte dabei von der bösen Nonne Sequestra; die andern gaben ihre Meinung auch dazu. Gritta stand in Gedanken verloren
auf einem Bein und lauschte voll Verwunderung, da überschüttete sie ein Regenschauer von hinten. "Nun bist du getauft", rief Margareta, hielt aber erschrocken ein im Lachen, denn es schlurrten
Schritte auf dem Gang. Alle schlüpften still und scheu in ihre Kleider. Die Tür ging auf, und die alte Nonne von gestern trat ein. Heute war ihr Gesicht noch abschreckender; sie faltete die
langen, knöchernen Finger unter dem Gewand, sagte den Morgensegen und winkte zu folgen. Sie trippelten hinter ihr drein, Gritta hinter Margareta durch finstere dunkle Gänge, es wurde ihr Angst,
wo es hinsollte; da kam eine Treppe, unten drang Lichtglanz aus einer offnen Tür, eine sanfte Musik ertönte. "Wo geht's hin?" fragte Gritta. "Still", sagte Margareta, "es wird dir nichts
geschehen." Sie kamen herab in eine düstre, hohe Kapelle, auf dem Altar brannten die Kerzen vor dem Muttergottesbild. Junge und alte Nonnen in langen Chormänteln sangen. Gritta kam erst zu sich
selber, als sie an einem Seitenaltärchen des heiligen Johannes Bild fand; ein Lichtchen brannte davor. Es war mit Goldflitter und Blumen, der Arbeit der jungen Nönnchen, geziert. Gritta kniete
nieder und betete emsig, die Orgel tönte, Margareta lief mit dem Weihrauchkessel hin und her, aus dem die Wolken dampften, unter den Nasen der alten Nonnen hinweg. Als Gritta so in dem Duft saß,
das Lichtchen immer mehr abbrannte unter den vielen Gedanken, die sie hatte, bat sie unter anderem auch, der heilige Johannes möge doch den Johannes an ihrem Fenster besuchen und ihm sagen, er
solle doch für ihre Tierchen sorgen und ja den kleinen Peter grüßen, er solle sie nicht vergessen im Kloster; es störte sie eine lange, knöcherne Hand, die in ihre Gedanken hineingriff,
schüttelte sie und zog sie in die Höhe, dass sie wieder auf zwei Beinen dem Menschenleben anvertraut war. Es war Sequestra, sie nahm sie mit; sie sah, wie die jungen Nonnen durch eine Pforte sich
entfernten. Jede von den alten führte ein Kind. Sequestra führte sie in einen entfernten Teil des Klosters, sie öffnete die Tür in eine düstre Zelle. Oben ein kleines Fenster mit Eisenstäben
verwahrt ließ etwas Licht herein; nicht weit von einem großen Nußbaumschrank saß in der Ecke eine alte Nonne im braunen Lehnstuhl, an ihrer Seite hing eine Rute, sie guckte über die lange Nase
und Brille hinaus Gritta scharf an, rückte unter ihrem Stuhl ein Schemelchen hervor, nahm Gritta bei den Schultern; die wusste nicht wie, so saß sie. Die alte Sequestra ging, nachdem sie mit der
Alten ein harmonisches Kopfnicken gewechselt. Als sie fort war, lachte diese pfiffig, und Gritta musste lesen, während die Alte oft aufs zärtlichste einem langen Flaschenhals zusprach, der aus
ihrem Ärmel ragte, sich räusperte, hustete und wieder einnickte. Gritta las nicht diesen Tag allein, nein viele, viele Tage, den ganzen Tag; - nur ein Schüsselchen mit Essen teilte die Zeit; nun
begriff sie wohl, warum die andern Kinder oft so scheu und traurig waren, denn sie verbrachten die Zeit ja eben so bei solchen alten Nonnen. - Wenn sie mit ihren kleinen Fingern Blatt für Blatt
umwendete, so las und buchstabierte, zuweilen nach dem Gitterfenster schaute und darüber nachdachte, ob die Sonne draußen scheine, so wurde ihr so wunderlich zu Mute, wenn der Tag so langsam an
der grauen Wand der hohen Decke verging und die letzten Abendlichter auf dem nussbraunen Schrank spielten; ach, da ward ihr so angst, sie sehnte sich nach etwas, es war auch so eng und so hoch. -
Sie wollte die Alte freundlich machen. - Warum schaute sie so böse vor sich hin und murmelte wie eine rostige Raspel? - Gritta legte den Kopf an ihre Schulter; die Alte sah sie verwundert an,
fing gewaltig an zu husten und schüttelte ihren Kopf von sich ab, worauf sie tief in ihren schwarzen Ärmel kuckte und gestärkt wieder hervorsah. Jetzt wusste Gritta, wonach sie Sehnsucht habe! -
Nach dem alten Schloss, mit den Bergen umher! - Wie war's so hoch und frei da oben! Was mochten Müffert, Peter und der Vater machen? Aber wie weit ist das? Hatte sie bis in die Nacht gelesen, so
hielt die Alte ein Gebet; dann führte Sequestra sie in den Schlafsaal. Am Abend getrauten die Kinder sich nicht laut zu sprechen, weil sie fürchteten, die Alte lausche. Wenn die jungen Nonnen in
der Kirche an ihr vorbeigingen, da lächelte eine unter ihnen oft ihr freundlich zu. Eines Abends im Vorübergehen sagte sie ihr leise ins Ohr, in welcher Zelle sie wohne. Gritta entschlüpfte
später der alten Sequestra und fand sich glücklich zurecht. Das Nönnchen saß in seiner Zelle am offenen Fenster, ein Rosenzweiglein stand vor ihr, sie lächelte freundlich; aber kaum wollte Gritta
die Türe schließen, so stand Sequestra davor und nahm sie mit sich fort.
Mermeta hieß die junge Novize, die sie so liebte; sie sah sie selten, nur wenn sie ihr half, die Kelchtücher waschen und auf den Sträuchern im Garten an die Sonne hängen. Bald wurde Gritta so
schwermütig und still wie die andern Kinder; wenn sie die alte Sequestra ein paar Minuten fern wussten, so liefen sie in den langen Gängen hin und her und spielten hinter den großen Schränken
Verstecken, aber vor der Seite, wo die alte Sequestra wohnte, hatten sie heimlich Furcht, keins getraute sich hin. "Ich möchte wohl wissen", sagten sie untereinander, "warum die andern Nönnchen
so einsam leben und nicht heraus dürfen. Ach, für sein ganzes Leben hier bleiben!" sagte das eine oder andre seufzend.
Obwohl es nun sehr einsam herging, so war es schön, wenn an schönen Sommertagen die Zellen ihre Bewohnerinnen herausließen, oder vielmehr die Priorin, die sonst immer durch die Nonne Sequestra
vertreten wurde. Da öffneten sich die verschwiegnen Türen in den langen Gängen, und die Novizen kamen heraus mit ihren weißen Schleiern, sie wandelten zwischen den grünen Stauden, an den
blühenden Mandelbäumen blieb hier und da ein Pärchen stehen, die Gesichter erfrischt von der Luft, die Augen voll Erquickung der rosenroten Blüten, die Gewächse selber aus dem weltenfrischen
Boden in die trockne Einsamkeit versetzt. Die Wasser rauschten aus den Springbrunnen in die kleinen geschlossenen Bassins; daran saßen die Kinder, unter ihnen Gritta, und ließen Schiffe von
Rosenblättern, beladen mit Fliederblüten, auf dem klaren Wasser schwimmen. Der Kinder Lieblingsnonne, Mermeta, war eben ins Gebüsch geschlüpft; sie schauten ihr nach, als die Mater Sequestra von
der entgegengesetzten Seite heranschlich; sie war bisher im Garten herumgegangen, jede Vertraulichkeit hindernd. "Ach", rief Gritta, "kommt, wenn sie nur nicht zankt!" - Sie wussten schon, was
Mermeta dort machte; sie gingen den Weg, den Mermeta gegangen war; die junge Novize saß am Boden vor einer Eiche, der Schatten fiel sanft auf ihr blasses Gesicht; sie hatte den Zipfel ihres
schwarzen Gewandes ausgebreitet voll Futterkörnchen und blickte in eine dunkle Ecke neben dem Baume. Zur Seite steckte die Alte ihr Gesicht durch das Gesträuch; ein Vögelchen mit einem gelähmten
Flügel kam aus der Dunkelheit hervor und fraß die Körner aus ihrer Hand; sie sah sich schüchtern um, als sie im Gebüsch etwas rauschen hörte. "Du sollst keine Freude haben an irdischen Dingen!"
sagte die alte Nonne und nahm den Vogel in die Hand. "Gehe fort von hier", sie sah sie zürnend an, "gehe hin und nimm den Rosenkranz!" Darauf legte sie das Vögelchen auf die Erde; es war zu fest
gedrückt und sein Flügelchen gebrochen; sie griff die Novize, die traurig hinsah, bei der Hand; die Kinder blieben zurück, eins sah das andere an. "Oh!" rief Gritta, "hier müssen wir fort!" "Wir
wollen in die weite Welt ziehen", meinten alle, "und Mermeta mitnehmen und sie zu ihrem Vater und ihrer Mutter bringen." - Am Abend war alles versammelt in einem großen Saal, da wurde von den
Heiligen gelesen und gebetet. "Die heilige Petrea", fing die alte Nonne an herzuschnarren, wie sie sich gesetzt hatte, "war eine Heilige vom ersten heiligen Kaliber, sie wollte an nichts Anteil
haben auf diesem Erdenrunde. Die heilige Unnütziata hielt sich ein Lämmlein, die heilige Selleria einen Piepmatz und noch mehrere Heilige hielten sich so Gott wohlgefällige Tierchen; das dürfen
so Heilige wohl tun, aber nicht Menschen, die sich zum Geruch der Heiligung so wenig anlassen, wie ein Ziegenbock." Sie warf einen drohenden Blick auf Mermeta. "Sie war sogar so fromm, dass sie
ein vom Himmel Gesandtes Tier vor ihrer Tür hinweg wies und zu Gott. Vater sprach: 'Ich will an nichts auf dieser Welt Teil haben', worüber sich Gott-Vater selber wunderte und ihr großes Lob
zusprach. Und sie schlug mit Geißelhieben um sich, wenn sie sah, dass einer Freude hatte an einem Sonnenstrahl, der durch die Fenster drang! Ja, ja, das war eine Frau; aber die Geschichte
schreibt auch von ihr, dass Gott-Vater in großer Verlegenheit war, wo er mit dem heiligen Tier hin solle! Es war die jetzt so bekannte Eichkatze. Gott-Vater hatte ihm im Eifer den Weihwasserwedel
zum Schwanz gemacht und auch den Instinkt gegeben, das Schwänzchen dazu zu benutzen; er setzte es daher auf einen grünen Baum und richtete seinen Magen zum Buchkernfressen ein; als es aber danach
einer alten Dame den Ofenschirm beschmutzte, nahm er ihm alles Heilige. Doch jetzt fängt die Legende an." Sie schlug ein dickes Buch auf, und bald lag alles auf den Stühlen im Schlaf. - Es war
eine Stunde später, als sie in den Schlafsaal zu Bette mussten. Kaum war die alte Sequestra hinter der Türe verschwunden und alles still, so fingen die Kinder an unter einander zu sprechen.
"Ach!" rief Gritta, "könnten wir sie befreien!" - "Könnten wir fort!" riefen die andern. "Unsere Eltern beschwätzt gewiss die Alte, dass sie uns hier lassen." "Ach!" rief Wildebeere, "ich möchte
so gern in den Wald und die gute Pflanze Klares, die für den Magen ist, endlich finden; ich blieb damals dabei stehen, als ich medizinische Pflanzen suchen lernen musste." - "Ein eingemauertes
Nönnchen werden, das mag ich nicht", sagte ein anderes Kind. Sie fingen jetzt an, aus den Betten zu springen und haschten einander in dem weiten Saale, doch es knisterte draußen vor der Tür.
Alles flog in die Betten; die Nonne Sequestra trat herein mit einer Kerze in der Hand, sie beleuchtete die mit Herzklopfen sich schlafend Stellenden und ging; noch ein Weilchen flüsterten Gritta
und Margareta, dann ward im Saale alles still. Der andere Morgen war Sonntag. Nach der Messe war die Mermeta hinausgeschickt, die reifen Beeren von den Johannissträuchern zu lesen. Gritta sah sie
im Garten hin und wieder gehen, sagte der alten Sequestra, sie wolle auch Beeren lesen, und war in zwei Sätzen davon; bald war sie an ihrer Seite. Die Sonne beschien das Gesicht der jungen Nonne.
"Ach!" sagte Gritta, indem sie zu ihr aufsah, "möchtest du denn ewig im Kloster bleiben?" Sie sah Gritta verwundert an. "Willst du nicht auch mit uns in die Freiheit kommen?" Sie schüttelte
traurig den Kopf. "Komm, wir wollen fort." - Es fingen die Glocken an, zum zweiten Gebet zu läuten. Sie ging. Gritta wollte noch einmal zurück in den Saal, da sah sie an der Klosterpforte die
alte Sequestra bei dem Pater stehen, den Gritta nicht leiden konnte und der alle Tage kam. Die Alte meinte, alles sei beim Beten versammelt, und rief ihm lauter nach: "Nun gut, kommt heute Abend
durch den Rauchfang! Ich habe Euch etwas über das Schloss von Rattenzuhausbeiuns zu sagen." Gritta lief fort, der kleine Pater grinste, und die Klosterpforte Schloss sich hinter ihm.
"Die Kinder wären ewig im Kloster geblieben und hätten ihr eingemauertes Leben fortgeführt", sagte Gritta später oft, "hätte ich dies nicht gehört." - Der Sturm tobte am Abend selbigen Tages, der
Regen strömte aus den Drachenmäulern, am Dach rauschte das Wasser herab und die kleinen Springbrunnen hüpften, gedrückt vom Regen wie die weißen Kobolde in der Nacht. Es war die zwölfte Stunde.
Der Wind zog durch das Kloster, die Steintreppen herab durch die Gänge; es knisterten dort, wo das Holz zum Brennen stand, leise Tritte. Es war Gritta, die allein den Gang entlang schlich; der
Wind spielte mit ihrem weißen Hemdchen, und ihre bloßen Füße zitterten auf den kalten Steinen. Sie schlich sich der Seite zu, wo die alte Nonne wohnte; als sie vor den Kamin kam, öffnete sie das
vom Winde klagende Türchen; hier hatte sie früher, als die dienende Nonne krank war, eingeheizt und ein Loch bemerkt von einem herausgefallenen Steinchen, wodurch man in die Zelle der Alten sehen
konnte; damals hatte sie es nicht gewagt. Der Regen drückte den Rauch herab in den Schornstein; ein Lichtstrahl drang durch das Loch; sie kuckte hinein. Ein hochgewölbter Raum von grauer Farbe,
mit vielen Schränken und einem großmächtigen Kamin. Auf den Schränken standen Kessel und allerlei wunderlich Zeug, in der Mitte ein viereckiger Tisch; vor dem saß im hohen Lehnstuhl die Alte, die
Augenbrauen fürchterlich drohend zusammengezogen. Die Lampe warf einen hellen Schein auf ihr Gesicht und ließ all die Runzeln fast eines Säkulums sehen; sie rieb die mageren Hände, dass es
knackte. Vor ihr lag ein Buch mit wunderlichen Buchstaben und Zeichen, von bunter Farbe durcheinander geschlungen; sie bog zuweilen sich vor, guckte nach dem Kamin und fiel wieder in den Stuhl
zurück, aus dem dann große Staubwolken herausflogen. Plötzlich drückte sich im Kamin, in dem nur ein sparsames Feuer brannte, der Rauch nieder; es erschienen ein Paar Füße, glitten über die
rauchende Glut hinab, und der Mönch stand im Zimmer. Er schüttelte den Regen von der braunen Kutte. Gritta standen vor Schrecken die Haare zu Berge. Die Alte richtete sich auf und rief. "Guten
Abend, Herr Pater!" Er schlurrte mit den Sandalen über den Boden zu ihr hin, setzte sich an ihre Seite und stützte sich auf. Während der Regen gegen die Fenster stürmte, begann ein Gespräch: -
"War die Ratte schon da? Sie hat es bestimmt auf heut Abend versprochen!" - Sequestra schüttelte den Kopf. - Sie schwiegen; nach einer Weile hob er an: "Ob sie wohl schon das Pergament zerfressen
hat? - Ich bin mit dem Vormund zusammen gekommen; er behauptet steif und fest, er könne nichts dafür, dass die Gräfin den alten Grafen geheiratet habe; ihr Vermögen und sie hätte er sonst sicher
ins Kloster geschafft. Wir würden es noch bekommen; das Testament läge bei ihr, sagte er mir noch einmal, die Abschrift wolle er vernichten. Hat nun die Ratte das Testament zerfressen, so haben
wir gewonnen Spiel, dann wäre bloß noch das Letzte der Mutter da, als Witwe, wonach das Vermögen uns zufällt, wenn sie nicht ins Kloster geht." In diesem Augenblick raschelte es; etwas Dunkles
entwickelte sich aus einem Loche unter dem Kamine, in dem die Kohlen nur noch Funken sprühten, und heraus kam eine Ratte. Sie stellte sich aufrecht und putzte sich mit der Pfote den langen Bart,
ganz gräulich, räusperte sich und fing zu reden an, wobei sie gemütlich brummte, so dass die Alte aufguckte. "Ich habe der Gräfin die Vermachung gefressen; es schmeckte nicht übel, denn das
Pergament war fett aus Rache, dass sie das kleine Ding, die Gritta, in die weite Welt geschickt hat. Der alte Müffert sagte zwar, unterwegs sei ihm das Kind entlaufen; aber Leute von unserm
Verstande glauben das nicht, obwohl er sich jämmerlich anstellte. Der alte Graf hat ihn davon gejagt und ist, o Wunder! schwermütig geworden und bedauert, oft nicht zuckersüß gegen das Kind
gewesen zu sein." Hier endigte die Ratte, wartete ein Weilchen, aber da die Alte schwieg, sprach sie: "Jetzt verlang' ich meinen Lohn." - Sequestra öffnete ein altes schnörkeliges Schränkchen, in
dem Töpfe und Phiolen standen, und holte ein lieblich duftendes Schmalztöpfchen heraus. Der Pater sah neidisch die Ratte an.
"Du allerliebster Schrank,
Mit deinem Inhalt süß!
Knappert sich's Rätzlein ein Löchlein drein,
So wird's bald so fett wie's Paterlein sein."
So sang die Ratte und verschwand. Jetzt begannen die beiden ein tolles Wesen: die Alte holte einen Kessel, mit kuriosen Zeichen eingegraben, holte Kräuter aus allen Ecken; der Kessel brauste, die
Kohlen leuchteten. "Niemand weiß", hob die Alte an, "dass das Kind Gritta hier ist; lebt nun der alte Graf nicht mehr, dann wird sie wohl Nonne sein, und wir treten mit ihren Ansprüchen auf die
alte Burg hervor. - "Und dort", sagte der Pater, seine Augen glühten und kugelten vergnügt in seinem Kopf herum, indem er schnell über seine Brust strich und, an den Bauch kommend, diesen sanft
klopfte, "dort werde ich mir eine Klause bauen, mich einnisten und auf das schlechte Menschengeschlecht herabblicken, es regieren. Was wird dann aus den übrigen Schäfchen?" "Oh, ich habe die
Väter und Mütter schon alle beredet, sie hier zu lassen. - Der Pater lächelte befriedigt. Gritta schlich schnell zurück durch die Gänge. Alles schlief, nur Margareta, die es wusste, wartete
ängstlich. Nachdem sie zu ihr ins Bett geschlüpft war, erzählte sie, was sie gehört und gesehen hatte, und die beiden Kinder berieten sich, wie sie alle entfliehen könnten. Gritta hatte seit
einiger Zeit, als sie an der Klostermauer auf- und abspazierte und an die Freiheit dachte, ein paar lose Steine in der Mauer gesehen; wie sie nun so dastand und bedachte, wie man sie loslösen
könne, dass es ein Loch würde um zu entwischen, bemerkte sie, dass kleine Steine über die Mauer und vor ihr in den Sand flogen. Neugierig hob sie eins auf, das ihr zu Füßen gefallen, und sieh, es
war deutlich der Name Ingurd auf das Steinchen geschrieben. Sogleich erinnerte sie sich, dass oft, wenn sie mit der jungen Nonne allein gewesen war, diese ihr von ihrem Bruder Ingurd erzählte; er
hätte gesagt, da er noch nicht erwachsen und sie im Kloster besuchte, wo sie schon als Kind war, er wolle sie aus dem Kloster holen, und wenn er hundert Jahre um das alte Gemäuer streichen müsse.
Sie schwieg dann jedes Mal traurig still. Schnell holte Gritta eine Kohle und schrieb, so gut sie konnte, "Mermeta" auf ein Steinchen; sie zielte, und es flog über die Mauer. Sie wartete nicht
lange, so flog ein Stein vor ihr nieder; ein kleiner Brief war darangebunden, hastig machte sie ihn ab; oben drauf stand "Mermeta". Nach den Metten, als sie entwischen konnte, lief sie in
Mermetas Zelle, wo diese eifrig spann. Gritta hockte nieder und schaute ihr unter die Augen, dann fing sie an: "Mermeta! Mermeta, willst du mit uns fort? - Willst du? - Wir können fort." Diese
sah erstaunt auf. - "Komm, du kannst!" - "Das geht nicht", sagte Mermeta. - "Wie soll man je aus diesen Mauern heraus kommen? Und wenn ihr auch es könntet, ich gehe nicht." "Da! - sagte Gritta
und schob ihr das Briefchen in die Hand und lief davon, weil sie die Schritte der alten Sequestra in der Ferne hörte. Am anderen Morgen kam Mermeta an ihr vorbei gegangen. "Ich gehe", sagte sie
leise, indem sie auf das Briefchen in der Hand zeigte.
................................................................................
Es war eine milde Nacht, ein schöner Nachthimmel mit glänzenden Sternen übersät. Die Gebüsche des Klostergartens malten stille ihren Schatten auf den weißen Sand der Gänge, die Nachtigall erhob
zuweilen ihre Stimme, die an der Klostermauer widerhallte. Muttergottesgläschen, Herrgottschuhen, Kressida, die rote Frauentreu, Treuherzleinkraut schlummerten still in der Ecke an der Mauer mit
einigen sehr werten Gästen besetzt; Marienkäferlein, Johanniswürmchen und andere, die nächtlich etwas benebelt von der Schenke zurückkamen und bei ihnen eingekehrt waren. Die Ruhe unterbrach ein
niedriges Fenster, das sich am Turm des Seitenflügels öffnete; eine weiße Gestalt erschien auf dem Sims, nahm einen Ansatz und sprang auf den grünen Rasen nieder. Frau Nachtigall schwieg erstaunt
und hüpfte von Zweig zu Zweig, dem Ereignis neugierig näher. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop folgten zehn andere; sie erhoben sich, angekommen auf dem tauigen Gras, und
schüttelten von den weißen Hemdchen den Tau. "Habt ihr", fragte Gritta, "nun Herz und Mut?" "Ach ja, ach ja!" flüsterten alle durcheinander. "So kommt fix, wir wollen die losen Steine, die ich in
der Mauer gesehen, herausnehmen. Margareta, Kamilla, Wildebeere, Veronika, Maieli, Petrina, Reseda, Lieschen, Elfried, Anna: folgt mir!" Die andern tappten leise hintendrein, und so gelangten sie
an den Ort mit dem eingefallenen Stein. Sie fingen an der dicken Mauer an zu arbeiten. Frau Nachtigall schlug dazu aus voller Kehle, als wolle sie den Lärm decken. Kalk und Mörtel fielen, bald
war das Loch gemacht. Petrina steckte den Kopf durch, draußen war der finstere Wald. Sie kroch weiter, es ging, das Loch war groß genug. "Jetzt kommt!" rief die Hochgräfin. Sie kletterten zurück
in das Fenster, wo sie herausgekommen waren, schlupften durch die langen Gänge in den mondhellen Schlafsaal, jedes setzte sich emsig und packte sein Bündelchen, indem sie leise flüsterten. - Es
schien, als schaute der alte Ritter, der an der Wand in Stein gehauen Wache hielt, mit lachendem Gesicht zu, und ließ sie vergnügt laufen; sein Steinschwert blieb in Ruhe an seiner Seite. Denn
die kleine Hochgräfin, deren Bettchen unter seinem Schutze stand, hatte ihm alle Woche einmal sein Gesicht und sein Wams gewaschen und den Schwalben, die in seinem Helmhut Wohnung hatten und
durch eine ausgebrochene Fensterscheibe Aus- und Eingang fanden, immer Futter gestreut. Ob er nun froh war, dass sie ihn nicht mehr waschen werde, denn alte Ritter lieben die Reinlichkeit nicht
sehr, oder ob er sich freute, dass seine waschende Wohltäterin aus dem alten Neste hinweg käme, in dem er sich schon gewiss viele Jahre langweilt, immer den Appetit des Gähnens unterdrückend,
weil das unnatürlich gewesen wäre für ein Steinbild? Das Letzte wird's gewesen sein, denn er machte ein freundliches Gesicht, in das sich hie und da eine kleine Wehmut einschlich über das
Verlieren seiner lieben Gesellschaft. Bis zu einem gewissen Grad des Mienenspiels dürfen es selbst Steinbilder bringen. Ein träumerisches Piepen ließ sich in seinem Helmhut vernehmen. "Ach",
sagte die Hochgräfin, "jetzt sind die Kleinen schon heraus; streut ihnen noch Futter, derweil geh' ich und hole Mermeta. Sind die Vögel gefüttert, so schlüpft wieder durchs Fenster in den Garten
und wartet auf mich." Gritta ging und fand Mermeta noch schlafend in ihrer mondbeschienenen Zelle; sie schlüpfte schnell in ihr Gewand. "Hast du denn ganz vergessen, dass wir fort müssen?" fragte
Gritta. "Ach nein, mir träumte, wir wären schon fort. Wenn uns die alte Nonne nur nicht in den Gängen hört, denn sie macht manchmal des Nachts die Runde." - Beide sahen ängstlich in die
Finsternis der Gänge; es blieb ruhig. Die Nonne steckte in der Eile dem Marienbild im Kreuzgang noch ein Sträußchen an den Busen, mit der Bitte, sie auf ihrer Flucht zu schützen. Sie kletterten
dann durchs Fenster in den Garten, der öde ruhig da lag. Die andern standen schon am Loch; sie winkten den alten Mauern noch Ade zu, und Gritta kroch voran, die andern folgten. Aber das Loch war
etwas zu klein für Mermeta, die in Angst davor stand; sie warfen ihre Bündel ab und arbeiteten aus allen Kräften an den Steinen, die bald fielen. Mermeta kam hindurch, sie schauten sich
verwundert um. Durch die Baumstämme wehte die Waldluft, die Blätter flüsterten über ihnen, die Grashalme beugten sich knisternd mit den gefallenen Blättern unter ihren Füßen, und die wilden
Sträucher fassten vertraulich ihre Kleider. So gingen sie schnell fort. Es wollte bald Tag werden; das Nönnchen schaute sich nach allen Seiten um; wenn ein Vogel aufflog, schrak sie zusammen. Aus
der Dämmerung ward Tag; die Sonnenstrahlen brachen gleich goldnen Fäden durch das Waldlaub, die Vögel fingen an zu singen. "Werden sie uns nicht verfolgen?" fragte Margareta an Grittas Seite
kommend. "Nun, die alten Nonnen werden uns doch nicht selber nachlaufen, am Abend kommt erst der Pater", sagte diese. Sie kamen auf einen freien Platz, in der Ferne lag wieder ein Wald. "Hier",
sagte Gritta, "muss dein Bruder sein, wie er dir schrieb." Sie schaute in die Weite. "Ach, dort seh' ich einen Jägerrock glänzen!" - Das Nönnchen lief auf ihn zu, er ihr entgegen. Sie gingen im
Gespräch nach dem Walde, ihr weißer Schleier wehte noch lange durch die Bäume; die Kinder sahen nach, sie war verschwunden in der Waldeinsamkeit. "Nur zu, mir nach!" rief Gritta und wischte sich
ein Tränchen ab. "Wir wandern in die Stadt, wo meiner Mutter Amme wohnt; sie strickte mir einmal, als sie mich besuchte, ein Band um meinen Leib, und bei jeder neuen Blume, die hinein kam, musste
ich eine neue Stadt auswendig lernen, nach der Reihe alle, durch die der Weg zu ihr führt, damit ich's wisse, wenn ich sie einst besuchen wolle. Sehen wir Leute, so fragen wir nach der ersten
Stadt, und so fragen wir uns weiter. Kommen wir dann bei ihr an, so gibt sie uns Rat, wie ich ein jedes von euch zu seinen Eltern führe."
Sie wurden fröhlicher, je mehr sie vom Kloster abkamen. Der Mittag kam mit heißen Strahlen, sie tranken in vollen Zügen die Sommerluft. Wildebeere lief in der Ferne Zickzack, mit von der heißen
Stirn fliegenden Haaren, erhitzten, von Dornen zerkratzten Backen, einen großen Büschel Pflanzen und Gräser in der Hand. Aus der Tasche in ihrem Rock kuckte eine große sonderbare Blume, sie hielt
den Strauß von Zeit zu Zeit an die Nase oder bückte sich und rupfte hier und dort ein Kräutchen aus und bohrte an einem Wurzelchen in der Erde, bei der Sonnenhitze, bis sie es heraus hatte. Es
war eine rechte Sommerruhe; die Fliegen schwirrten daher, die Butterblumen und andere Feldblumen standen in voller Pracht recht in der Sonne auf dem Felde, die liebwerteste Hochgräfin wälzte sich
im Gras und Butterblumen wie ein mutiges Böcklein, bis sie still liegen blieb bei einem Erlengebüsch, deren mehrere hier verteilt standen und worin die Mücken summten. Die anderen hatten sich
auch da niedergelassen; eine Spinne in schläfriger Weise spann ihr einen Faden über die Nase; sie schaute gen Himmel und sang:
Ich dehne die Glieder in feuchtem Moose
Und fühle mich selber so zart, so fein.
In Blättergezweig, da lieg' ich so rein,
Und neben mir nicket die moosige Rose.
Mit meinen Augen kann ich nur blinzeln
Den blauen klarlichen Himmel an.
Es ziehen die Wölkchen so duftig so fein,
Am blaulichen Himmel, durchgoldet vom Schein
Der breitenden Sonne, die lieblich gleitet
In Strahlenwonne.
Käfer ziehen mit den kleinen,
Wohlbehaarten feinen Beinen,
Durch die Gräschen, durch die Möschen,
Bleiben hängen an den Höschen.
Eine Biene steckt ihr Köpfchen
In ein blaues Blumenglöckchen,
Von der Mittagsruhe trunken;
Tänzelnd mit den kleinen Beinen
Ist in Schlaf sie schon versunken.
Gritta steckte den Kopf aus dem Gras, um nach den Mähern zu sehen, die rund umher Heu machten. Als sie sich wendete nach dem dicht am Gebüsch vorbeilaufenden Pfad, rief sie erschrocken: "Gott,
das Paterchen! Ich sah' ihn, er kommt den Weg entlang." "Still, hier in den Graben!" rief Margareta; sie krochen alle durchs Gras und legten sich platt in den tiefen trocknen Graben dicht am Weg;
aber Wildebeere fehlte. "O, wenn sie nur nicht kommt", sagte Gritta, "wenn er gerade vorbei kommt!" Sie lagen mäuschenstill. Des Paters Schritt kam näher, er ging vorbei. Margareta reckte zuerst
den Kopf aus dem Graben und sah ihm nach, wie der Staub seine Gestalt verhüllte. "Ach", sagte sie, "was mögen die Alten gesagt haben, als sie das Nest leer fanden!" - "Sie werden lernen", meinte
Gritta, "dass die Vögel ihre Flügel gebrauchen." Sie lagerten sich wieder ins Grüne, um etwas zu ruhen, ehe sie weiter gingen. Wildebeere erschien mit einem ungeheueren Busch Kräuter und
Pflanzen. Sie roch, untersuchte, sortierte und hielt dann ein Kollegium über sie, bis sie zuletzt vom Hundersten ins Tausendste, auch auf ihren Vater und seine vielen Spiritusgläser und
getrockneten Pflanzen kam, die sie so gern gehabt; wie er in einem blumierten Schlafrock dazwischen herumwandelte und die einzelnen Blätter ihr zerlegt und die Namen hergesagt, bis sie diese
auswendig wusste. So erzählte sie, bis sie bloß Gräsern und Wiesenblumen vorsprach, da alles in sanftem Schlummer lag. Sie weckte sie, und nachdem sie etwas mitgenommenes trocknes Brot verzehrt
hatten, ging's weiter. Sie fragten die Landleute nach dem nächsten Ort, und sieh, es war einer von denen, die zur alten Amme führten. Es wurde dämmerig. Büsche und Hügel lagen nur noch wie ein
Schatten auf der Erde. Die Kinder fassten sich enger bei den Händen; eins schritt hinter dem andere, niemand begegnete ihnen. Als es ganz Nacht wurde, fühlte sich Gritta, die voranging, nur mit
den Füßen fort. - Auf einmal waren sie vom Wege ab; Gritta stolperte und irrte hin und her. So ging es lange im Finstern fort; da blickte ein Lichtchen von ferne, was in einem Hause zu leuchten
schien. "Dort wollen wir sehen, ob wir einen Ort zum Schlafen finden. - "Die Sterne könnten sich auch ein wenig heller schnauben, dass man besser sähe." "Vielleicht finden wir dort eine Scheuer
oder sonst Herberge." Sie gingen auf das einsame Haus zu; es war weiter, als sie dachten. Bald war es nicht mehr vor einem Hügel zu sehen, bald verschwand es hinter Bäumen, endlich standen sie
davor; es war ein Haus mit mehreren Nebengebäuden. "Sollen wir ins Fenster sehen?" fragte Lieschen. "Ich hab' auch schon daran gedacht", meinte Gritta. "Wie machen wir's?" fragten die andern.
"Ei, eins steigt aufs andre; ich bin die Stärkste", sagte Margareta, "ich stelle mich unten hin." "Und ich oben auf", rief Petrina. Margareta stellte sich unter das Fenster, die andere halfen
Petrina hinauf; sie guckte durch die angehauchten Fensterscheiben. "Was siehst du?" flüsterten die unten. "Ach, fürchterlich!" - "Was denn, was denn?" fragten sie in Angst. "Ein Mann mit" -
"Womit, womit?" - "Mit einem fürchterlichen Schnurrbart! - das Zimmer schwimmt voll Blut!" - "Was?" - fragten die unten. - Margareta rührte sich unter ihr, als habe sie Lust davon zu laufen. "Ach
was", fuhr Petrina fort, "er weidet Hasen mit einem alten Mütterchen aus, jetzt sagt er was!" - Sie legte das Ohr ans Fenster: "Er sagt, es sei gut, dass ihn die Schnapphähne, die königlichen
Jäger, bei der Eiche nicht erwischt." Petrina schwieg und bereitete sich zum Herabsteigen, als Margareta wankte und das Schaugebäude mit Gepolter zusammenfiel. Die kleine Kamilla hatte an
Margareta hinauf zu klettern versucht, um den fürchterlichen Mann zu sehen, und sie so wankend gemacht. Alle drei erhoben sich schnell aus dem Staube und folgten den am Haus im Dunklen entlang
Tappenden. Das Fenster wurde unterdessen aufgemacht, ein Mann mit grauem Hut, einer Wildhahnfeder darauf und einem Pfeifenstummel im Mund, brummte heraus. Da er aber nichts sah, Schloss er den
Laden. - Die Kinder kamen an das Nebengebäude. "Ei", rief Gritta, "hier riecht es nach Mist! - Ach, wenn wir hier Quartier im Kuhstall fänden, aber dass es der garstige Mann nicht merkt. Ach ja!
Wir verstecken uns unter das Heu, wir sind so müde." Gritta suchte einen Eingang; sie kamen an das Hoftor, wo die Heuwagen durchfahren, und sahen durch ein Türchen im Torflügel, das offen war,
hinein. - Als sie niemand merkten, gingen sie hinein und schlichen an der Seitenmauer entlang. Als einziges Unglück passierte, dass sie einen Besen und Schippe umwarfen und der Hofhund an der
Kette in der Ecke zu knurren anfing. - Auf einmal verschwand die kleine Hochgräfin vor den Augen Margaretens. Mutig, aber erschrocken folgte diese und verschwand auch. - Die andern im Nachkommen
sahen es nicht, und alle waren wie von der Erde weggeblasen. Wildebeere passte auf, ging verwundert wie die Katze um den Brei von der Seite ab und fand alle wohlgemut in der weichen Mistkute. Als
sie wieder herausgekrabbelt waren, gingen sie auf die Stalltür zu. Gritta kuckte vorsichtig in den matt erleuchteten Stall. Es war niemand drinnen; sie lief in die fernste dunkle Ecke auf einen
Heukasten zu, kletterte über die Außenwand und versank ins weiche Heu; die Übrigen taten es ihr nach. Sie schüttelten das Heu über sich auf, und begannen zu plaudern. Eine kleine trübe
Stalllaterne brannte, und verbreitete ein mattes Licht. Die Kühe käuten wieder; ihre Hörner ragten aus der Dunkelheit über die gefüllten Krippen, der Brummelochse, auf der reinlichen Streu
gelagert, brummelte behaglich; es war eine angenehme Stallviehwärme. An der Decke zwitscherten die jungen Schwalben in den Nestern unter den Mutterflügeln. "Ach, wie schön ist's hier!" sagte
Gritta, mit den andern flüsternd; doch bald kam der Schlaf, und es wurde still im Heukasten. Sie hatten nicht gemerkt, dass Wildebeere, um ihre Kräuter zu untersuchen, aus dem Kasten gestiegen
war und sich in die Krippe vor dem Brummelochsen gesetzt hatte, der sich wiederkäuend niedergelegt. Kamilla sah ihr neugierig nach und saß ruhig in der Krippe vor einer Kuh mit weißem Blesschen.
Sie schaute sich im großen Stall um, und als sie sich genug umgeschaut, langweilte sie sich, ging wieder in den Kasten und steckte zuweilen den Kopf aus dem Heu und sah, was Wildebeere machte;
diese hatte sich ruhig nach vollbrachter Forschung und nachdem sie dem Brummelochsen in seiner Frisur herum gekratzt, zum annehmlichen Brummen desselben, unter das Heu in die Krippe gelegt.
Gritta wachte ein paar Mal auf; sie hatte sich vorgenommen, mit ausdauernd festem Willen, morgen in der Frühe, ehe ein Mensch in den Stall kommen werde, mit allen auf und davon zu ziehen. Sie war
eben ein bisschen eingenickt gewesen und erwachte, da eine graue Dämmerung den Morgen verkündete; sie weckte die andern, als sie die Schritte eines Mannes auf den Stall zukommen hörte; sie guckte
aus dem Heu, wirklich war es der fürchterliche Mann von gestern. - Er ging zu einem Gaul, der vor einer Krippe in dem feinsten Winkel stand; derweil steckte Kamilla auch den Kopf ein wenig heraus
und sah nach Wildebeere. O Wunder! Der fressende freundschaftliche Brummelochs hatte das Heu oben abgefressen und, die herrlichen Blumen in Wildebeerens Tasche witternd, diese samt den andern
Kräutern, die aus dem Röckchen guckten, mit geschwinder Zunge eingerafft; er kaute dabei an dem halben Rocke mit. Es war schon ein ziemliches Stück in seinem Maule verschwunden; Wildebeere
schwieg und ließ sich mit Ruhe einschlingen, da sie den Mann mit dem Pferde sah und fürchtete, sie alle zu verraten. Kaum hatte Kamilla dies entdeckt, so fing sie aus vollem Halse an zu schreien:
"Er frisst sie, er frisst sie!" duckte sich aber, erschrocken über ihre eigene Stimme, schnell unters Heu. Der Mann blickte erstaunt um, sah nichts, bis zufällig sein suchender Blick auch hinter
den Brummelochs kam. - Er lief darauf zu und zerrte unter lachendem Erstaunen an dem Röckchen in des Ochsen Hals. Als Gritta bemerkte, dass er mit Wildebeere beschäftigt, so sprang sie so leise
als möglich aus dem Heukasten, die andern ihr nach, zur Tür hinaus. Der Mann, mit Wildebeere zu sehr beschäftigt, merkte es nicht. Sie rannten spornstreichs über den Hof, und die alte Frau, die,
ihnen den Rücken zugewendet, mit den Hühnern sprach, über den Haufen. Nun ging's übers Feld in atemloser Eile dem nahen Walde zu; hier blieben sie stehen. "Was soll nun werden?" fragte Margareta.
- "Ei", sagte Gritta, "er wird sie ein bisschen zanken und dann laufen lassen; denn sie hat doch bloß in seinem Heu geschlafen. Wären wir alle geblieben, so hätte er sich verwundert. Es wäre ihm
aufgefallen, und er hätte uns am Ende mit Sack und Pack wieder ins Kloster geschickt. lässt er sie nicht fort, nun, dann müssen wir Mut fassen und sie wieder holen." "Womit denn?" fragte
Margareta. Gritta schaute sich verlegen um. "Ich hab' einen Stock", sagte Kamilla. - "Aber weiter nichts", meinte Gritta. So warteten sie mit ängstlichen Herzen. Der Mann hatte unterdessen
Wildebeere befreit; als sie auf zwei Füßen stand, guckte sie betrübt auf den Überrest der herrlichen Blumen, die sie gefunden. "Nun!" sagte der Mann. "Was denn?" fragte Wildebeere, indem sie sein
Gesicht im grauen Hütel mit den Hahnenfedern ansah und bemerkte, wie es so ganz außer der großen Nase zusammengeschrumpelt und wie die Augen so herzhaft pfiffig daraus hervorleuchteten. "Wie,
glaubst du vielleicht, dass meine Kühe Menschenfresser sind? - Wo bist du her? Was hast du für einen Namen, kleiner Krippenreuter, oder stammst du vielleicht ab von der großen Familie der
Landstreicher? - Du sollst hier bleiben, meine Magd werden und meiner alten Schwester beistehen! Ja, ja, sieh nur nicht so drein." - "Ei", sagte Wildebeere, "Mann hinterm Busch! Häschenjäger ohne
Patent, ich bleibe nicht, du hältst mich nicht." - "Jetzt musst du hier bleiben!" rief der Alte zornig, "woher weißt du das?" - "Ja, aber meine Kameraden melden es, wenn du mich nicht fortlässt;
die haben auch durchs Fenster gesehen gestern." "Potz", rief der Alte, "wie dumm, dass ich vergaß, den Laden zu schließen! Ich will dich laufen lassen, aber du versprichst mir, dass ihr nichts
sagt!" - "Ja!" rief Wildebeere und lief zum Tore hinaus. - Als sie über die Wiese daher gesprungen kam, freuten sich die andern. Sie gingen ein Stückchen in den Wald, bis sie dem Hause fern
waren. So gingen sie den heißen Tag durch, alle sprangen herum, Wildebeere lief wie ein lebendiger Heuwagen auf der Wiese voll Blumen. Als es dämmrig worden, sahen sie in der Ferne ein Städtchen.
"Nicht wahr, Margareta", sagte Gritta, "Wir haben einen leeren Magen; ich will in die Stadt gehen und sehen, ob der Zufall was gibt. Ihr geht derweil tief in den Wald, nicht weit von der Stadt;
und findet ihr dort einen Platz zum Schlafen in der Nacht, So schickt eins zurück an den Waldrand, das mich sieht, wenn ich komme, und mich hinführt." - Die Kinder gingen nun nach dem Wald,
Gritta dem Städtchen im Tal zu. Sie kam unbemerkt durchs Tor auf einen runden Platz voll alter Häuserchen. - Die Bürger saßen vor den Haustüren und bliesen Wolken aus ihren Pfeifen; die
Schornsteine rauchten, und die Hausfrauen bereiteten das Abendessen; die Kinder tummelten sich von einem Flur in den andern, und Gritta schaute die verwandten Seelen mit Wehmut an. Für jedes war
ein Schüsselchen gedeckt an seiner Mutter Tisch. Aber bald saß sie ja auch bei den andern im Walde und aß mit ihnen! Aber was denn? - Ein Lädchen mit vielen Wecken glänzte ihr entgegen: durch die
Fenster schauten die Bretzeln mit glänzenden Gesichtern; die Leute gingen aus und ein, und das Ladentürchen bimmelte. Gritta griff in ihre Tasche, aber es waren nur Brotkrümel darin, und für sie
das weckvolle Himmelreich verschlossen; einige Tränchen liefen ihre Wangen herunter. Sie wandte ihre Augen suchend hin und her; als sie zur Erde schaute, gewahrte sie ein Kellerfenster, der
milden Abendluft geöffnet. - In der fernsten Ecke des Kellers standen ein Paar hohe Federbetten, - woraus ein Paar Mädchenköpfe schauten, bis unter die Nase zugedeckt. Ein Licht stand auf dem
Tisch, den Keller kaum erleuchtend; dabei saß ein schwarzer Kater und leckte sich behaglich. "Weißt du", hob die eine an, "ich bin begierig, wann der Bäcker die Perücke im Rauchfang unter den
Würsten findet." "Ei", sagte die andere lachend, indem sie ihre Nase aus den Federn kommen ließ, "warum hat er uns so früh des lieben Eigennutzes wegen, wie kein anderer Bäcker, geweckt? Jetzt
kann am Morgen sein Kopf frieren; er hat auch viel geboten dafür, wer ihm sage, wo sie sei." - Nun ging Gritta die Ladentreppe hinauf und öffnete das Reich der glänzenden Rosinenbretzeln. Auf
einem Brett stand eine Reihe von Kuchenmännern; sie waren braun und blinzelten mit ihren vergnügten Augen Gritta zu, beim hellen Licht einer Lampe an der Decke. Der Bäcker, ein kleiner Mann,
fragte sie, was sie wolle. "Wenn Ihr mir", sie hätte gar zu gern "Kuchenmännchen" gesagt, bedachte aber, dass ein Brot größer war und nützlicher für sie. "Wenn Ihr mir", sie stockte wieder, denn
ein Kuchenmännchen warf so liebevolle Blicke aus seinen Rosinenaugen auf sie, dass es ihr bis ans Herz ging. Nun nahm sie aber allen Heldenmut zusammen und sagte: "Wenn Ihr mir ein
Kuchenmännchen, ein Brot wollt' ich sagen, geben wollt, so will ich Euch sagen, wo Eure Perücke ist." "Wo?" rief der Bäcker. "Du kriegst einen Mariengroschen und sechs Kuchenmännchen dazu, wenn
du mir sagst, wer sie fort getan hat!" - Gritta warf einen sehnsüchtigen Blick nach den Kuchenmännchen empor. - "Nein, das kann ich nicht sagen; aber die Perücke hängt im Rauchfang." Der Bäcker
ging und nach einer Weile kam er wieder, noch röter vor Zorn wie vorher. "Da", sagte er, "hast du dein Brot und einen Mariengroschen, und sechs Kuchenmännchen sind dein, wenn du bekennst, wer die
Perücke versteckte." - "Das kann ich nicht." - Und Gritta war zur Tür hinaus, ehe der Bäcker weiter fragen konnte. - Drüben hingen Würste am Fleischerladen, und so wanderte für einen halben
Mariengroschen eine in ihre Tasche, und sie ging vergnügt zum Tore hinaus; hier fragte sie einen Mann, wie das nächste Städtchen heiße; sie waren richtig auf dem Wege zu ihrer Mutter Amme.
................................................................................
Vom Walde her kam ihr Margareta entgegen; sie erzählte ihr, was sie in der Stadt erlebt, während sie durch die dunklen Bäume gingen bis zum Platze, wo die andere waren. Sie hatten Feuer gemacht,
es leuchtete über das Gras; durch das dunkle Laub drängte sich der Rauch. Unten saß am Feuer, das lustig knisterte, Veronika und schaute zu dem Baum hinauf, in dessen Ästen Wildebeere saß.
Kamilla hatte ihren goldblonden Kopf behaglich in Veronikas Schoß gelegt und schaute mit ihren blauen Augen, in denen sich das Feuer friedlich spiegelte, in die Tiefe der Blätter. "Wo sind die
andern?" fragte Gritta. "Holz sammeln", sagten sie. Bald kehrten sie zurück mit Reisern bepackt. Margareta hängte die Wurst an einem Stock übers Feuer und briet sie. Das Feuer erleuchtete die mit
Heißhunger zuschauenden Augen, die bei jedem Schmalztröpflein, das herunterfloß von der lieblich duftenden Wurst, begehrlich blinkten. Margareta hatte sich gerade so gestellt, dass der Dampf
Wildebeere im Wipfel des Baumes gerade in die Nase stieg, damit sie herabkomme. - Sie blieb sitzen und blickte in den dunkelblauen Himmel, der mit Sternen übersäet durch die Zweige schimmerte.
Unterdessen aßen unten sich alle satt, und Gritta streute die Krumen in den Wald für die Vögel. Bald wurden die Kinder müde und streckten sich ins Gras. Gritta und Margareta saßen noch bei dem
verkohlenden Feuer. "Hör", sagte Gritta, "morgen gehen wir in die nächste Stadt und bleiben ein paar Tage, um auszuruhen. - Jedes sucht sich ein Unterkommen." Sie flüsterten noch leise, dann
versank Margareta im Schlaf; Gritta wachte, sie störte dann und wann in den Kohlen, doch schlief sie bald ein. Wildebeere weckte sie nicht, sie sah in die Ferne, ins nebliche Tal mit seinen
Wäldern. Das stille Dorf war zum Morgen erwacht mit seinen roten Ziegeln und Strohdächern; zwischen Busch, Wiese und Weißdornhecken stieg lieblich der bläuliche Rauch der Hütten in die Morgenluft
empor. Da hörte sie in der Ferne Jagdhörner und Hundebellen. "Wacht auf!" rief sie den andern herab, "die Jäger kommen." Die Mädchen erwachten und sprangen schnell auf und nahmen ihr Bündel.
Wildebeere glitt am Baume herab, und Gritta fing an zu singen; sie machten sich marschfertig und wanderten auf die nächste Stadt zu, die sie in der Ferne liegen sahen. "Dort", sagte Gritta,
"bleiben wir ein paar Tage." So besprachen sie sich, bis sie auf der Wiese anlangten vor dem Tore. "Hier", sagte Gritta, "finden wir uns nach sechs Tagen wieder zusammen." Nun trennten sie sich,
um durch verschiedene Tore einzugehen. Gritta ging durch das alte Tor, das vor ihnen lag, mit Margareta und Kamilla. Niemand bemerkte sie, denn es war Jahrmarkt und Sonntag, und die Spitzbuben
hatten geruhet, die werte Ortsobrigkeit in Bewegung zu setzen, deren Hauptteil die Torwärter waren. Die kleinen Häuser mit den Giebeln waren mit wasserspeienden Drachen belebt. - Sie kamen an
einen Röhrbrunnen, wo die kleinen Seegötter altadlichen Geschlechts wie zierlich aneinander gehängte Würstchen sich auf Delphinen balgten, die die Wasser aus ihren Nüstern springen ließen, in der
Mitte der Seegott mit dem Dreizack, ein fürchterlicher Mann, wie ein angeknapperter (wahrscheinlich durch die schlechte Behandlung der Gassenbuben) Spritzkuchen aussehend. Gritta sagte Margareta
und Kamilla Adieu und bog in ein gelbes Gässchen. Alles war still und öde, denn die Leute waren auf den Markt gegangen; da hörte sie eine Stimme aus einem kleinen grünen Hause zu einer Harfe
durch die offnen Fenster. Sie machte die Tür auf zur Seite des Hauses und ging die kleine, schiefgetretene Treppe hinauf, von der sie immer halb wieder herunter musste, um einen Ansatz zu nehmen
weiter zu kommen. Oben streckte ein Fliederbaum seine Zweige durch einen wurmstichigen Fensterrahmen; sie öffnete die Tür. Da saßen zwei alte Damen im Zimmer; die eine strickte an einem
ungeheueren Strumpf, über ihr saß ein Kanarienvogel im Käfig mit grünem Kraut behangen. - Neben einem großen Nußbaumschrank, auf dessen Sims, die schönsten Borsdorfer Äpfel aufgereiht bei alten
Kannen und Kaffeetassen standen, saß die andere, die zur Harfe sang. Sie wollte eben ein neues Lied anfangen, als sie sich umsah. "Was willst du, mein Kind?" fragte die Dame, von ihrem großen
Strumpf aufsehend. "Dienen!" sagte Gritta. - "Du bist zwar klein, aber für unsre Bedürfnisse groß genug. Du hast wohl gehört, dass unsere Grete fort ist, sie war nicht größer als du." - Sie
fragte Gritta nicht weiter viel und schickte sie in die Küche. Hier standen viel Tellerchen und Töpfchen, und es war recht heimlich und schön, denn das Kammerfenster führte in den Hof, wo der
Fliederbaum stand. Es ward Gritta bald heimisch bei den zwei alten Jungfern. Sie kochte in einer großen Kanne Kaffee, schüttelte die hohen Federbetten unter den weißen Thronbetthimmeln, und die
beiden Alten hatten sie gern, denn sie lachten behaglich, wenn sie den Kaffee gut gemacht hatte, und schauten mit ihren langen Nasen über die dampfende Tasse und klopften sie freundlich auf die
Wange. Oben im Hause hörte die kleine Gritta manchmal einen sonderbaren Lärm: es schrie und trampelte; auch hatte sie ein kleines Mädchen öfter gesehen am Abend hinaufschlüpfen, aber am Morgen
musste sie wohl früher weggehen, als Gritta erwachte. So viel sie in der Dunkelheit erkannte, hatte das wilde Kind eine Trommel auf dem Rücken und hielt etwas am Bande unter ihrer Schürze. - Am
Abend, wenn sie dachte, das Kind werde bald kommen, füllte sie ein Schüsselchen mit Brei und stellte es vor die Tür; denn es kam ihr vor, als müsste es hungrig sein. Nun guckte sie durch die
Türritze. Die Kleine kam die Treppe herauf, als sie aus der Dunkelheit hervorkam, sah sie eine Weile das Schüsselchen an, indem ihre großen Augen vor Verlangen glänzten; sie näherte sich, stellte
die Trommel hin und fing heftig an zu essen, dann holte sie ein kleines Murmeltier aus ihren schwarzen Locken hervor, das dort warm gesessen hatte; es sperrte seine schwarzen Augen auf und fraß
mit. In dem Augenblicke rührte sich Gritta hinter der Tür, das Mädchen schrak zusammen und floh. Das zweite Mal ging es wieder so; aber sie träumte den ganzen Tag von dem Mädchen. An einem Abend
wollten die beiden Damen ausgehen, ein großes Wagestück für sie, wegen der Treppe; sie wussten nie, ob sie wieder herauf würden können, wenn sie unten waren. - Sie gingen. Gritta legte die
Kienspäne zum hellen Feuer zurecht im Kamin und stellte diesmal das Schüsselchen auf die Erde in der Mitte der Küche, sperrte die Tür weit auf und stellte sich dahinter. Bald ging unten die Tür;
sie hörte herauftappen, sah durch die Ritze das Kind zum Schüsselchen laufen, patsch, warf Gritta die Tür zu und stand da. Die Kleine stürzte nach der Tür, Gritta hielt sie fest, obwohl sie
anfing zu kratzen und kniff und biss wie eine wilde Katze; so umschlang Gritta sie fest und legte, da sie stärker war, sie sacht zu Boden. Das Kind lag vor ihr, die Flamme im Kamin erhellte sein
Gesicht, die schwarzen Locken waren zurückgeflogen, es guckte mit seinen großen schwarzen Augen, in denen das Feuer sich spiegelte, Gritta wild an. "Halt, kleine Katze", sagte diese, "halt, sei
ganz still!" Die Kleine blieb liegen, indem sie nach der Tür blickte. Gritta holte einen rotbackigen Apfel und zeigte ihn ihr; da sprang sie auf den Apfel zu, blieb aber ein paar Schritte von ihr
stehen und starrte sie an. Gritta gab ihn ihr, und sie ward vertrauungsvoller; sie hockte vor dem Kamin und betrachtete ihren Apfel. Gritta setzte sich zu ihr und schlang ihren kleinen Arm um
sie; das ließ sie geschehen. Erst stieß sie einzelne Worte heraus, dann sprach sie lange, aber von Dingen, von denen Gritta nichts wusste. "Hast du einen Vater?" fragte Gritta. - "Was?" sagte die
Kleine, "der Mann mit dem Stock ist sehr böse!" - "Wer ist denn das?" - "Ja, ich war klein", sagte sie und besann sich, "da hat er mich weggenommen, wie ich draußen war bei den Bäumen." Sie
schwieg, dann sah sie erschrocken in die Höhe. "Ach!" rief sie, nach dem Murmeltierchen laufend, das überall in der Küche herumsprang, "ach, was wird er mich schlagen! Ach, Mädchen mache mir auf,
aber", flüsterte sie ihr zu, "ich laufe einmal davon." "Ach", rief Gritta, "bist du bei einem bösen Mann, der dich schlägt, - und hast weder Vater noch Mutter?" - Sie nickte. - "Willst du mit uns
ziehen, mit vielen kleinen Mädchen über Berg und Tal? Und haben wir sie zu ihren Eltern gebracht, dann kommst du mit mir nach Haus, und ich verlasse dich nicht, wenn du deinen Vater und Mutter
nicht findest. - Dann musst du aber morgen früh kommen, wenn es noch dämmert." Die Kleine nickte, dann nahm sie ihr Tier und rief: "Was wird er sagen, da ich heut so wenig verdient, und habe doch
den ganzen Tag an der Ecke der Straße gestanden mit meinem Tierchen und getrommelt." - Sie lief die Treppe hinauf, Gritta horchte ihr nach; als sie kaum oben war, hörte sie wieder lärmen. Gritta
langte den Besen hervor, lief die Treppe hinauf; da war eine wunderliche Wirtschaft auf dem Vorplatz, von schreienden Papageien und Affen, und in der Stube hörte sie zanken; aber auf einmal ward
es ganz still, Gritta schlich herunter in ihr Bettchen. Bald kamen die alten Damen. Sie schlief recht süß, bis die Morgensonne in die Küche schien; da dachte sie mit Trauern, dass das kleine
Mädchen wohl nicht kommen würde. Sie küsste ihre beiden alten Jungfern in den weißen Betten leise auf die Stirn und legte jeder eine Rose aufs Bette; dann ging sie herab, vor der Tür stand das
kleine Mädchen. Gritta war glücklich und gab ihr ihre Hand; so verließen sie das kleine, stille Haus. Die Hähne krähten den Morgen an, es war alles noch stille. Der alte Soldat marschierte
schnaufend in der Morgenluft vor dem Tor auf und ab; er sah die beiden Kinder nicht, weil man damals die Kragen so steif und hoch trug, dass man nur den Himmel sah, eine gute Gesellschaft; er
ging in gemütlicher Anschauung in ihr verloren hin und her. Die kleine Hochgräfin und Harmoni schlüpften zwischen ihm und der werten Stadtobrigkeit hindurch, da standen sie auf der betauten
Wiese. Die andern kamen schon und freuten sich, und bald war die kleine Harmoni heimisch unter ihnen.
Als sie an ein Wässerchen unweit der Stadt kamen, sahen sie einige Jungen an einem Teiche beschäftigt, sie hörten sie von ferne schreien. Als sie näher kamen, sahen sie etwas im Teiche
plätschern; ein kleiner, schwarzer, junger Hund, ein Pudel, rang mit den Wellen; ein Stein war ihm um den Hals gebunden. "Heda", sagte Gritta "lasst das Hündchen leben!" "O nein", sagten die
Buben, "seht, wie es zappelt". "Hallo zu!" rief Gritta und lief den Mädchen voran auf die Knaben los, die erstaunt und dumm dastanden; dann liefen sie lachend davon. Nun schürzte Gritta sich hoch
und holte das Hündchen heraus, fröhlich über den Sieg ohne Kampf, und sich ihres furchteinflößenden Eindrucks bewusst, führten sie das Hündchen an einem Band triumphierend davon. Sie wanderten
auf der Landstraße; kam ein Fuhrmann, der freundlich war, so ließ er ein Paar davon aufsitzen und knallte lustig mit seiner Peitsche. "Bald sehen wir die Stadt, wo, Margareta, dein Vater wohnt
und meiner Mutter Amme." So war es, in der Ferne sahen sie glänzende Dächer der Häuser und Kirchtürme. Als sie durch das Tor gingen, welche Herrlichkeit! Da kamen in Sänften schöne geputzte
Frauen. Erker voll Blumen, hinter denen liebliche Mädchen scherzten. Was für Wurst- und Bretzelläden! "Ach, das ist die und die Straße", sagte Margareta. "Aber, Gritta, heute Nacht bleib ich noch
bei dir und Frau Rönnchen, und morgen bringt ihr mich zu meinem Vater." Sie fragten einen alten Mann, der die Straße herabkam, nach dem Müllergäßchen; er wies sie hin, sie sahen ein kleines Haus,
ein Birnbaum sah über die Hofmauer mit großem Torweg. "Ach, das muss Frau Rönnchens Tor sein, so beschrieb sie es", sagte Gritta; sie gingen durch ein Seitenpförtchen im Torweg. Die Hühner
gackerten unter dem Baum, es war so heimlich. "Ach", sagte Margareta, "morgen sind wir vielleicht getrennt, hätten wir doch ein Vaterhaus!" Eins sah das andre an. Gritta lief voraus die Treppe
hinauf und steckte den Kopf zur Tür herein; da saß die alte Frau am Kaminfeuer und rieb die Hände, sie guckte ins Feuer, über dem der Kessel hing. - "Frau Rönnchen", rief Gritta, "was macht sie?
Da bin ich!" - "Meine kleine Hochgräfin? - Ei, wo kommst du denn her, Kind", rief die Frau. "Ach, lieber Himmel", rief sie, auf ein junges Mädchen blickend, das einen Koffer einpackte, "sie reist
fort mit ihrem Mann, der ein Schiffer ist. Gott hat dich mir zum Trost geschickt." Sie umarmte Gritta aufs herzlichste und erblickte mit Erstaunen die vielen Kinder, die Gritta gefolgt waren.
"Wer sind denn die?" - fragte sie. "Lass nur gut sein, das will ich dir heut Abend schon erzählen", sagte Gritta. Die Kinder mussten jetzt helfen eine Suppe kochen, und die Alte ordnete
freundlich alles an. Eins holte die Eier der Glucke unter den Flügeln weg, worüber der gesamte Hühnerstall in Alarm geriet, weil heut schon die gewöhnliche Zahl von Frau Rönnchens Eierbedarf
geholt war und die Hühner ihr stilles Gemüt eben einer träumerisch gackernden Mittagsruhe hingaben. Petrina versuchte sich am Melken der Ziege und Wildebeere hielt sie fest, worauf die Ziege
ihnen auf einmal einen sehr artigen Diener von hinten machte und mit ihrem linken Hinterfuß den Topf aus Petrinas Hand nach fernen Höhen, das heißt auf den Mist, absendete. Dann kletterten
Wildebeere und Maieli in die dunklen Zweige des Birnbaums, um ihm die Last zu erleichtern. Die Suppe wurde von Frau Rönnchen eingerührt, alle standen dabei und schauten, wie es gut aus dem Kessel
dampfte; als sie fertig war, füllte jedes sein Tellerchen; so gut hatte es ihnen allen lange nicht geschmeckt. Frau Rönnchen saß oben an und sah mit Behagen zu, wie der gute Brei seinen Weg in
die kleinen Mäulchen fand. Gern hätte sie manches gefragt, aber sie fürchtete, dadurch die Esslust zu unterbrechen; als sie aber nach der Mahlzeit ihren Sorgenstuhl an den Herd rückte und die
Kinder sich um sie gesetzt, schaute Frau Rönnchen Gritta ungeduldig an; diese erzählte, das Hündchen Scharmorzel legte sich zu Frau Rönnchens Füßen. Wildebeere, die immer gern hoch saß, hatte
sich auf die Lehne des Stuhls gehockt und neckte die Alte, indem sie ihr bald in das Busentuch zerpflückte Blumenblätterchen herabregnen ließ oder ihre Mütze zu einem wunderbaren Turmbau oben
aufbauschte und ihren zahmen Vogel darunter steckte, so dass, wenn sie die Mütze wieder zurecht schob, er schnell herausflatterte; die Frau lachte dann mit den Kindern jedes Mal über ihren
Schreck. Als Gritta an die Flucht kam, hörte sie aber sehr ernst zu und wollte gar ein wenig zanken, als sie geendet. - Aber zum dritten und letzten Schreck kam auf einmal Wildebeere selbst statt
der Blumenblätter in Frau Rönnchens Schoß herabgeregnet und verlor sich in Artigkeiten und küsste sie ganz ab. Das andere war, dass Frau Rönnchen dachte, sie hätte es wohl eben so gemacht; sie
sagte also nichts, als. "Es ist gut, liebe Gritta, dass du sie herausgebracht hast; fahre nur so fort und bringe ein jedes zu seinen Eltern und erzähle denen, was für ein böser Ort das war, und
morgen früh bringst du Margareta zu ihren Eltern, da will ich mit und Fürbitte tun. Aber vorher erzeigt ihr mir die Liebe und bringt meine Tochter auf das große Schiff und helft ihre Sachen dort
hintragen; ich selbst mag nicht hin, denn es würde mir zu weh ums Herz, müsste ich mir das große Meer ansehen und denken, dem vertrau' ich sie an. Drum bin ich lieber nicht bei der Abfahrt." Die
Kinder sagten alle ja! - Frau Rönnchen sah sie sich nach der Reihe an und bemerkte, dass in den blauen, braunen, grauen, schwarzen Augen eine sanfte Dämmerung auftauchte. So machte sie schnell
ein langes Strohlager, bald lagen die kleinen Müden neben einander gereiht in tiefem Schlaf. Während noch die Tochter bei der Mutter saß und weinend ihr Haupt in ihren Schoß legte, gab diese ihr
viele gute, goldne Lehren.
Als der Morgen kam, bereiteten sie alles zur Reise. Sie war still, als sie aber an der Tür stand und ihr junges Kind umarmte, weinte sie die bittersten Tränen.
Sie gingen durch viele Straßen, bis an den Strand. Da war ein Wald von bewimpelten Masten, stolz wogten die Schiffe auf dem weiten Meer. Wie verwundert sahen die Kinder umher! Maria, die junge
Schifferfrau, ging auf ein Schiff, das schon zur Abreise gerüstet war. Die Schiffsleute liefen alles zur Abreise vorbereitend an ihnen vorüber, sie grüßend, und ließen sie samt den Kindern durch.
Unten in der Kajüte angelangt, nahm Frau Rönnchens Tochter den Hausrat in Empfang und lud und stellte und packte ihn zurecht, ein jedes half mit zurechtrücken. Scharmorzel sprang bellend unter
ihnen herum und riss ihnen an den Kleidern, als wolle er sie wieder ans Land zerren. Als sie aber fertig waren, hatte Maria noch so viel zu sagen für ihre liebe Mutter, und es waren so teure
Angelegenheiten; bis die alle durchgesprochen waren, da verging wohl eine geraume Zeit. Endlich trennten sie sich und gingen die Schiffstreppe hinauf. Die Matrosen saßen ihnen mit dem Rücken
zugekehrt am Ruder; ein frischer Wind strich ihnen entgegen und in die Segel, ringsum das blaue Meer und der Himmel. Das Schiff war fortgefahren! - Sie liefen die Treppe hinab und riefen
durcheinander; die gute Maria war auch voll Schrecken. Der Schiffskapitän, ein brauner Mann, kümmerte sich nicht viel darum; er versprach, er wolle sie irgendwo absetzen. Als Marias Mann kam,
meinte der, er traue dem Kapitän nicht sehr; so lange günstiger Wind sei, würde er wohl fortsegeln. Sie waren voll Schreck und Verwunderung, das Herz pochte ihnen, und Maria tröstete sie. Als es
gegen Abend war, gingen sie hinauf. Das Abendrot färbte das Meer, von ferne kam eine Welle nach der andern angerollt, es war so herrlich, dass sie sich ruhig niedersetzten. Die Matrosen hörten
auf zu arbeiten; ein alter Mann mit seinem Pfeifchen nahte sich ihnen. Er blies den Rauch vor sich her und schaute sie vertraulich an. "Nun, kleine Landratten, was macht ihr denn hier?" fragte er
Gritta, die Mut zu ihm fasste. Sie ging mit den andern ihm nach auf das Vorderverdeck, wo sie sich niedersetzten, und Gritta erzählte dabei dem Alten, wie sie auf das Schiff gekommen waren. Er
horchte sie verwundert an und meinte auch, der würde sie nicht absetzen; als sie noch so saßen und dem Spiel der Wellen zusahen, kam ein alter Jude aus der Kajüte; er ging auf den Alten zu und
drückte ihm herzlich die Hand. Dieser machte ihn mit den Kindern bekannt, der alte Jude setzte sich zu ihnen und bat, der Bootsmann Thoms möchte doch heute Abend den lieben Kindern da eine recht
schöne Geschichte erzählen, um ihnen die Sorgen ein wenig zu vertreiben. Thoms nickte freundlich. Gritta setzte sich Arm in Arm mit Margareta neben Harmoni, die über den Bord gelehnt in die
Wellen sah, und um sie herum Wildebeere, Maieli, Kamilla, Petrina, Reseda, Lieschen, Elfried. - "Ich war ein junger Bursche", erzählte Thoms, "da lag ich am Lande trocken, weil ich kein Geld mehr
hatte. Das Beste ist, du machst dich wieder auf die See, dachte ich mir. Ich ging also auf das Schiff, das zunächst die Anker lichten sollte, ein fixer Segler von gar absonderlichem, aber stolzem
Bau. Ich wurde dem Kapitän gemeldet, der war ein Mann! -- In der Kajüte sah es wunderlich aus; sie war wie ein Zelt mit buntem Zeug ausgeschlagen, da saß er auf roten, weichen Samtpolstern, hatte
eine große Schale mit dampfendem Getränke vor sich stehen, dessen Geruch mich schon betäubte. Seine Mütze war mit Gold besetzt, dass keine Linse dazwischen Platz gehabt, ein bunter Schlafrock
hüllte ihn völlig ein; sein spitzer, schwarzer Schnurrbart ging bis zu den Ohren. Nachdenklich stieß er die Rauchwolken von sich, die sich kreiselnd durch die offne Luke in die Luft davon
machten; er guckte ihnen lange nach. Auf der Lehne seines Polsters saß ein großer Affe, der mir die Zähne fletschte und wie der Herr Kapitän aus einer langen Pfeife rauchte. Endlich nach langem,
stillschweigendem Warten sah er mich fragend an. Als ich ihm mein Gesuch vorgetragen, willigte er ein unter zwei Bedingungen, erstens solle ich nicht fragen, wo die Fahrt hingehe, noch womit das
Schiff geladen. Nun, ich war ein junges Blut; es war das Schiff, das zunächst absegelte; meine große Reiselust, und ich weiß nicht, was noch, bewogen mich, dass ich zuschlug. Den andern Morgen
reisten wir ab; ich hatte bemerkt, dass der Kapitän am Abend vorher Kisten von gewöhnlichem Holz sehr vorsichtig in der Dämmerung aufs Schiff transportieren ließ; er hatte schwarze Sklaven, die
diese Arbeit verrichteten. Ich hatte weiter nicht darauf geachtet. Wir hatten guten Wind, das Schiff ging frisch in See; wir kamen in mehrere Häfen, keiner durfte ans Land. Morgens ging der
Kapitän ans Land, abends kam er mit den einundzwanzig Sklaven nach Haus, die Kisten getragen brachten; diese verschwanden jedes Mal im untern Schiffsraum, nie wurde darüber gesprochen. Die
übrigen Matrosen waren zu denselben Bedingungen geworben wie ich; aus unbezwinglicher Neugierde fragte einer einen Sklaven; dieser blieb stumm, aber am andern Tag erhielt er wegen einem
unbedeutenden Fehler starke Schläge. So ging es noch einem, und ich hütete mich wohl zu fragen. Anfangs redeten wir viel darüber unter uns, aber später ward es uns ziemlich gleichgültig. - Wir
segelten lange so fort, da brach eines Abends ein großer Sturm aus, er raste die ganze Nacht. Am andern Morgen wussten wir oder der Kapitän vielmehr nicht, wo wir waren. Er stellte sich aufs
Verdeck und schaute durch ein großes Fernrohr in die Weite; auf einmal rief er: "Ich sehe Land!" - und befahl, das Steuerruder nach der andern Seite zu lenken. Gegen Abend, als die Sonne
unterging, erschien eine wunderbar schimmernde Küste. Es waren Felsen von lila, weiß und gelblicher Farbe; eckig und platt ragten sie am Ufer in die Höhe; es liefen blaue, rote, grüne und
violette Adern durch ihr Gestein, die in der Abendsonne glänzten. Als wir näher kamen, glaubten wir Menschen auf der Insel zu erkennen; aber es ward bald zu finster, als dass man es unterscheiden
konnte. Als aber die Sonne wieder aufging und die Felsen erleuchtete, die uns am Abend so in Verwunderung setzten durch ihre Schönheit, so dass wir's für Täuschung des Abendscheines hielten, so
waren sie noch weit kräftiger gefärbt und so wunderbar schön anzusehen. Da wir keinen Menschen sahen, befahl der Kapitän zu landen, um frisches Wasser einzunehmen; ich und fünf andere gingen mit
ihm, nachdem wir lange eine Stelle gesucht hatten, um das Ufer zu ersteigen. Die Felsen waren glatt wie Spiegel, bis nach und nach ein feiner bunter Sand am Boden zu sehen war. Oben angelangt,
sahen wir eine weite Ebene, an deren Rand ein wunderbar majestätischer Wald emporstieg; wir gingen darauf zu. Als wir näher kamen, erkannten wir, dass der Wald aus hohen Blättern und prächtigen
Blumen bestand, so groß wie bei uns die mächtigsten Bäume, und oben sahen wir verschiedene farbige Massen auf den Blumen ruhen. Nach langem Hinsehen und Forschen errieten wir, dass es Puppen sein
müssten von Schmetterlingen, die zur Größe der Blumen passten, wie bei uns die Kleinen auch den Blumen angemessen sind, auf denen sie sich wiegen; sie waren aber so groß wie ein Mensch. Unser
Erstaunen stieg aufs höchste, da der Kapitän an einer Pflanze hinaufkletterte und eine der Schmetterlingspuppen berührte, ein Geklingel anfing, das aus tausend verschiedenen Silberglöckchen zu
kommen schien. Nun bemerkten wir, dass wirklich ein Faden mit Glöckchen behangen durch alle diese Pflanzen lief; augenblicklich darauf hörten wir ein großes Getöse, und zwischen den Blumenbäumen
kamen eine Menge Menschen gelaufen, - wenn sie so zu nennen waren: ihr ganzer Leib war menschlich, nur waren ihnen Schmetterlingsflügel von der verschiedensten Art und Farbe angewachsen. Ich sah
einige sehr schöne Jünglinge darunter; der Vorderste trat meinem Kapitän näher, ein Mann mit schwarzen Haaren, großen schwarzen, zornigen Augen, seine Flügel waren nach Art der
Totenkopfschmetterlinge; die andern schienen ihn als ihren Anführer zu betrachten. Er fragte, was er sich unterstehe, die königliche Menschenzucht zu stören. Der Kapitän entschuldigte sich sehr
höflich und sagte, wir seien Fremde, welche die Sitte dieser Gegend nicht kennen, und dass er bloß aus wissenschaftlicher Neigung geforscht habe, was diese großen Puppen enthielten. Der Anführer
ließ sich hierdurch beschwichtigen, betrachtete uns mit Verwunderung und sagte, er wolle dem König unsere Ankunft melden. Sie zeigten uns hierauf eine bequeme Lagerstätte für die Nacht und einen
Ort, wo wir süßes Wasser fanden, um unsere Tonnen zu füllen; einer der Geringeren, die bei uns blieben, uns Hülfe zu leisten, erzählte auf unsere Fragen, dass die Insel dem großen
Schmetterlingsfürsten gehöre und dass die Puppen auf den Blumenbäumen die Kinder der ganzen Stadt seien, die hier ein Jahr lang an der Sonne gebrütet würden, bis sie ausfliegen. Die Glöckchen
seien dazu, dass wenn etwa der böse Vogel Rock komme, um die Puppen zu stehlen, dann gleich die Wärter herbeilaufen, um ihn zu verjagen. Die Adeligen seien die vornehmen Puppen und die Geringeren
so wie die Kartoffelraupenpuppen und Kohlraupenpuppen. Diese nannte er nicht; da ich aber diese Geringeren ansah, erkannte ich, dass es diese Gattung war. - Er erzählte noch viel über die
Staatseinrichtung; dann legten wir uns zum Schlafen. Andern Tags wurden wir durch eine Deputation zum König gerufen. Die Sonne durchleuchtete die Straßen; ich kann die Herrlichkeit der Häuser gar
nicht beschreiben; manche waren von Rubin, manche von Smaragd, andere waren gelb, andere blau, alles von dem Feuer der Sonne durchdrungen. Es kamen viele Leute vor die Türen, uns zu sehen; nur
Frauen bemerkte ich nicht, sie schienen mir hinter dem Behang der Fenster hervorzulauschen. Endlich kamen wir in den Palast des Königs. Das ganze Dach schien mir aus einem Diamant zu bestehen,
indem sich die Sonne tausendfältig abglänzte, und ihre Strahlen brachen sich untereinander in den mannigfaltigsten Farben. Wir zogen zwischen einer dichten Hecke von Hofkavalieren durch, die, mit
den schönsten Flügeln begabt und in eine smaragdgrüne Seide gekleidet, uns begrüßten. Der König, umgeben von seinen Kammerherren und Hofherren, auf einem Thron von blitzenden Steinen, hatte
schöne und besonders große Schmetterlingsflügel; eine goldene Krone schmückte sein Haupt. Er empfing den Kapitän aufs freundlichste, betrachtete ihn mit der größten Neugier, ließ sich von ihm
über unser Land erzählen; kurz, es war ein sehr wissbegieriger Herr; er schien vorher gar nicht gewusst zu haben, dass es außer seiner kleinen, auf dem Meere schwimmenden Insel noch Land gebe.
Die Kammerherren schwirrten daher. Bald wurde die Tafel aufgeschlagen und Speisen in köstlichen Gefäßen aufgetragen; wir wurden von schönen Schmetterlingsknaben von zartem Aussehen in herrlichen
Gewanden bedient. Sie kredenzten lieblich schmeckendes und berauschendes Getränk und wehten dem Erhitzten mit ihren Flügeln Luft zu. Bei jedem Kompliment, das der Kapitän den Hofleuten machte,
klappten diese mit den Flügeln, was wohl so viel wie bei uns der Diener sein soll. Ich glaubte mehrmals, dass sich die Vorhänge des Saales bewegten und Frauengesichter hindurch sahen; jedoch
schien kein anderer es zu bemerken, so glaubte ich, dass ich mich wohl geirrt habe. Nach Tische beurlaubten wir uns beim König, um unser Schiff noch mit notwendigen Vorräten zu versehen. Der
Kapitän übergab mir einige europäische Stoffe, die ich mit meinen Kameraden am Abend dem König überbringen sollte. Ich hatte meine Arbeit getan und legte mich aufs Verdeck hin in die Mittagssonne
und besah den wunderbaren Farbenschmelz des Eilandes mit seinen Felsen, die in der Sonne strahlten. Den Vormittag hatte sich allerlei Schmetterlingsgesindel, auch Frauen darunter, die aber nur
Sklavinnen waren, am Strande herumgetrieben; jetzt aber war wegen der Hitze alles leer. Da sah ich über die Ebene eine kleine Sklavin daher kommen; sie trug einen Korb mit Früchten und war in
weiße Flore gehüllt. Sie eilte aufs Schiff zu und spähte umher; da sie mich erblickte, winkte sie mir; ich kam. "Wollt Ihr von diesen Früchten kaufen?" fragte sie; ich bedeutete ihr, dass ich
kein Geld habe. "Nun, so helft mir sie tragen, denn sie drücken in der Mittagshitze gar zu schwer", sagte sie, "ich will Euch auch ein Paar davon schenken." Ich sagte, dass ich mehr ihrer
angenehmen Gesellschaft wegen mitgehen wolle. Sie wickelte sich noch fester in ihre Schleier, und ich folgte ihr."
.................................................................................
Bis hierher hatte Thoms den aufmerksamen Kindern diese merkwürdige Geschichte vorgetragen. Es war spät geworden, denn so manche Fragen und Verwunderungsreden hatten sie verlängert. Die
Schiffslaternen wurden angesteckt; sie wünschten gegenseitig gute Nacht und gingen schlafen in die Hängematten, die die gute Marie ihnen bereitet hatte; sie schliefen ziemlich beruhigt, überhaupt
fing es an, ihnen auf dem Schiffe zu gefallen. Am andere Morgen gingen sie hinauf, ein lauer Wind wehte; eine schöne Küste mit blau abgezeichneten Bergen lag ihnen zur Seite, das Meer war
herrlich, die Fische spielten in den Fluten; sie freuten sich alle auf den Abend. Die Sonne neigte sich zum Untergang; das Schiff kam mehr zur Ruhe, als der alte Thoms sich bereit setzte. Nachdem
der alte Jude war herbei gekommen und die Kinder sich um ihn versammelt hatten, begann er, sein Haupt an den Mast gelehnt und aufs Meer schauend, während er kurze Rauchstöße aus seiner Pfeife
blies:
"Als wir durch das Tor kamen, schlüpfte sie an den Wächtern vorbei in die kleine Straße hinein; nun bog sie von einer Straße in die andere, bis sie an dem Hinterpförtchen eines Hauses anklopfte.
Ein Weilchen - und es wurde geöffnet; mit gewandter Hand packte sie mich und zog mich ins Haus, so dass mir der Korb mit Früchten entfiel und ich darüber stürzte; als ich aufstand war rings um
mich Dunkelheit. Erschrocken und doch auch neugierig tappte ich der Wand entlang, fand eine Tür, klinkte auf und stand in einer großen Halle. Das Licht fiel von oben herein und beleuchtete die
saphirblauen Wände; der große weiße Strahl eines Springbrunnens flog in der Mitte in die Höhe und plätscherte leise wieder hinab. Umher standen Gebüsche von in Gefäßen gezogenen Pflanzen; sie
waren an vielen Orten ganz dicht und hoch; ich glaubte, als ich eintrat, hinter den Büschen ein leises Lachen zu hören, auch einige Gestalten verschwinden zu sehen. Als ich eine Weile mich
umgesehen und der großen Herrlichkeit dieses Gemaches gar nicht satt werden konnte, setzte ich mich auf den Rand des Bassins; da klopfte mir die Sklavin auf die Schulter. Ich wollte schelten und
fragte, warum sie mich allein gelassen. Sie legte den Finger auf meinen Mund und sagte: "Hab' ich dich so weit gebracht, so kannst du mir noch folgen, es soll dir nichts geschehen, aber ich muss
dir die Augen verbinden." - Ich bedachte, dass ich in ihrer Gewalt war, und ließ es geschehen; sie nahm mich an der Hand und führte mich fort; nach einer Weile zog sie an einer Schnur, die einen
Vorhang öffnete. "Hier, wenn du willst, löse deine Binde", sagte sie und ließ mich los; es war alles still um mich, ich hörte keinen Laut. Nachdem ich die Binde abgenommen, sah ich mich in einem
kleinen Gemach. Das Laub wiegte sich vor den offenen, bis zur Erde reichenden Fenstern, es füllte das Fenster und machte den ganzen Raum schattig; die Blätterschatten spielten auf den weichen
Polstern, die an den Wänden entlang liefen und einen bunten Teppich umschlossen. Als ich so stand, bewegten sich die grünen Vorhänge; sie öffneten sich, ein Mädchen trat hervor; wo wäre der Maler
sie zu malen? Sie war von blendender Weiße, und ihre sanften schwarzen Augen, von sammetartigen Wimpern beschattet, strömten einen schwermütigen Glanz. Der leise Hauch ihrer rötlichen Wangen, wer
konnte sein sanftes Wechseln beschreiben? Sie atmete ängstlich und streckte zwei weiße, schlanke Arme nach mir aus; ich stürzte ihr zu Füßen. - "Verzeih meiner Sehnsucht, schöner Jüngling",
begann sie, "die dich zu mir herbrachte! Ich sah dich am Tische meines Vaters; man nannte mich sonst die Kalte, aber da ich dich sah, hörte ich auf kalt zu sein; ich fühlte, dass du mir bestimmt
seist." Sie zog mich an ihre Seite auf den Sitz; ich sträubte mich dagegen, da ich zu ihren Füßen sitzen bleiben wollte, und ich, hingerissen von ihrer wunderbaren Schönheit, sprach ihr
unbefangen meine Liebe aus. Wir plauderten lange. - Wenn sie fröhlich sich freute, dass es ihr gelungen mich herzubringen, oder wenn sie sonst scherzte, klappte sie leise mit ihren Flügeln; diese
waren nicht wie die andern von matter Farbe, sie waren vom feinsten Purpur mit Gold vermischt. Als sie traurig über unsre Trennung weinte, ließ sie die Flügel hängen; ich hatte Mühe sie zu
trösten. Bald kamen Sklavinnen, die unterbrachen uns. Es waren elf schöne Mädchen, die leise mit ihren bläulichen Flügeln im Zimmer herumschlurrten; sie brachten Früchte und kühle Getränke.
Während eine Sklavin die Laute schlug, hatte ich Zeit sie anzusehen; denn wenn sie sprach, wagte ich nicht, meine Augen zu ihr aufzuschlagen, nur den Wohllaut ihrer Stimme trinkend. Es wurde
später, und sie sagte mir, dass wir scheiden müssten. Ich überschüttete mit Tränen und Küssen ihre Hand; dann kam die Sklavin, die mich hergeführt, verband meine Augen und wir entfernten uns. Als
wir dem Meere nahe waren, ließ die Sklavin mich los und floh eilend davon; ich nahm die Binde von den Augen. Es war schon dunkel; ich hatte noch meines Herrn Kapitän Geschenke zu besorgen.
Schnell ließ ich die Matrosen die Ballen auf die Schultern nehmen, ich selbst war noch zu begeistert von meinem Abenteuer, als dass ich etwas tragen oder denken konnte. Als wir in des Königs
Palast kamen, war der Kapitän schon dort, sehr aufgebracht, dass ich so spät erst kam. Der König saß auf roten Polstern, umgeben vom großen Hofstaat, der Kapitän saß neben ihm. Einzelne
geflügelte Knaben, alle in rosenroten Röcken mit Goldsäumen, flatterten bedienend umher mit Getränken und Früchten. Die Wände, vom hellsten Lichte angestrahlt, im Kristallglanz, spiegelten alle
Herrlichkeiten des Saales. Ich war sehr frohen Mutes, als ich die Stoffe aufrollte und sah, dass sie bei dem hellen Lichte sehr schön sich machten. Der König war sehr gnädig; uns wurden in seiner
Nähe Polster hingelegt, und ich bemerkte während des Gastmahls, dass seine Blicke mehrmals mit Wohlgefallen auf mir ruhten. Auf einmal stand der Anführer, den wir zuerst im Walde gesehen, mit
zornblitzenden Augen auf; er schritt auf den König zu und sagte ihm etwas ins Ohr. Des Königs Blicke sprühten Feuer; ich sah mit gespannten Sinnen allem diesem zu. Der Anführer hatte sich zurück
auf seinen Platz begeben; da stürzten zwei Sklaven aus dem Haufen hervor, packten mich und brachten mich zu den Füßen des Königs, mit dem Antlitz zur Erde. - "Wahrlich, es ist, es ist!" rief
dieser, "der Zorn treffe ihn des mächtigen geheiligten Königs!" - Der König sprach immer von sich selber wie von einer dritten Person. - "Sein Zorn möge dich vernichten! Wie kommst du, Kot seiner
Sohlen, dazu, dass dich der Flügel der Prinzessin Merkusuli streifte?" Ich wurde auf diese Worte mir nichts dir nichts wieder aufgepackt, und bald befand ich mich in einem dunkeln Loch. - Wie ich
allein war, überließ ich mich erstaunungsvollem Schmerz; ich sann hin und her über den Namen Merkusuli. Der Morgen dämmerte durch ein kleines Loch, als mir die Worte des Königs einfielen, der
Flügel der Prinzessin Merkusuli habe mich berührt. Ich trat näher ans Licht und erblickte auf meiner Schulter ihren Flügelabdruck; meine Schöne musste mich zufällig damit berührt haben: sie war
also die Prinzess Merkusuli! Ich zog den Rock aus und bewunderte den Gold- und Purpurstaub, bis ich vor großer Liebesmacht beinah verschied. Der Kerkermeister kam; nach langem Fragen kriegte ich
heraus, der König wolle mich wahrscheinlich hinrichten lassen, weil nur die Prinzessin Merkusuli diesen Staub auf ihren Flügeln trage und ich daher bei ihr gewesen sein müsse. Als ich fragte, wer
sie sei, sagte er, sie sei die Tochter von des Königs Bruder, und er erziehe sie, da der Bruder nicht mehr lebe, um sie später zur Königin zu erheben. Als er am zweiten Tage kam, antwortete er
mir gar nicht; ich war von allem abgeschlossen, und meine Angst mehrte sich, je länger die einsame Zeit vorwärts schritt. Ich hatte mich eines Abends niedergelegt, beklommenen Herzens, da weckte
mich etwas; ich rieb die Augen, der Kapitän stand vor mir und neben ihm eine verhüllte Gestalt; er befahl mir zu schweigen, ich solle schnell meine Kleider anziehen und ihm folgen. Als ich fertig
war, führte er mich durch eine Tür fort, die ich nicht bemerkt hatte. Wir kamen in die freie Luft und gingen durch mehrere Straßen bis an das Meer, die Gestalt folgte uns. Das Schiff war
segelfertig; als wir hinaufsteigen wollten, fiel mir auf einmal die Prinzessin Merkusuli ein. Ich sagte dem Kapitän, er solle mich zurücklassen, ich bleibe. - "Du bleibst, Geliebter?" sagte eine
zärtliche Stimme neben mir, und ich lag zu der Prinzessin Merkusuli Füßen, denn sie war die verhüllte Gestalt; sie erhob mich, und ich schwankte freudetrunken auf das Schiff. Unsere Abfahrt ging
schnell von statten; der Mond stand groß über dem Meere und beleuchtete die bunten Felsen, Merkusulis Heimat; sie hatte die Schleier abgelegt, und ich hatte das Glück, sie in ihrer Schönheit zu
bewundern. Das Wunderbare war, dass als wir von der Insel uns entfernten, ihre beiden Flügel gleich Rosenblättern abfielen und sie nun wie andre Menschen war. Sie lächelte und beruhigte mich, als
ich dachte, dieser Verlust könne sie kränken, und erzählte mir, wie sie gehört, dass ich gefangen sei, und wohl diese heimliche Tür gekannt, sich aber nicht früher hingewagt, bis sie den
Schiffskapitän davon benachrichtigt, der auf alles eingegangen sei. Wir trennten uns nun, weil sie sich zur Ruhe begab."
Als Thoms so weit erzählt hatte, ermahnte er, dass es Zeit sei, nun auch schlafen zu gehen. Am andern Tage verhielt sich das Wetter noch immer schön, und am Abend fuhr Thoms fort zu
erzählen.
"Am anderen Morgen harrte ich lange vergeblich auf dem Verdeck, die Prinzessin kam nicht. Ich fragte den Kapitän; der wendete sich von mir ab, ganz gegen seine Art; er sagte, er könne es nicht
wissen, wo sich alle weggelaufenen Prinzessinnen befänden. Mein Herz ward schwer, und ich ahnte Unglück. Am Abend kam sie nicht, am andern Morgen nicht, meine Fragen wies der Kapitän ab mit dem
Befehl, ich solle das Maul halten. Stiller Gram bemächtigte sich meiner; ich konnte mir die Sache nicht erklären und ich musste mehr wie einmal an die Kisten denken, denn es fing ein Argwohn in
mir an zu dämmern. Meine Kameraden erzählten mir noch, dass, ehe der Kapitän mich zurückgebracht, wieder eine Menge Kisten angekommen seien. Was konnte der Kapitän in diesem Lande erhandelt
haben? -- Nach fünf Tagen brach abermals ein Sturm los, der uns an eine fremde Insel verschlug. Wir kriegten einen gewaltigen Schreck, als wir einen großen Schatten am Ufer auf und ab spazieren
sahen, ohne dass wir ein Wesen gesehen hatten, das ihn warf. Eine fühlbare Magnetkraft trieb uns dem Lande zu; der Kapitän legte an, da es nicht anders ging. Da wir einmal so weit waren, konnten
wir auch frisch Wasser einnehmen; denn wenn man uns was tun wollte, konnte man es, eben so gut auf unserm Schiffe uns anfallen als auf dem Lande. Der menschliche Schatten in eigentümlicher
Gewändertracht schien sich zu erstaunen; er war durchsichtig grau, und man sah die Berge und Felsen der Insel durch ihn schimmern; plötzlich lief er hastig davon. Der Kapitän fasste Mut, er
dachte, es müsse getan sein, und untersuchte die Insel nach allen Seiten. Als wir aus einer kleinen Sandschlucht heraus kamen, in der wir vergeblich Wasser gesucht, sahen wir, während keiner von
uns ein Wort vor Angst sprach, nach dem Strande. Siehe da, ein graues Gewimmel füllte ihn, einen Schatten sah man durch den andere, während ein leises schluchzendes Flüstern die Luft durchdrang.
Der Gewänderschatten eilte auf uns zu und zeigte uns den übrigen Schatten. Ich betrachtete sie. Welche verschiedene menschliche Schatten, und auch Häuserschatten, Baumschatten, kurz, Schatten von
allem, was in der Welt existiert, liefen da herum! Alte griechische Tempel, gotische Kirchen, Moscheen, Sommerhäuser, Monumente, Bauernhäuser, Kuhställe, Hundehütten; die Schatten der Menschen
waren in den verschiedensten Trachten. Wilde in Tierhäuten, Griechen in Gewändern, Ritter im Harnisch, alte Herrn in Allongeperücken, steifröckige Damen, kurz, aus den wunderlichsten
Trachtzeitaltern. Der Schatten im Faltengewand eilte auf uns zu und fing an, mit uns zu sprechen; wir verstanden ihn nicht. Darauf nahten sich mehrere kolossale Häuserschatten, Tempel- und
Kirchenschatten: jeder sprach eine verschiedene Sprache, keinen verstanden wir, bis zuletzt ein deutscher Bauernhausschatten uns fragte, wer wir seien. Mein Kapitän sagte mit einer tiefen
Verbeugung, dass sein Schiff das Unglück und zugleich das Glück gehabt hätte, fügte er schnell hinzu, an diese Insel verschlagen zu werden; die allerhöchsten Schatten möchten doch die Gnade
haben, ihn das fehlende Wasser in seine Tonnen füllen zu lassen. Der Bauernhausschatten übersetzte dies den andern Schatten. Der Kapitän erwartete mit Zittern die Antwort; die Schatten schienen
sehr zufrieden über seine höflichen Reden, und das gutmütige Bauernhaus wurde durch sie gebeten, uns die Quelle zu zeigen. Am Abend lud uns die Schattengesellschaft zu sich ein; ein besonders
großer, dicker Herrnschatten führte den Vorsitz im Reden. Sie zerstreuten sich, und wir sahen nur, während das Bauernhaus uns zur Quelle führte, einige der riesenmäßigen Schatten an den Bergen,
die vom Abendrot beschienen, entlang schweben. Mein Kapitän näherte sich etwas dem Bauernhausschatten und suchte eine Unterhaltung anzuknüpfen. "Dürfte ich wohl die Ehre haben, etwas Näheres über
das Volk der Schatten zu erfahren?" - Das Haus schien gern auf seine Wissbegier einzugehen. "Alle diese Schatten, die du hier siehst, sind die Schatten der verschiedenen Häuser und Paläste,
welche sie vor ihrem Umsturz oder die Menschen vor ihrem Tode werfen, kurz, aller Dinge, welche einst auf der Welt bestanden. Schatten sind keineswegs, wie man glaubt, unbeseelte Dinge; nein, die
Schattenseiten der Dinge und Wesen, die da existierten, dauern länger als die Lichtseiten. - Es existieren mehr Schattenseiten an allem in der Welt. Du glaubst gar nicht, was für Schatten aller
Zeiten mit einander dieses Eiland bevölkern, denn sie brauchen sehr wenig Platz, da sie sich nie stoßen, sondern durcheinander gehen, auch natürlich einer in den andere über geht." - Bald waren
bei diesen merkwürdigen Erzählungen die Tonnen gefüllt und auf das Schiff gebracht. Der Mond schien, und das freundschaftliche Haus rief uns und führte uns in ein ungeheures, monddurchleuchtetes
Tal; um die Berge kamen die Schatten herzu von allen Seiten, es sollte ein schattenhafter guter Abend werden. Sie schwammen durcheinander und schienen zu sprechen, der Bauernhausschatten brachte
uns auf ein Plätzchen inmitten der Berge. Die Köpfe der Schatten ragten gerade bis an uns; sie machten sich auch nichts daraus, wenn wir ihnen zuweilen darauf traten. Nicht weit von uns hatte
sich der Schatten des Gewändermannes hingestellt, er schien mich von der Seite anzuschielen. Auf einmal bemerkten wir, dass die Schatten sich teilten, und eine alte Domkirche fing mit einem
griechischen Tempel an, ein Menuett zu tanzen. Darauf folgten Sommerhäuser, Bibliotheken, Glyptotheken, Kapellen, Schlösser; darunter mischten sich die Menschenschatten in den verschiedensten
Kleidungen, die ganze Arche Noah der Tiere, Statuen, Bäume: kurz, alles, was Schatten auf der Welt geworfen hatte. Das Bauernhaus zeigte uns besonders den alten Abrahams-, Evas- und
Adamsschatten, die die Aufsicht führten. Cäsar und Don Quixote unterhielten sich eifrig; Götz von Berlichingen mit der Königin von Saba, Apollo, Judith, die Jungfrau von Orleans, Diogenes, Madame
de Pompadour und Karl der Große tanzten Lanners Tänze mit einander. Maria Theresia tanzte mit Mohammed ein Menuett; eine Menge Könige und Kaiser und was für Schattengeschöpfe mehr, folgten, ich
habe nur diese von all den wunderlichen Erscheinungen behalten. Ich bemerkte indessen, dass der faltenreiche Gewändermann mich noch fortwährend anstarrte; endlich winkte er das Bauernhaus zu sich
und flüsterte ihm etwas zu, worauf dies zu mir kam. "Höre", zirpte es, "es interessiert sich ein Schatten für dich; er hat eine so zarte Neigung für dich gefasst, dass er wünscht, dich kennen zu
lernen; wenn du ihm auch dann noch gefällst, hat er einen Plan mit dir vor; doch das wirst du später erfahren. - Kennst du den großen Plato? - Er ist's." - Ich hatte mein Leben nichts von Plato
gehört und weiß noch nicht, wer er ist. - "Ich habe nicht das Glück, so wahr ich keine Landratte bin", sagte ich. - "Folge mir!" - Eine Herzensangst ergriff mich, als ich mich dem Mann näherte;
er lud mich zu einem Spaziergange ein, trotzdem folgte ich, weil ich ihn zu erbittern fürchtete. - "Ich bin die Schattenseite Platos", sagte er, als wir an den Bergwänden empor wandelten. "In mir
ist eine feine Liebe, ich fühle eine platonische Zuneigung zu dir." Er erzählte mir entsetzlich viele Dinge vor; ich hörte aufmerksam zu und verstand nichts. Auf einmal starrte er mich lange an
und sagte: "Du verstehst mich. So einen mochte ich immer, dem ich meine langen, langen hinter dem Berge haltenden und um die Ecken kommenden Gesprächsweisen angedeihen lassen könnte. Du bist dazu
ganz köstlich geeignet." - Als wir vom Spaziergange zurückkehrten, war ich schachmatt, und es war mir, als habe ich in meinem Vaterland Pflaumenbrühe genossen. Wir brachten den anderen Tag herum,
ohne den Schatten zu sehen; ich genas nach und nach am kräftigen Sonnenlicht von dem nächtlichen Spaziergang. In der Nacht mussten wir wieder auf das Schattenfest. Der Schattenmann im Faltenwurf
verfolgte mich wieder, und ich musste mit ihm auf den Gipfeln der Berge lange hin und her wandeln. So ging's am dritten und vierten Tage. Am sechsten um Mittag wollten wir fort, am fünften waren
wir wieder auf dem Schattenfest. Nachdem der Gewandschatten seine Promenade mit mir gemacht, flüsterte er eifrig und lang mit dem Bauernhausschatten. Zu Ende des Festes, als die Schatten sich
zurückzogen, machte sich das Bauernhaus an meine Seite und fing mir an zu erzählen. Denkt euch meinen Schrecken, der Gewänderschatten wollte mich hier behalten, da sich seine Seele
unwiderstehlich zu mir hingerissen fühle; er habe ihm vertraut, dass er schon mit einigen starken Schlagschatten gesprochen habe, dass sie mich erschlagen und mein Schatten dann sogleich und für
ewig bei ihm verweile. Das gutmütige alte Bauernhaus sagte, es sei mir zugetan und habe nicht unterlassen können, mich zu warnen gegen diesen hinterlistigen Mord. "Auch deinen Kapitän bedroht
Unglück: denn es hat ein sehr schöner Schatten, die Königin von Saba, Freundschaft für ihn gefasst; sie wollte ihn auch morgen umbringen lassen." - Ich war außer mir vor Schrecken und küsste das
alte Haus herzlich auf seine Tür; darauf eilte ich, - denn ich war im Gespräch mit dem alten Haus etwas zurückgeblieben, und teilte dem Kapitän alles mit. Als ich aber von ihm sprach, da ließ der
Kapitän augenblicklich die Segel lüften. Das Schiff war schon segelfertig, aber es ging nicht aus der Bucht heraus; da kam das alte Haus und sagte, wir müssten alle vom Verdeck ins Dunkle, so
dass wir keine Schatten mehr würfen, die von der Insel angezogen würden. Wir dankten noch dem ehrlichen Bauernhause, und ich versprach, es lieb zu behalten, bis mein Schatten einst ganz mit ihm
vereint sein werde. Wir krochen unter, stießen ab und kamen glücklich aufs hohe Meer. Wir gingen nun wieder aufs Verdeck und erblickten, wie die Schatten, die durch irgendeinen Zufall unsre
Abreise erfahren haben mussten, zornig am Ufer auf- und abschwankten." -
Hier unterbrach der Jude den Erzähler durch ein heftiges Niesen, worüber die Kinder alle so erschraken, dass mehrere von ihnen einen hellen Schrei erschallen ließen. "Hab' ich's nicht gedacht",
sagte der Jude, "du alter Thoms würdest mit deiner Schattengeschichte den armen Kindern Furchtgedanken erwecken? Da haben wir's nun, kaum dass es mir im Gehirn ein bisschen kribbelt und ich
niese, so weichen sie schon vor dem Schatten meiner Nase zurück." - Die Kinder protestierten aber stark dagegen und sagten, sie würden es mit jedem Schatten aufgenommen haben. Jedoch folgten sie
dem guten Rat des Juden, jetzt den Schlaf zu genießen. Sie waren aber am andern Tage eiliger wie sonst in allen ihren kleinen Geschäften und Angelegenheiten; so sehr eifrig sehnten sie sich nach
der Erzählstunde. Sie kam, wie alles, was man sehnlichst herbei wünscht, sehr langsam. Sie fanden sich jedoch in etwas betrogen, als der Erzähler schon fern von den Schatten, von denen sie noch
allerlei seltsame Erwartungen hegten, fortfuhr: "Ich könnte noch viele Schattenseiten hier hervorheben; aber ein großer Streichschatten warnte mich, ich solle sie nicht alle aufdecken, sonst
werde er sich verlängern und ein Nachtschattengeschirr über mich ausleeren.
Wir waren schon wieder auf hohem Meere, ich suchte meine Trauer zu zerstreuen. Wie ich so in meinen Mußestunden mich auf dem Verdeck herumtrieb, kam ich auch in die Küche; eine Menge von Töpfen
erregten immer meine Aufmerksamkeit. Als ich den Koch fragte, wozu diese seien, sagte er, für uns; ich roch aber den Duft von Speisen, die wir nie aßen. Darauf sah ich auch, dass alle diese
Speisen heimlich in des Kapitäns Kajüte gebracht wurden. Ich versuchte einmal dahin zu kommen, aber alles war verschlossen; jetzt stieg die Idee in mir auf, dass er die Prinzess Merkusuli
eingesperrt. Einer der Schwarzen war mein Freund gewesen; ich gab ihm gewöhnlich mein Teil von geistigen Getränken; einmal sparte ich diese lange zusammen, ich wollte endlich mich überzeugen. Ich
lud ihn aufs Hinterverdeck zum Trinken mit mir, er ward immer gesprächiger, ich suchte ihn immer wieder auf die Kisten zu bringen; als er mehr und mehr getrunken, lallte er gedankenlos in den
blauen Himmel hinein: "Es wird diesmal ein guter Verdienst sein, es sind lauter Schneegänschen, ich lasse sie den Mittag heraus aus ihren Kasten. Ach, die armen Mädchen!" Er schaute sich, kaum
als er dies gesagt, erschrocken um, sprang auf und lief fort. Nun wusste' ich's, er musste diese Mädchen aus den verschiedenen Städten geraubt haben; ungefähr so reimte ich mir's zusammen. Ich
war außer mir vor Zorn, aber wusste mich doch so zu verstellen, dass man an mir nichts merkte. Den andern Tag erblickten wir in der Ferne einen Hafen, es war der Hafen der großen Stadt in der
Türkei, Bagdad; am Abend landeten wir. Der Sklave wich seit jener Zeit mir immer scheu aus, und ich dachte oft darüber nach, ob er es seinem Herrn wieder gesagt. Den andern Tag, als ich den Koch
sah die Speisen zubereiten, warf ich in einen der Töpfe einen Stein, den ich noch von der Schmetterlingsinsel bei mir hatte; ich hatte hinein graviert: Antworte! - Sie musste diesen Stein wieder
erkennen, und fand ihn eine ihrer Gefährtinnen, würde die ihn gewiss vorzeigen. Ich ging zurück aufs Verdeck; da trat der Kapitän auf mich zu und lud mich zu sich in die Kajüte ein. Er war so
freundlich wie lange nicht, und ich dachte immer, es gereue ihn; er sagte, er wolle mir etwas sagen, dann ließ er Wein kommen. Allein kaum hatte ich davon getrunken, so überfiel mich eine große
Müdigkeit. Der Kapitän schwamm vor meinen Augen hin und her, und ich wusste nichts mehr; nur meinte ich schrecklich poltern zu hören, als bewege man schwere Gegenstände fort. Den andere Morgen
rieb ich mir die Augen; ich befand mich in meiner Hängematte. Halb schlaftrunken begab ich mich zu meinen Kameraden an die Arbeit; diese fragten mich, warum ich seit gestern Vormittag vom Verdeck
gewesen sei, und einer erzählte, es seien unterdessen alle die Kasten transportiert worden. Kaum hatte ich dies gehört, fuhr es wie ein Blitz mir durch die Seele; ich eilte halb wahnsinnig zum
Kapitän, drang bei ihm ein, und fragte nach der Prinzessin; er ward so zornig, dass er mir befahl hinaus zu gehen, und sagte, ich solle darüber schweigen, sonst werde er mich in dieser fremden
Stadt zurück lassen. Dies war möglich; obwohl ich unterwegs von einem der Sklaven etwas Türkisch gelernt hatte, so kannte ich doch niemand, um mich zu verteidigen; ich versank in die finsterste
Schwermut. - Ich war öfters in Bagdad, um mich zu zerstreuen. Wenn ich in der glühendsten Sonne durch die Straßen mit schönen Palästen ging, in deren kühlen Kiosks die reichen Türken auf weichen
Teppichen saßen, mit kostbaren Turbanen und Schals, umgeben von Sklaven, und der bläuliche Rauch ihrer Wasserpfeifen emporstieg, wenn ich den Bazar entlang ging, die Juwelen und Kostbarkeiten
erblickte, das Gewühl der Kaufenden und Handelsleute, so ergriff mich eine noch heftigere Sehnsucht und Schmerz; ich ging dann gewöhnlich durch eine abgelegne Straße zurück. Hier war niemand vor
den kahlen Häusern in der Mittagshitze zu sehen; nur manchmal ragte eine Reihe bunter Blumen über die Mauer, und die weißen Schleier einer Türkin wehten herüber, die aus dem obern in den untern
Raum des Hauses ging. Von diesen Häusern gefiel mir eins besonders, dass etwas in die Straße hervorstand; es war schön gebaut, und ich stand oft davor. Einstmals ergriff mich in dem Augenblick,
als ich es anschaute, eine unwiderstehliche Müdigkeit, dass ich mich schnell nach einem Platz umsah zum Schlafen. Die rechte Seite des Hauses bildete ein Eck, das hervorstand, und dadurch einen
Schatten; ohne mich lange zu besinnen, nahm ich da mein Lager ein und überließ mich dem Schlaf. Ich mochte wohl eine Stunde so gelegen haben, als es mir war, als werde ich von einem Regen von
Prügeln zerbläut; ich öffnete die Augen, musste sie aber gleich wieder schließen, denn es kam aus einem kleinen Fenster über mir ein Regen von Goldorangen, süßen Feigen und Datteln herabgeströmt.
Nach einer Weile hörte es auf, ich sah oben nur eine kleine Hand, die einen in der Sommerluft wehenden Vorhang ins Fenster zog. Ich stand noch lange, dann steckte ich von den Früchten so viel
ein, als ich tragen konnte, und ging.
Am zweiten Tag wählte ich mir wieder diesen Platz zum Schlafen aus Neugier. Kaum dass ich eingeschlafen, erweckte mich ein Regen von Früchten; so ging's den dritten, vierten und fünften Tag. Am
sechsten Tag fiel jedoch nur eine Goldorange allein herab, wie ich sie selten von solcher Größe und Schönheit gesehen; ich ging, nachdem ich mich wieder vergeblich nach der Geberin umgesehen. Am
andern Tage war ich so voll Schwermut, dass ich auf dem Schiffe liegen blieb; ich ward durstig. Die Orange fiel mir ein; ich holte sie und wollte sie öffnen, da fiel sie in zwei Hälften, und ich
fand, dass sie nur mit Bast gefüllt, aber inwendig war ein Zettel verborgen. Ich rief einen schwarzen Sklaven, er übersetzte den Zettel: "Geh auf den Bazar, da wird eine Alte kommen, die dich zu
der führt, die dich liebt!" Ich war voll Hoffnung und Angst; sollte es Merkusuli sein? - Sie konnte ja nicht türkisch! - Ich dachte, um mich zu zerstreuen, wolle ich dies Abenteuer wagen; ich
eilte auf den Bazar hin- und hergehend und schaute jeder Alten unter die Nase, die ich sonst nicht gerade würde angesehen haben. Endlich winkte mir von ferne eine durch das Gewühl, und ich folgte
durch eine Menge Straßen zu einem großen, schönen Hause. Die Sklavin klopfte, und es wurde aufgetan; ich kam durch ein prächtiges, kühles Vorgemach von rotem Marmor, der Boden war glatt wie
Spiegel, und ich wäre beinah gefallen; dann in einen hohen Saal. Ich harrte des Abenteuers, was da kommen sollte; ich spiegelte meinen abgetragnen Anzug im Fußboden. Der Saal war mit grünem Samt
behangen, der Fußboden von bläulichgrünem Marmor; ein Springbrunnen in der Mitte; von smaragdgrünen, durchsichtigen Steinen tropfte helles Rosenwasser, dessen Düfte das Gemach durchzogen. Da
öffnete sich von einer goldnen Schnur gezogen der Vorhang, und aus den innern Gemächern kam ein Zug Sklavinnen von großer Schönheit. Sie trugen goldne Gefäße, aus denen Weihrauch dampfte; aber
gleich dem Mond unter Sternen wandelte in ihrer Mitte eine geschmückte Frau; sie setzte sich in die Mitte des Saals und schaute mich lange an. Erschrocken vor dem Glanz ihrer Augen blieb ich
demutsvoll stehen. "Komm näher", sagte sie; ich näherte mich und warf mich nieder. Sogleich legte man mir ein Polster neben sie hin. Sie lud mich ohne weiteres ein, von den Getränken, die man
brachte, zu genießen, und legte mir fortwährend von den köstlichsten Speisen vor, so dass ich zuletzt sehr heiterer Laune ward. Als sie dies merkte, gab sie einen Wink, und eine rauschende Musik
begann. Nun flüsterte sie mir ins Ohr, sie habe mich unter ihrem Fenster schlafend erblickt und sei die, welche mit den Früchten mich damals beregnet habe. "Ich liebe dich", fügte sie lächelnd
hinzu, "und will dich prüfen. Wenn du mir in sechs Monatszeiten noch gefällst, werd' ich dich zu meinem Gatten wählen!" Ich schlug die Augen nieder, das Bild der Prinzessin Merkusuli stand
lebhaft vor mir, ich begann gefasst: "Edle Bannu!" - was soviel wie bei uns Herrin heißt - "ich bin Eurer nicht würdig; wäre ich es --, so hätte ich dennoch kein freies Herz zu bieten", wollte
ich hinzusetzen, als der Vorhang sich öffnete und einige Sklavinnen mit Sorbet kamen. Ich blickte sie an, das Wort blieb mir auf der Zunge: ich sah mitten unter ihnen die Prinzessin Merkusuli!
Halb starr vor freudigem Schreck bemerkte ich endlich, dass die Augen der schönen Türkin auf mir ruhten. Im Flug fasste ich meine Gedanken zusammen: wenn ich ihr sagte, dass ich sie nicht liebe,
so durfte ich nicht mehr kommen; stellte ich mich, als liebe ich sie, was sollte Merkusuli denken! - Das letzte musste ich wählen, sonst war ich für ewig von Merkusuli getrennt; indem ich meine
Blicke mit Gewalt von der Prinzessin ablenkte, die niedergeschlagenen Auges mich nicht sah, sprach ich: "Wenn ich Eurer würdig wäre, wie glücklich könnte ich sein!" "Du bist der, den ich
erwartete", sagte die Türkin. - "Prüfe mich erst!" rief ich ängstlich, denn die Sklavinnen, die zu Paaren vor dem Teppich gingen, ihre Gefäße absetzten und sich dann teilten, waren schon vorbei,
bis auf jene, an deren Seite die Prinzessin ging. Sie hatte verschämt die Augen gesenkt und wollte den Becher niedersetzen, als sie mich erblickte; der Becher entglitt ihren Händen, und der Saft
träufte von ihren weißen Fingern. Ich sagte:
"Die Rebe, wenn im vollen Trieb sie ist, der Jugend
Fängt sie zu weinen an vor Übermut und Lust.
Der Gärtner sieht's, ach! denkt er sich im Herzen
Wenn Reben weinen und von schneeigen Glocken
Träufelt der Saft, vergehen meine Schmerzen.
Denn sie versprach's, zu folgen meinem Locken
Mit Augen, Hand und Mund und Herzen
Zu kommen dann, zu lindern meine Schmerzen."
Sie fasste sich schnell und sagte:
"Ach, endlich kommst du nun, mein Lieber,
So lang die Reb' nicht weinte, weinte doch mein Herz zu dir hinüber
So lang' nicht träufte Wein, von weiblichen Schneeglocken
Träuften von meinen Augen Tränen,
Weil ich nicht folgen konnte deinem Locken."
.................................................................................
Ich wendete mich wieder zu der Gebieterin; sie glaubte, ich scherze über das Vergießen des Sorbets, und achtete meiner Rede nicht. Ich verlebte diesen Abend selig, weil ich von Zeit zu Zeit das
Glück haben konnte, Merkusuli von der Seite anzusehen. Aber welcher Schmerz! - Sie schien stolz und kalt, da sie meine Artigkeit gegen ihre Gebieterin sah. Als ich fort musste, war die schöne
Türkin noch sehr freundlich und sagte, sie habe sich in mir nicht betrogen. Ich langte glücklich auf dem Schiffe an und ging unter Sorgen und Hoffnungen schlafen. Am andere Abend holte mich die
alte Sklavin wieder ab. Die Gebieterin erzeigte mir alle Artigkeit; aber die Prinzessin Merkusuli sah mich nicht an und floh jede Gelegenheit, wo ich ihr etwas zuflüstern konnte. Die schöne
Türkin sprach mehr und mehr von ihrer Liebe zu mir, und die sechs Monde nahten ihrem Ende. Einmal war ich allein im Saale. Da kam Merkusuli herein, die mich nicht da vermutete, sie wich scheu
zurück, ich hielt sie am Schleier, stürzte zu ihren Füßen und erzählte alles. Freudetrunken reichte sie mir die Hand und erzählte mir ihr Schicksal: wie der Kapitän mit ihr in einen Raum des
Schiffes gegangen sei, und unter dem Vorwande, ihr Stoffe zu zeigen, habe er einen großen Kasten geöffnet und sie, trotz ihres Sträubens hineingeworfen; dann habe er den Kasten verschlossen. Als
er fort war, ertönten eine Menge dumpfer Stimmen, die ihre Leiden klagten, was sie nicht genau verstand. Um Mittag kam ein Sklave, um sie herauszulassen; zu ihrem Erstaunen stiegen aus allen
andern Kasten auch eine Menge schöner Mädchen. Nachdem alle gespeist hatten, wurden sie wieder eingesperrt. Jeden Tag erzählte eine andre die Geschichte ihres Raubes; sie machten allerlei
Versuche zu ihrer Befreiung, die nicht gelangen. Eines Tages bemerkten sie, dass das Schiff stille stand; man hatte einen Schlaftrunk in ihre Speisen gemischt, denn sie erwachten erst, als man
auf dem Sklavenmarkt die Kisten öffnete. Ein vornehmer Türke , der sie kaufte, verliebte sich so sehr in sie, dass er sie zu seiner Gattin erwählte. "Aber diese meine Gebieterin, seine
Schwester", sagte Merkusuli, "zu eifersüchtig auf das Regiment im Hause, wollte es nicht leiden und erbat oder erzankte mich, gleich als ich kam, zur Sklavin."
Kaum hatte sie ausgesprochen, so hörten wir Tritte und der Zug kam. Ich brachte diesen Abend äußerlich vergnügt, aber innerlich traurig zu; es war keine Hoffnung, dass ich je mit Merkusuli
entfliehen könne. Bald wollte sich die schöne Türkin entscheiden, dann musste ich fort. Die Angst, jede Minute von ihr getrennt zu werden, quälte mich fortwährend; nur einmal sahen wir uns
allein, und meine Tränen vermischten sich mit den ihren. Eines Abends empfing mich die Gebieterin sehr ernst; mein Herz klopfte, ich dachte, sie werde mir sagen, daß sie sich mit mir vermählen
wolle. Sie hieß die Sklaven abtreten und begann. "Eine meiner Sklavinnen, die mein Bruder gekauft, weil er sie wegen ihrer großen Schönheit und edlem Wesen heiraten wollte, erbat ich mir damals
von ihm, weil ich, wie bisher, im Hause herrschen wollte und nicht eine Frau sehen, die durch ihre Launen mich quälen könnte. Aber seine Leidenschaft entzündete sich aufs neue, als er sie neulich
erblickte; ich will sie nun fortschaffen", - mein Herz pochte wie ein Hammer, und ich lauschte eifrig - "und zwar durch dich", fuhr sie fort. "Komme morgen Nacht um die zwölfte Stunde an die
kleine, nach Morgen gelegne Pforte dieses Hauses, wo man sie dir übergeben wird. Fahre sie in einem Kahn auf die unweit vom Lande gelegne Insel, dort wird man sie dir abnehmen." Man meldete uns,
die Speisen seien aufgetragen, ich war ausgelassen lustig und warf selige Blicke auf die über meine Fröhlichkeit erstaunte Merkusuli; die schöne Türkin hatte große Freude an mir. Am andern Morgen
fand ich einen Schiffer, der mir sagte, sein Kahn sei für mich bestimmt; ich packte meine Habseligkeiten ein und schaffte alles heimlich auf den Kahn. Ich hatte mir vorgenommen, einen großen Teil
um die Stadt zu fahren und in den ferneren Teilen ein sicheres Asyl für mich und Merkusuli zu suchen. Spät in der Nacht schlich ich mich durch eine offne Gitterpforte in den Garten. Es war um die
Zeit, wo die Pahlen blühen, alles hing voll weißer Blüten; ich hatte Mühe, mich zu fassen, daß ich von ihrem Duft und der Erwartung nicht schwindelte. Ich wartete lange, da ertönte von den Türmen
der Minaretts der zwölfte Stundenruf, die Pforte klirrte in ihren Angeln, und eine verschleierte Gestalt wurde herausgeschoben. Es war Merkusuli; beinah hätte mich der Bruder der schönen Bannu
ertappt, der unter den Blütenpflanzen hin- und herstreifte: in einem golddurchwirkten Schlafrock und roten Pantoffeln, verliebte Blicke nach den Gemächern seiner Schwester sendend, in denen er
die schöne Sklavin verborgen wähnte. Ich trug meine im Schleier verborgene Beute in den Nachen, den ich mit Lebensmitteln ausgestattet. Es war eine herrliche, helle Nacht. Merkusuli war voll
Staunen und Freude, sich bei mir zu finden; wir fuhren, der Welt und des Kahns vergessend, den wir treiben ließen, wohin er wollte, auf dem schönsten vom Mond beschienenen Wasser. Auf einmal
erweckte uns ein Geschrei aus unsere Träumen. Der Kahn eilte gerade unter den Schnabel eines großen Schiffs; ich erkannte es als ein deutsches Fahrzeug und rief, man solle uns an Bord lassen. In
dem Kapitän erkannte ich einen früheren Herrn von mir. Ich teilte ihm mein Schicksal mit; er wurde heftig erzürnt über den Seeräuber und versprach mir, Vorkehrungen beim Sultan gegen ihn zu
treffen und mich mitzunehmen. Vor unserer Abreise schickte ich der schönen Bannu noch einige Diamanten von der Schmetterlingsinsel mit einem Brief. Denn wahrlich, bei dem größten Mastbaum, der je
den Wind durchschnitt, ich bin immer großmütig gewesen. Aber wer sollte jetzt glauben, daß die alte Dame Thoms, die in einem kleinen Hause, hinter den Weidenbäumen am Strand wohnt und zuweilen
gleich mir ein Gläschen Grog liebt, die Prinzessin Merkusuli ist? Jeder würde behaupten, sie sei des Torfhändlers Tochter Hanna, und ihr Sohn nicht der Enkel des Königs der Schmetterlingsinsel,
sondern sein Enkel. Aber ich liebe sie so herzlich wie immer; manchmal kniee ich noch vor ihr nieder, wenn sie des Morgens ihre Nase kaum aus ihrem Federbett steckt (sie hat nämlich seit einiger
Zeit eine eben so lange Nase bekommen wie die Torfhändlerstochter Hanna sie hat, mit der ich, wie die Leute meinen, verheiratet sei), und sage zu ihr: "Schönste Prinzessin, wenn du heut saure
Bohnen, wie man sie auf der Schmetterlingsinsel zurichtet, mit Speck und Essig kochst, so bringe ich dir von meiner nächsten Seereise den besten Tabak mit."
Hier endete Thoms. "Das ist eine schöne lange Geschichte gewesen! Ihr habt gewiß viel hinzugesetzt?" sagte der Jude. "Vielleicht alles", erwiderte Thoms, "deswegen ist sie auch so schön. O, ich
könnte euch Dinge erzählen, die so seltsam sind, wie des Teufels seiner Großmutter ihre Kaffeehaube." Bei diesen Worten klopfte er das Pfeifchen aus, was immer ein Zeichen zum Aufbruch war, und
die Kinder liefen hinab.
Thoms erzählte nach dieser noch viele Geschichten, und Gritta wußte bald die Tage nicht mehr zu zählen, an denen sie, bei ihm sitzend, die Sonne untergehn sahen. Sie hatten sich nach und nach
zufrieden gegeben, daß sie der Kapitän nirgends absetzte und stets lachte, wenn man ihn daran erinnerte. Auch sprach Frau Maria viel von dem schönen Lande, nach dem sie schifften, und sie
vergaßen der Heimat. Eines Tages kam Frau Maria die Treppe herab und rief. "Heute gibt's Sturm, geht nicht herauf zu Thoms! Er läßt euch grüßen und schickt eine Rolle Tabak, den soll Kamilla ihm
schneiden. Der Himmel ist ganz grau überzogen, die Sonne geht tiefrot unter, und die Seevögel fliegen dicht über dem Meer und baden ihr Gefieder. Laßt's euch nicht leid sein, geht früh schlafen
heut!" "Ja, der Himmel sieht so grau aus wie meines Großvaters Puderrock", sagte Maieli, die hinterher lief. "Was muß doch ein Sturm wild sein", rief Harmoni. "Ja, ja, da kann man geradezu im
Meer ertrinken", sagte Margareta und guckte mit großem Ernst auf ihre Schürze von blauer Klosterleinwand. Sie hatte sie unlängst aus ihrem Bündel geholt, und kein andrer hatte eine solche
Schürze; sie sah sie an, als wollte sie sagen: "So geht's, wenn man sich aufs Meer wagt." "Ich weiß wohl, du denkst an mich", rief Kamilla, "daß ich damals so sehr zauderte, als wir vom Schiff
sollten. Aber ich weiß auch, daß, wenn beim Sturm das Schiff ein Loch kriegt, aus dem wir herausfallen, so kommen wir zu den Meerprinzessinnen in den Kristallpalast, von denen Thoms erzählt, sie
seien schöne Jungfern mit langen Haaren." - "Sie werden dich zum Frühstück essen", meinte Margareta, "aber wißt ihr, ich binde mir ein Bündel mit allerlei Dingen um den Leib, da hab' ich alles,
wenn ich irgendwo ankomme." "Gebt acht, was ich tue", sagte Kamilla und lief nach Schiffszwieback, den sie sorgfältig in einen Pantoffel der Frau Maria packte und sich aufs Herz band; dann legte
sie sich zufrieden nieder und sah von oben herab dem Treiben der andern zu. Sie rannten umher und packten in ihre Bündel alles, was ihnen lieb war. Frau Maria sah lachend drein und ließ sie
gewähren. Margareta hatte so viel einzupacken, eine Menge Röckchen und Wäscheleinen und einen kleinen Teetopf. Petrina wollte eine Tonne getrockneter Pflaumen mit einem Strick an ihren Fuß
binden; aber Kamilla verriet es, und die andern holten die Pflaumen heraus; es entstand ein großes Geschrei darum. Margareta rief, es sei gegen alle Sitte, vor dem Sturm so zu schreien. Kamilla
allein lachte in Sicherheit von oben herab alle aus. "Ich packe den Scharmorzel in die Tonne", rief Petrina, "ich salze ihn ein!" Aber Scharmorzel wollte nicht; er lief hinter Gritta und leckte
das Salz ab, das Petrina ihm auf den Pelz gestreut hatte. Derweile hatte Veronika, um trocken zu bleiben, sich in die Tonne gesetzt und den Deckel heraufgezwängt, aber es ward ihr zu enge und sie
schrie um Hilfe, bis sie herausgelassen wurde. Endlich ließen sich alle bewegen, ruhig schlafen zu gehen; zuletzt saß noch Wildebeere im Eck auf der Erde und steckte in einen Sack all ihre
Pflanzen; sie band ihn sich um und sprang auf ihr Lager. - "Schlaf nur gut in Gesellschaft von den Meerspinnen und Seekrebsen, die im Sack sind!" rief Margareta, "gute Nacht bis auf Wiedersehn im
kalten Wasser bei den Fischen! Aber nun seid still, daß Frau Maria lesen kann; ich bleibe noch lange wach und warte auf den Sturm." "Wir auch, wir auch!" riefen die andern. Frau Maria saß schon
lang und las in einem Gebetbüchelchen ihrer Mutter beim Schein der kleinen Lampe, während die Wellen einschläfernd gegen das Schiff schlugen. Die Kinder lagen alle still; eine Zeit blieben sie
noch wach, doch es wollte kein Sturm kommen. Nach einer Weile stürzte der Teetopf herab, dann folgten die Leinen. Margareta atmete frei auf, legte sich auf die andere Seite und flüsterte: "Es
dauert doch mit dem Sturme gar zu lang!" Dann schlief sie sanft ein; es fiel noch Verschiedenes herab von Marias Hausrat, während alles im tiefen Schlaf lag. Als es um Mitternacht war, erwachte
Gritta, weit das Schiff heftig schwankte; die Lampe war im Ausgehen, und die Tür stand offen, Frau Maria war fort. Ob sie wohl zu ihrem Manne gegangen war? - Gritta hörte nichts als das Toben des
Sturms; Scharmorzel sprang zu ihr, sein zottiger Kopf lag an ihrer Brust, sie umfaßte ihn fest, denn ehe sie sich besann, stürzte eine große, kalte Woge über sie.
Eine sanfte Wärme durchdrang Gritta, als sie erwachte. Sie blinzelte ein wenig durch die Wimpern und sah das schwarze, zottige Fell und die klugen Augen des Scharmorzel, mit denen er sie
ernsthaft anstarrte; seine rote Zunge fuhr mit Wohlbehagen über ihr Gesicht, als habe er es ganz in Besitz genommen. "Geliebter Scharmorzel", sagte die Hochgräfin Gritta schläfrig, "ich bin dir
dankbar für deine große Liebe, ein so tiefes Gemüt hatte ich nicht in dir geahnt, in der Todesgefahr treulich bei mir auszuharren. Ich dachte, du neigtest dich mehr zu mir, weil du Hühnerbeinchen
und Speckschnittchen von mir erhieltst. Aber jetzt sei so gut und lecke nicht mehr, ich muß schlafen." Sie versteckte ihr Gesicht in seinen Pelz und fuhr fort zu träumen. - "Du - Gritta!" rief
eine Stimme, die wie Wildebeeres klang; sie fuhr aus ihren Träumen auf und sah, daß sie auf einem Sandstück von Felsen umgeben lag. - Auf einem Felsstein nicht weit von ihr saß Wildebeere,
trocknete sich in der Sonne und hatte die Pflanzen aus dem grauen Sack um sich ausgepackt; sie war ganz grün von Schlamm und Meerpflanzen. "Denke, Gritta", sagte sie, "alles ist naß geworden und
sehr verdorben!" - "Wo sind denn die andern?" rief Gritta. "Da liegen sie ja umher, ich habe sie gezählt, sie sind schon richtig! - Es war doch eine schreckliche Kälte im Meer, an die
Wissenschaft war gar nicht zu denken. Ich wollte noch etwas Seegras langen, aber es ward mir so wunderlich zu Mut von dem vielen Wasserschlucken, daß ich's sein ließ." Gritta lief von einer zur
andern und weckte sie; erstaunt blickten sie um sich. "Ach, was ist das schön, daß wir alle beisammen sind!" rief Margareta. "Und was für hohe Felsen und nichts als gelber Sand!" - riefen die
andern. "Das ist eine seltsame Insel, ich möchte wohl wissen, wo hier das Brot wächst", sagte Kamilla. - "Du hast bei den Meerprinzessinnen gegessen", rief Margareta und lief, um die blaue
Schürze zum Trocknen an eine Felszacke zu hängen. Die andern breiteten unter lustigem Gespräch ihre Röckchen im Sande aus. Nachdem der Freudensturm über die allgemeine Rettung sich etwas gelegt
hatte, setzte Gritta sich nachdenklich an den Strand; Scharmorzel neben ihr hatte seinen Kopf auf die Pfoten gelegt und sah ebenso nachdenklich zu, wie das Meer Woge auf Woge dem Sandfleck
zutrieb. "Ach, Scharmorzel, wo mag der alte Thoms, Frau Maria und der Jude sein?" begann Gritta, "sind sie in dem grünen Meere oder gerettet, so wunderbar wie wir alle zwölf?" - Scharmorzel sah
sie melancholisch an. - "Alle dreizehn, wollt' ich sagen. Hast du Hunger? Ich kann dir weder Hühnerbeinchen noch sonst etwas geben. Aber wovon sollen wir leben? Sieh die Felsen, es ist gewiß
nichts hinter ihnen, und sie sind so unübersteiglich hoch!" - Gritta sah hinauf und erblickte eine Ziege, die herabkam; sie sprang den gefährlichsten Weg, - bald mußte sie unten sein. -
Scharmorzel stand auf der Lauer, sie langte an, und nun lief er hinter ihr her; beide verschwanden hinter einem Felsblock. Gritta lief hin. "Er wird sie gefaßt haben!" dachte sie und sah
neugierig herum. Blütenduft drang ihr entgegen aus einem dunklen Höhlengang, an dessen Ende grünes Laub schimmerte. - "Ach seht!" rief Gritta freudig, "ich hab' ein Loch ins Paradies gefunden!"
Alle kamen herbeigelaufen, Gritta lief voran durch den langen, dunklen Gang. Am Ende standen sie vor einer grünen Waldwiese, übersäet mit Blumen und Schmetterlingen, die rings aus dem Wald hervor
in die weite Freiheit eilten. Von Scharmorzel war nichts zu sehen. "Das ist am Ende wirklich das Paradies, in das wir hier eingedrungen sind! - Hier wollen wir wohnen!" sagte Gritta. Margareta,
die über ihre Schulter weg alles anguckte, redete zu ihrer blauen Schürze: "Wenn aber nun Wilde hier sind, von denen Thoms uns gesagt hat, daß sie die kleinen Kinder fressen wie nichts?" Die
blaue Schürze ward ganz dunkel vor Schreck, und Kamilla antwortete: "Mich fressen sie nicht, ich kann ihnen Tabak schneiden. Wenn ich nur erst den Apfelbaum sehe von Eva, es werden gewiß noch
Äpfel dran hängen! Ob die wohl gut schmecken? Find' ich ihn, so wissen wir auch gewiß, daß hier das Paradies ist. Aber seht doch das Quellchen am Waldesrand! Ich laufe hin, wer durstig ist, komme
mit!" - Alle folgten, Margareta, die Hände in den Schürzentaschen und die Wiese betrachtend, kam langsam nach. Sie fand die andern bei der Quelle an der Erde, zwischen den Heidelbeeren und unter
den Sträuchern voll Brombeeren herumsuchend. Doch die Hitze machte sie müde, und sie schliefen weich gebettet im hohen Grase ein. Nur Wildebeere suchte in einer Baumrinde Schmetterlingspuppen und
Käfer, und Gritta spähte zwischen den Bäumen herum. Margareta legte sich auch unter einen Busch und hielt ein Gespräch mit ihrer Schürze, die zwischen Zweigen über ihr hängend im lauen Sommerwind
wehte. Es handelte über die Gefahren des Paradieses. Ob Löwen und Tiger noch zahm wären, ob sich diese wilden Tiere wohl melken ließen, daß man Butter daraus machen könne; dann, ob nicht
vielleicht ein kleiner Adam noch zurückgeblieben sein möge.
Der Tag verging; immer schwerer trugen die Flügel der Bienen, die durch die Wiese streiften, und sie wendeten sich zur Heimat. Die Käfer, die zu Abend erwachen, brummten wie Geläut; da weckte
Grittas Stimme alle aus ihrem ersten Schlummer. "Wie könnt ihr so lange schlafen, vom Mittag bis zum Abend? Elfried und Veronika haben die Ziege gefangen mit dem Scharmorzel, und ich hab'
Entdeckungen gemacht." "Hast du den Engel mit dem feurigen Schwert entdeckt" fragte Kamilla und guckte ganz blau aus den Heidelbeeren, "er wird wohl nichts zu tun haben und kann uns ein wenig die
Gegend zeigen, - und vielleicht hat er später Zeit, uns eine Suppe zu kochen oder ein Feuerchen anzuzünden, daß sein flammendes Schwert zu Nutzen kommt." "Ach ja, ach ja", riefen alle. "O, wenn
er wollte, so könnte er auch später meinen Rock flicken." "Meinen auch, meinen auch." "Er kann uns ein Stück aus seinem roten Rock mit Goldfransen leihen, den er auf dem Bild im Kloster an hatte.
- "Nein, ich hab' eine Höhle entdeckt, in der wir wohnen können", sagte Gritta, "ich habe mir den Eingang gemerkt: ein bunter Schmetterling, wie ich noch nie gesehen, flog hinein und immer wieder
zu mir, bis ich ihm folgte." Nun sprangen alle auf und liefen mit Gritta nach der Höhle. Wenig Schritte in den Wald, so standen sie vor dem Eingang, ein Strauch hing von oben herab über ihn, und
wilde Ranken hatten alles fast zugewachsen. Gritta riß die Ranken in die Höhe, daß die gelben Blüten herabflatterten. Ein Eichkätzchen sprang mit gesträubtem Schwanz davon und schaute vom
wiegenden Zweige auf die Einwandrer, die Vögel flogen auf. Sie sahen manch heimlich angelegtes Nest voll buntgesprenkelter Eier. Endlich standen sie in der Höhle. - Durch zwei Löcher im Gestein
fiel Licht herein und erhellte die braunen, moosüberwachsenen Wände. "Ach ja, hier wollen wir wohnen", rief Margareta, "aber erst guckt in alle Spalten, ob kein Bär drin sitzt." Kamilla holte ein
Feuerzeug von Thoms aus ihrer Tasche hervor, es war noch wohl erhalten; sie schoben das zerstreute dürre Laub auf einen Haufen und zündeten es an. Es flammte auf und erleuchtete das dunkle
Gestein; sie legten Reiser hinzu und lagerten sich auf den Boden. Das bärtige Tier bekam seinen Platz nah dem Feuer; es schien nicht unbekannt mit anständiger Gesellschaft, denn es vertrug sich,
nun es gefangen, mit Scharmorzel sehr gut, und er achtete seine Würde als Haustier, lag dicht neben ihm und fuhr ihm zuweilen in den Pelz, aber bloß aus Scherz. "Wenn wir nur erst hier
eingerichtet sind", sagte Margareta - "ich bau einen Herd unter das eine Loch der Höhle, und wenn wir erst Hühner haben und Eier und Kücheln und erst Töpfe und Schüsselchen, auf der Wiese Lämmer
weiden, wie schön wird es dann sein!" Sie verlor sich im Anschauen ihrer Schürze. Obgleich sie heute schon viel geruht hatten, so lockte doch die Stille zum Schlafen. Eh' Kamilla sich versah,
nickten schon alle. "Hört ihr nicht einen Bären brummen?" fragte sie und rückte nah an das Feuer, - "wollen wir nicht den Eingang versperren? Wenn hier ein Tiger oder Löwe wohnt, so wird er gewiß
zur Nachtzeit wieder kommen. Aber ihr schlaft ja schon fest!" - Es half nichts, keiner wachte auf. - Endlich schlief sie bei der Ziege ein. Am andere Morgen waren sie früh auf. Um die Höhle ward
es lebendig von ihrer Geschäftigkeit, einige sammelten Gras und Moos zum Lager und breiteten es in der Sonne aus, Margareta baute den Herd von Felssteinen; Reseda und Elfried schafften eine Art
Lehm von des Bächleins Rand herbei, Kamilla schnitzte mit Thoms Messer ein Milchgeschirr mühsam aus einem Ast, an den sie alle zwölfe sich mit voller Wucht gehängt hatten, um ihn abzubrechen, und
wie überreife Früchte mit ihm herab zwischen die Sträucher fielen. Kamilla ging heimlich umher nach dem Apfelbaum des Paradieses und schlug sich durch Brennesseln und Dornen, wenn so ein
rotbäckiger Apfel durch die Zweige blickte. Petrina baute ein Hüttchen für die Ziege aus Zweigen mit Laub gedeckt; es war an die Wand der Höhle geklebt, sie polsterte es mit Moos und schrie bald
nach Gras, bald nach Lehm, was ihr die andere handlangten. Auf einmal kam eine zweite Ziege angelaufen, sie sprang wild und sah sich scheu um. Es schien, als flögen Brennesselzweige, wie von
unsichtbaren Geistern gehandhabt, ihr nach und peitschten auf ihrem Pelz herum. Alle liefen erschrocken auseinander. Aber als sie still stand, lachten sie darüber, fingen sie und banden sie an
ein Grasseil neben die andere.
Der Tag verging unter Arbeit. Die Milch der Ziege und Waldbeeren stärkten sie, auch Pilze, von denen Wildebeere erklärte, sie seien nicht giftig, und zur Beglaubigung einen verzehrte; es
schmeckte zwar nicht zu gut, aber sie hatten den bewußten Apfelbaum des Paradieses noch nicht gefunden, und so nahmen sie vorlieb. Die andern Tage brachten neue Geschäfte und Erfindungen: sie
machten es heller, reinlicher um die Höhle, rissen das Gestrüpp hinweg und bahnten einen kleinen Weg. Am Abend schliefen sie vergnügt und müde ein; es war, als werde über Nacht alles fertig, so
schnell gelang es. Wildebeere allein half nicht, nur dann und wann ließ sie sich in der Ferne sehen, selbst in der Nacht kam sie nicht heim. Darüber machte Margareta ein bedenkliches Gesicht; sie
erschien nur noch, wenn sie des Morgens beim Feuer saßen, mit verfrorner Nase und rieb sich die Hände an der Glut. Wollte Margareta ihr dann eine Strafrede halten und hielt sie zwischen den
Knieen, um den Vorrat weiser Gedanken auszuspinnen, die Wildebeere zu Art und Sitte zurückführen sollten, so holte diese jedesmal gedankenvoll aus ihrem grauen Sack eine Menge vertrockneter
Spinnen und Käfer und legte sie zierlich auf Margaretas braunen Zopf in Ordnung. - Überwand sie den ersten Schreck, so holte Wildebeere zuletzt noch Salamander und Frösche hervor; nun fuhr
Margareta auf, und sie lief davon.
Es war an einem Sonntag Morgen, als alles in Ruhe prangte. Ein reinlicher Gang von gelbem Sand führte bis vor die Höhle, an der die Ranken herauf kletterten und unter einem grünen Laubdach die
weißen Käse auf einem Brett beschatteten. Die Hochgräfin Gritta saß in sanftem Schlafe vor der Höhle auf einem Stein; die Sonne spielte friedlich auf ihrem Angesicht, und Scharmorzel ihr zur
Seite schnappte nach den Fliegen, die sich störend nahten. - Eine große Sehnsucht drängte ihn zum Schlaf. Wie dehnten die Büsche ihre Zweige und flüsterten müde! Die Halme ließen die vollen
Samenkapseln springen, ein Vogel pfiff, der vertrauungsvoll sich genaht, den Samen unter den Blättern abpickte und ihn auf Gritta regnen ließ. Dann wurde es wieder so still, daß es Geräusch
erregte, wenn die Bäume aus Faulheit die Eicheln fallen ließen; doch Scharmorzel schlief nicht. Da knisterte es in den Zweigen, ein Regen von Eicheln stürzte herab, Gritta fuhr voll Schreck in
die Höhe: aus den Ästen über ihr guckte Wildebeere. "Gib acht", rief sie, "was da aus dem Walde kommt über die Wiese! Ein Wilder - er will euch fressen!" Der Zweig knackte unter seiner Last, und
sie war fort; Gritta lief in die Höhle. Kaum hatte sie gerufen: "Ein Wilder!" als Margareta die Milch, die sie hielt, vor Staunen ins Feuer laufen ließ; die andern liefen herzu und blieben dicht
bei einander stehen. Gritta stieg auf den Felsblock, der vor dem Luftloch der Höhle lag. Man konnte von da aus unter den Baumzweigen weg bis auf die Waldwiese sehen: es schritt wirklich über die
Wiese etwas lustig daher. "Wenn das ein kleiner Adam wäre!" rief Gritta. - Es war ein grünes Röckchen und in dem Röckchen ein Knabe; ein silbernes Jagdhorn hing an seiner Seite. Sie wollte ihn
eben näher besehen, als der Wilde seine Schritte nach der Höhle wendete; woher mochte das kommen? - Sie guckte sich um, das Feuer hatte bis jetzt gebrannt, und der Rauch war als Wahrzeichen ruhig
seine luftige Bahn gezogen. "Lösch aus!" rief Gritta, Margareta goß Wasser hinein, Kamilla breitete ihr Röckchen darüber; aber die Rauchwolken stiegen von allen Seiten hervor. Es half nichts
mehr, wußte Gritta wohl. - "Er wird nachspüren, wo der Rauch herkommt, und uns entdecken. Ich will ihm entgegen laufen und sagen, ich wohne allein hier, und ihn wo anders hinführen", dachte sie,
"damit er die andern nicht entdeckt, oder ihm sagen" - sie wußte selbst nicht was. Sie lief zur Höhle heraus und durch das Gesträuch; die Zweige rührten sich vor ihr, sie hielt an. Die Äste bogen
sich auseinander, und ein rundrotvollwangiges Antlitz blickte neugierig ihr entgegen, umkräuselt von einem stolzen Lichtschein blonder Härchen; das Kinn ragte stolz über einen feinen steifen
Spitzenkragen. Der Knabe drang durch das Gestrüpp und stand vor ihr; er legte seine Hand an das silberne Jägerhorn, das über seinem Wämslein hing, als wolle er blasen, daß er einen Bären im Fang
habe. Doch dann blieb er erstaunt und schweigend stehen und sah sie an, bis ein helles Lächeln ihm den Mund öffnete. - "Wir geruhen, dir gnädig zu sein", sagte er und nickte mit dem Kopf, daß der
goldne Haarschein in Wallung geriet. Grittas Angst war verschwunden. "Komm, kleiner Knabe", sagte sie, faßte ihn bei der Hand und führte ihn nach der Höhle. Margareta guckte neugierig mit den
andern aus dem Eingang. "Er sieht gar nicht fürchterlich aus", flüsterte sie, "nußbraune Augen und weiße Zähnchen." - "Sieh, wie er lacht, der kleine Adam!" sagte Maieli, "seine Nase ist sehr
schön, und er trägt seinen Kopf auf einem Präsentierteller!" "Das ist ein weißer Spitzenkragen", sagte Margareta, "aber sieh die schönen Stiefelchen!" Als der fremde Knabe sich von seinem Staunen
erholt, schien ihm, daß sie sich vor ihm fürchteten. "Ich geruhe, euch nichts zu tun", rief er vergnügt, "erst hielt ich euch für Waldgeister, von denen der Hirtenknabe mir erzählt hat, der nicht
weit von hier die Ziegen hütet, daß sie ihm die Ziegen wild machten und schon zwei davon vertrieben hätten." - - Er gewahrte Grittas zwei lange Zöpfe, griff heimlich danach und fühlte sie an,
fuhr aber erschrocken zurück, wie sie sich umsah. "Wer bist du denn?" fragte Margareta. - Die größte Verwunderung spiegelte sich auf seinem Gesicht; er strich über das Spitzenkrägelchen, wiegte
mit dem Kopf und sagte: "Ich! - Das Prinzchen Bonus von Sumbona! - Das wißt ihr nicht? - Ich gehe doch alle Tage unter das Volk spazieren." - "Ach", sagte Gritta, "wir sind weit hergekommen übers
Meer und wissen nichts." - - "Von weit her übers Meer? - Das könnte ich anhören!" rief Prinz Bonus. "Wir wollen dir zu erzählen erlauben, kleines langzöpfiges Mädchen, aber schnell, ich höre gern
Geschichten. Ihr übrigen braucht euch gar nicht um Unsere Gegenwart zu tun zu machen." Er setzte sich auf den Felsblock, holte Nüsse aus seiner Tasche und knackte. Gritta erzählte, oft hielt er
verwundert mit Nußknacken inne oder sagte: "So geht's, reist man ohne Marschall und Kämmerer!" Kamilla hatte unterdessen ein Schnepfchen aus des Prinzen Jagdtasche gucken sehen; sie schlich
hinter ihn und zerrte daran, bis es heraus war; dann rupfte sie es und steckte es an den Holzspieß über das Feuer. Wie der Bratenduft dem aufmerksamen Prinzen in die Nase stieg und seine Blicke
auf die Schnepfe fielen, griff er bestürzt nach der Jagdtasche; als er den Verlust bemerkte, rief er: "Ach, das Schnepflein für meinen Vater! - Ich habe es mir vom Jäger schießen lassen, daß ich
doch sagen konnte, ich hätte etwas geschossen, und nun steckt's am Spieße hier!" "Sei still und höre zu, du sollst auch davon essen!" sagte Gritta. "Soll ich davon essen und soll ich helfen
kochen? Ich will den Spieß herumdrehen." - "Nein, hör, ich erzähle weiter, wie wir über das weite Meer schifften und herkamen." Das Prinzchen hörte wieder zu, konnte jedoch nicht unterlassen,
nach dem Feuer zu schielen; die Unruhe stieg bei ihm, je besser der Braten dampfte. Da tönten Jagdhörner und Hundegebell ganz in der Nähe im Wald; das Prinzchen raffte die Jagdtasche auf, sprang
zur Höhle heraus, nickte und verschwand im Dickicht.
.................................................................................
Lange kam das Prinzchen nicht wieder; sie sprachen täglich von ihm, und die Zeit verschwand, still durch den Wald eilend. Endlich eines Morgens kam Prinz Bonus über die Wiese daher, und von nun
an kam er oft; die Kinder vermißten ihn, war er nicht da. Er erzählte nie viel vom Hof, seinem Vater und dem Sommerschloß nicht weit hinter dem Walde, obwohl sie viel neugierige Fragen danach
taten. "Ich bin froh, daß ich hier bin. Fragt mich nicht, Waldfräulein!" sagte er dann beschwichtigend und zog aus seiner vollgestopften Jagdtasche Krammetsvögel und Schnepfen. "Guck, wie fett
die Vögel sind! Ich habe mir heute sechs Tintenkleckse gemacht, und der Gouverneur hat geschrieen: 'halten Sie sich gerade, Prinz! Es ist so eine unwürdige Neigung nach unten in Ihnen. Fassen Sie
sich nicht an die Nase und kauen an der Feder und lassen Sie die Beinchen nicht wie Perpendikel gehen, wenn ich Ihnen erzähle, daß die Welt rund ist und daß Sie so viel wie möglich von ihr
besitzen müssen.' Ach, Waldfräulein, ich erzähle euch nichts mehr; ich mag nicht daran denken." Prinz Bonus vergaß bald so aller Würde, daß er den goldbrokatnen Rock auszog und die Vögel rupfen
und kochen half. Wißbegierig und ernst sah er Margareta kochen, sein eifriges Gesicht glänzte vor Hitze, er verbrannte die Finger, verdarb das Westchen, und der goldne Haarschein schwebte stets
in Feuersgefahr, wenn er die Nase zu dicht über die rauchenden Töpfe hielt. Die Töpfe hatte er vor nicht gar lange auf Margaretas Bitten aus der Schloßküche entfernt, und seine Taschen steckten
stets voll Rüben oder Kartoffeln, die er zu Anpflanzungsversuchen für sie mitgebracht. Er probierte alle Tage eine Stunde im Winkel der Höhle ein Hühnerei auszubrüten, da er die Henne nicht
heimlich wegtragen konnte; denn er mochte das Mäntelchen drehen, wie er wollte: der Schwanz guckte doch immer hervor. Den ganzen übrigen Tag außer der Küchenzeit tat er allen alles zu Gefallen.
Mit dieser lief er auf die Wiese Gras holen, jener pflückte er Buchnüsse. "Hier, Prinzchen, hilf mir Beeren suchen!" rief die eine hinter einem Baum hervor, während die andre schon rief. "Komm,
lieber Prinz, wir suchen Reiser zu einem Besen!" Dabei wurde er ganz heiß, riß das Schnupftüchlein heraus, trocknete den Schweiß und sagte: "Wir sind sehr heiß, aber Wir opfern die Ruhe." Gegen
Abend hatte er eine besondre Lieblingslaune: er setzte sich an das unweit der Höhle vorüberlaufende Bächlein, wo die Birke ihre Zweige tief herabhängte ins Moos, entledigte sich der Stiefeln und
hängte sie an einen Zweig, ließ die Füße ins Wasser hängen und stellte die Rute aus zum Fischen, bis die Sonne die spielenden Wellen und den säuselnden Baum purpurn durchschien. - Sah er dann
Gritta durch die Bäume laufen, so lockte er sie und rief. "Setz dich ein wenig ins Grüne zu mir!" - Dann trug er ihr allerlei ernste und Volkswohlgesinnungen vor, während sie die Leuchtkäferchen
im kühlen Moos fing und goldne Sterne aus ihnen zusammen setzte. "Wenn ich hier sitze denk' ich über die Welt nach", sagte er einstmals. - "Ich finde, daß es sich im Grünen viel lieblicher sitzt
als auf dem goldnen Thron, wenn ich Probe darauf sitze. Ich finde, daß die Vöglein in den Bäumen viel schöner musizieren als die Hofmusikanten; sie leben auch in gleicher Würde mit mir und sitzen
nicht am Katzentisch, sondern über mir. Guck, Gritta, einmal in meine linke Rocktasche! Da stecken die goldnen Dosen mit Brillanten, hole eine heraus! Ich meine, der Stieglitz dort strengt sich
wieder recht an." - "Ach, Prinzchen, was hast du wieder für Ideen", sagte Gritta, "der Stieglitz ist viel zu anständig für deine goldnen Dosen." - "Ich bin zuweilen sehr dumm", sagte das
Prinzchen, "aber das ist mir angewöhnt. - Ich finde die Abendsonnenbeleuchtung viel schöner als allen Lampenglanz, - und die Bäume sehen wie alte, ehrliche Staatsperücken aus, sie rauschen bloß -
ich kann sagen, was ich will, sie rauschen bloß ein wenig - und ich kann machen, was ich will. Siehst du, in den Wald möcht' ich gern entfliehen, wo im Frühling die Bäume die Blüten treiben, die
Blüten Früchte werden und die Früchte Samen tragen, aus dem wird wieder ein Baum. Wo die Vögel durch die Blätter schleichen zu den weichen Nestern, in denen die Jungen mit den hellen Augen durch
die Dämmerung nach der Mutter Ankunft schauen; wo die Halme aus der Erde dringen, Tau und Nahrung finden. Alle schwatzen sie zugleich, und der Baum gibt sein ernstes Wort darein, wenn er seine
Frucht fallen läßt. Ja, der König Baum! - Sein lustiges Blättervolk sitzt an seinem Stamm, er gibt ihnen allen Nahrung und läßt sie alle plaudern, und will eins fort, so zieht er ihm einen festen
roten oder gelben Rock an, und es eilt dahin im Tanze. - Der Morgen, der Mittag, der Abend und die Nacht schleichen alle durch den Wald; eins läßt das andre aus seiner liebenden Umarmung. - Und,
siehst du, mein fester Entschluß ist, im Walde zu leben und in seine Tiefe zu entfliehen vor dem Gouverneur Pecavus. Aber ich verstehe mich nicht darauf, meine feingestärkten Halskrausen
einzupacken, ohne sie zu verknittern; und wie viele Röckchen ich brauche, weiß bloß der Gouverneur und der Leibdiener." "Prinzchen, denk doch an dein Volk!" sagte Gritta. - "Ach ja", rief Prinz
Bonus, "an die Bäcker und Brauer meiner lieben Stadt Sumbona!" Nun stand er auf, nahm seine Jagdtasche und ging. - Gritta und Scharmorzel geleiteten ihn bis über die Waldwiese, auf der schon
Abendnebel lagen; am Waldrand drückte ihr Prinz Bonus so zärtlich die Hand, daß ihr die Finger brannten, und schied. Sie fand sich zurück durch die Dunkelheit nach der Rauchsäule voll Funken, die
aus der Höhle stieg.
So ging es alle Tage; aber einmal, als sie ihm tiefer in den Wald gefolgt war, fand sie den Weg nicht. Es schimmerte auf einmal so hell, und die Bäume warfen große Schatten; sie wußte nicht mehr,
wo sie war. Der Mond sah in goldner Ruhe vom Himmel herab und blieb stumm bei jeder bellenden Anfrage Scharmorzels. Sie ging in ein dunkles Gebüsch; es wurde immer dichter, sie drängte sich durch
und stand in einem weiten vom Mond beglänzten Waldplatz. Sie duckte sich in den Schatten einer Eiche, denn erstaunt sah sie weiße Spinnweben gleich Gestatten einander nacheilen. Hier flog eine
Reihe hoch durch die Lüfte, und dort sank eine hinter einem Busche nieder: es mußten kleine Geister sein. In Ringelreihen flogen sie über das Gras und ließen Streifen darin zurück; dann zogen sie
in immer engeren Kreisen bis zum Mond hinauf; andre eilten dicht unter dem Gras weg und warfen sich mit Tautropfen; es war, als spinne der Mond von Zweig zu Zweig goldne Strahlenfäden, an die sie
sich hängten und sich schaukelten. Gritta sah ihn an, er lachte! - Er zog sein goldnes Gesicht zu einem lustigen Gelächter; aber mitten drin hielt er inne und verfiel wieder in einen tiefen
Ernst. Da war es, als wenn der Wind die Geister in einem weiten Nebelkreis trieb: so eilig flogen sie und zitterten und flimmerten an den Büschen entlang. - Es wurde eine tiefe Stille, die Zweige
des Gesträuchs beugten sich ehrfürchtig zurück, der Mondglanz wurde heller, und Gritta sah in die Dunkelheit eines Laubgangs. - Aus der Ferne schienen kleine leuchtende Sterne herabzueilen; immer
näher kamen sie, es waren weiße Elfchen, die Leuchtwürmchen trugen, welche ihre wunderschönen Gesichtchen erleuchteten, die aus den feinen Gewändchen hervorguckten; die roten Rosenwänglein, die
blauen Augensterne, so glänzend, und fliegendes Haar! - Je näher sie kamen, je mehr Lichter verlöschen; zuletzt schwebte ein Elfchen mit goldnem Krönchen in den Mondschein, so schön wie Gritta
nie etwas gesehen. - Ein Kerlchen dünn wie ein Zwirnsfaden folgte ihr; er winkte, und der Kreis schloß sich an, sie flogen dicht an ihr vorbei und fort. - Außer einzelnen, die noch hinter den
Sträuchern hervorkamen, war alles leer; ein durchsichtiges Gewölk zog über den Mond. Da zischelte es dicht neben Gritta; sie bog die Zweiglein auseinander. Elfchen schwebten hin und her und
suchten sich niederzulassen. - "Rosenermel!" sagte das eine, das über einer großen Blume schwebte, "es wäre doch schön, wenn hier ein weicher Lilienstuhl oder ein Rosenschemelchen wäre, diese
Blumen sind so groß!" - Es verlor sich bei diesen Worten ganz in der Blume und steckte nur dann und wann den Kopf hervor, klopfte den Blumenstaub vom Blatt, um sich nicht zu beschmutzen, und
lehnte sich auf, um zuzuhören, wenn die andern etwas Besonderes erzählten; sonst verschwand es in ärgerlicher Laune und ließ sich in der Blume vom Nachtwind schaukeln. "Das kenn' ich noch gar
nicht - ein Lilienstuhl, ein Rosenschemelchen!" sagte ein anderes, das sich gleich einer Schneeflocke an ein Blatt gehängt hatte. "Das glaub' ich! - rief ein drittes, nachdem sie in Ruhe an allen
Zweigen hingen. "Du wirst in Grönland keine solche Stühlchen haben." - "Nein, wir bauen uns da Nesterchen von dem Pelz, den der Eisbär an den Sträuchern hängen läßt, sonst reiten wir den ganzen
Tag auf den Schneeflocken. Wie ich als Gesandter in dieses Land mußte, hatte ich mir mein Lieblingsroß gezäumt. Es war eine beschwerliche Reise hierher; als es wärmer wurde, schmolz das Roß zum
Tautropfen; ich ließ es in der Schenke zum Veilchen liegen, aus der ich es wieder abholen werde, wenn ich zurückreise." - "Du meinst, es war eine beschwerliche Reise", sagte das in der Blume. -
"Ich reiste vor einer Zeit nach dem Zusammenkunftsort bei dem Schlosse des Grafen von Rattenzuhausbeiuns; da flog ich so lange durch den finstern Höhlengang, der am Meere mündet; mir wurde ganz
angst, bis ich heraus ins Tal kam." - "Was machen die dort?" - fragte eins, "der Graf hat ja Hochzeit gehalten!" - "Das ist es nicht allein: - unser Liebling, das kleine Mädchen, die in dem Turme
hauste, ist verschwunden. Ich schlief eine Nacht unten auf den Grashalmen im Moor; weil es so kalt und naß war blieb ich wach. Es war noch spät Licht auf der Burg, und ich sah die Schatten der
Leute hin und hergehen; es mußte etwas Besonderes vor sein. Der Storch kam gegangen von der Burg her; ich lud ihn ein, bei mir zu bleiben, denn ich ahnte etwas Neues. Er erzählte, er habe der
Gräfin ein Söhnlein hingetragen. Er war sehr ärgerlich darüber, daß man ihm den einen Flügel ganz mit Wochentee überschüttet; dazu habe ihm die Gräfin eine Ohrfeige gegeben, weil er sie zu sehr
in den Arm gekniffen. - Kurz es sei gar kein ehrenhaftes Geschäft mehr, Storch zu sein." - "Schnell fort! Da kommt die Königin!" riefen alle. Sie flogen weg und etwas zu nah, so daß Scharmorzel,
dem Gritta die ganze Zeit das Maul zugehalten, damit er nicht knurren sollte, nach einem schnappte und beinah sich daran verschluckte; es flog, als es sich befreit, eilig weg. Gritta, erschrocken
über Scharmorzels Leichtsinn, Geister für Sperlinge zu halten, und ihm Vorwürfe darüber machend, floh in den dunkeln Wald; aber wieder stand sie still, denn ein bläuliches Licht strahlte sie an;
es kam aus einem Eichbaum und erhellte die Blätter, die eine kleine Laubhalle bildeten. Darin saß auf einem knorrigen Ast ein stilles Kind. War es nicht Wildebeere? Das Stumpfnäschen ragte über
einem aufgeschlagenen Buch hervor; über ihr am Zweig hing eine kleine Wunderlampe, von der das Licht ausging. Zwischen den Ästen standen Bücher umher, ein kleines Elfchen schnitt Federn, ein
anderes malte Namen auf kleine Violen und kehrte den Staub von Pflanzen, Moosen und funkelnden Steinen. "Ach, Wildebeere!" - sagte Gritta leise. Das Kind wendete den Kopf und sah sie mit großen
Augen an, dann sagte es: "Ich bin eine geheime Naturkraft. - Wenn ich höre, wie das Erz in den Bergen wächst, das Meer unaufhörlich braust, die Erde sich unaufhörlich dreht, dann muß ich ewig
denken: Störe mich nicht, ich sitze hier auf dem Ast der Weisheit; sonst falle ich als unreife Frucht herunter. Denn wen auf dem Weg zum Himmel die Welt stört, der sieht die Jakobsleiter nicht
mehr und muß unten bleiben und rastlos suchen nach ihrem Anfang." Das Laub rauschte, das Licht schimmerte, Gritta sah nichts mehr. Nur ein kleiner, wilder Feuerfunke eilte vor ihr her; sie eilte
ihm nach, bald verschwand er, und sie sah die Waldwiese.
Aus der Höhle zog der Rauch und zeigte ihr den Weg. Alle saßen noch unbesorgt um das Feuer. Gritta dachte die ganze Nacht nach über die Wirtschaft im Walde, und daß die Elfchen Wildebeere zu
ihrem Liebling gemacht hatten; sie hatte keiner andern als Margareta von ihnen erzählt, weil es doch zu wunderbar und schön, und sie selbst kaum daran glaubte. Margareta meinte, sie habe geahnt,
daß Wildebeere in so schlimmer Gesellschaft sei.
Nach einigen Tagen half Prinz Bonus Margareta und Gritta Rüben ausrupfen auf dem kleinen Felde, das er mit ihnen angepflanzt hatte. Eine Rübe, die er verzehrte, hatte auf seinem Angesicht und
Halskräglein helle und dunkle Schattierungen gelassen. - Voll Fröhlichkeit rief er: "O, das Rübenausrupfen ist ein herrlicher Zeitvertreib; wenn ich auch noch so lang rupfe, kriege ich doch immer
etwas heraus, während ich sonst nie etwas herauskriege." Der Prinz zog seinen Degen gegen eine widerspenstige Rübe und hieb und stach so lange, bis er sie losgemacht hatte; dann wickelte er den
grünen Krautschwanz um seine Hand und zog sie heraus. Als er wieder aufblickte, blieb er mit offnem Munde stehen; sein Näschen bekam einen stolzen Schwung, die Augenbrauen verzogen sich zu einem
düstern Gewitter, und der goldne Haarschein wallte. - Am Rande des Feldes stand im goldgestickten Rock vom schönsten Pfirsichgelb, schwarzseidnen Strümpfen mit schwarzseidnen Schleifen, aus deren
Tiefen der unheimliche Diamant funkelte, ein Mann. Das Gesicht mit den schwarzen Augen, die das Prinzchen unter der weißen Perücke anstarrten, - hatte es Gritta nicht schon einmal gesehen? - Ihr
entfielen die Rüben vor Grauen aus dem Röckchen. Prinz Bonus, der im ersten Augenblick die ausgezogene Rübe hinter seinem Rücken versteckte, brachte sie mit edlem Unwillen zum Vorschein und
sprach: "Gouverneur Pecavus, sind Sie es? Wollen Sie eine Rübe essen? Sie schmecken sehr würzig." Bei den letzten Worten stürzte das Prinzchen zwischen das Rübenkraut, denn sein Degen, den es
hinter sich versteckt, weil es doch gar zu schrecklich war, mit dem Degen Rüben auszumachen, kam ihm zwischen die Beinchen. "Hier befindet sich ein thronerbliches Haupt auf dem gemeinen
Rübenfelde? Eine artige Beschäftigung für ein Prinzchen!" sagte der Gouverneur Pecavus, sprang zugleich herbei und packte das Prinzchen zwischen den Rüben fest. - "Mit Bettelkindern auf du und du
zu sein, ihnen Rüben ausrupfen helfen! - Ja, die Jäger konnten blasen, wo die Hasen waren. Alle Tage wollten Sie auf die Jagd. Aber was ist das für eine Aufführung? Was verdienen Sie? - Die
Rute!" - Prinz Bonus war dunkelrot geworden über diese sein edleres Gefühl so tiefberührende Bemerkung. Er machte sich los von Pecavus, klopfte sich die Erde vom Westchen, unter dem ein so
mächtiges Herz schlug, daß die goldnen Blumen auf ihm zitterten, guckte ihn kühn an und rief. "Was haben Sie mir dies zu sagen, Gouverneur?" - Dann sprang er über sechs Rübenreihen zu Gritta und
faßte sie bei der Hand.- "Komm", sagte er; Margareta folgte, er ging graden Weges am Gouverneur vorbei. - "Halt!" rief dieser, - "Prinz, ich muß Sie von einem Ort entfernen, wo Rüben sind." "Erst
will ich dieses Fräulein in die Höhle begleiten", erwiderte der Prinz Bonus. Der Gouverneur schrie: "Prinz, Sie werden sich eilen!" Und ging ihm nach. - Dies schien er nicht zu wollen, er zog
sich langsam die Jagdtasche über; der Gouverneur polierte mit dem Schnupftuch seine goldne Dose, hielt sie schräg und erblickte in ihrem Spiegel, wie der Prinz eben Gritta die Hand drückte und
dabei schnell eine Träne mit dem Ärmel abwischte, da das Nasentüchlein heute bei einer Schmetterlingsjagd am Baume hängen geblieben war. - Und sie reichte ihm Scharmorzel an einem Strick, daß er
ihn zum Andenken mitnehme. Da ward der Gouverneur ungeduldig, faßte den Prinzen am Rock und trug ihn sanft über der Erde fort zu Höhle hinaus. Prinz Bonus strampelte wild, wendete sich noch
einmal um und rief. "Ade, liebste Gritta, weine dir die Augen nicht rot um so einen garstigen Kerl wie der Gouverneur ist! Mein Herz bleibt dir! Lauft ihr aber fort von hier! Denn wenn der
Gouverneur nach Hause kommt, schickt er sechs Mann Miliz, euch ins dunkle Loch zu holen. Doch wenn ich König bin, so" -- Pecavus packte ihn von neuem und trug ihn fort hoch über der Erde; er
verhedderte sich noch einmal aus Widerstand in einem Brombeerstrauch, dessen grüne Äste herüberlangten, dann verschwanden beide in den Büschen, und die Fetzen von des Prinzen Röckchen wehten
einsam am Brombeerstrauch, bis Gritta sie zusammenlas und zum Andenken einsteckte. Nun standen beide Kinder allein und schauten einander an! - "Wir müssen fort!" sagte Gritta; da kamen singend
die andern heim, die nach Brombeeren gewesen waren; sie erfuhren voll Staunen, daß es wieder fortgehe in die weite Welt. "Wir suchen uns bloß einen andern Ort im Wald, wo wir wohnen können",
sagte Gritta. Margareta packte, was sie finden konnte, ein und jedem etwas auf. Endlich war alles bereit, Margareta ging voran, dann folgten die andern, und zuletzt Kamilla mit der Ziege und
Gritta, die den Vögeln noch ein paar Käsekrümel aus dem Käsekorb herab streute. Keins sprach ein Wort beim Abzug. Nur Margareta und Gritta riefen zuweilen nach Wildebeere, aber sie kam nicht.
Bald war es wieder einsam um den Wohnort der wandernden Kinder: die Eichkätzchen wurden wieder wild, die Vögel verloren die zahme Liebenswürdigkeit, und das Gestrüpp überwuchs die alte düstere
Höhle, die melancholisch gähnte, daß in ihrem Schlund nicht mehr das lustige Treiben waltete.
Es war in einem dunklen Eichwald, nicht weit von einem Städtchen, durch welches vor nicht gar lang zwölf staubbedeckte Kinder pilgerten, worin sich eine wandernde Familie gelagert. Der alte Herr
im Schweinslederrock und seine Frau sahen wenig geschmückt aus: es war der Hochgraf von Rattenzuhausbeiuns und seine Gemahlin; sie saßen nebeneinander und hatten sich friedlich die Hand gereicht.
Auf der Hochgräfin Rücken saß eine Art Treppengebäude mit Stangen verwahrt; inwendig war ein großer Vorrat schön glänzender irdner Kannen und Töpfchen von roter, brauner, grüner und andrer
Glasur. Sie malte Grillenhäuschen, der Graf schnitzte Quirle und hatte mehrere eben verfertigte Mausefallen bei sich stehen. Sie hatten rechte Muße zu alledem, deswegen ließen sie auch die Zeit
vergehen und schauten auf einen Knaben, der im Grase lag und Blumen und Gräser ohne Unterschied um sich ausraufte. Sein voller Mund mit Doppelkinn zeigte das echte Stammgräflein; er hatte schöne
schwarze Erbaugen, mit denen er wunderlieblich umherleuchtete und dazu lächelnd zwei Stammzähnchen zeigte, mit denen er die Welt begrüßt und deren Schärfe wegen er mit Wurst statt mit Milch groß
gepäppelt war. Doch mit den schönen Augen konnte er nicht sehen; dies war der Gräfin Trauer, und wie man glaubte, war die Ursache eine Ratte, die es ihm wie die Schwalbe dem Tobias gemacht hatte.
Wie die Ratten dann auch daran Schuld waren, daß die Grafenfamilie von ihrem Erbsitz fern auf Wald- und Feldsitz kampierte. Es war heilloses Unglück nach Grittas Verschwinden durch sie über das
Schloß gekommen: erst geschahen kleine Neckereien, es blieb nichts unangeknabbert, leise fraßen sie sich hinter den Tapeten entlang, bis diese raschelnd herab flatterten. Doch immer stärker
schienen sie sich zu mehren, in Scharen liefen sie die Treppen herab, den Pagen um die Füße herum, daß sie stürzten. So manchem bissen sie in der Nacht das pomadierte Haar ab und zwickten und
neckten ihn, daß er wie toll aufsprang, oder machten die Runde um das gräfliche Lager und sprangen vom Betthimmel in des Federbettes Tiefe. Saß sie tags am Stickrahmen, so blickten sie mit
funkelnden Augen aus den Gardinenfalten, sprangen ihr über den Nacken und die Hand; fiel die Seide, wuppdich waren sie damit in ihren Löchern. Wie oft fuhr der Graf mit dem Schwert hinter ihnen
drein, aber es gelang ihm nie, eine zu treffen. Zuletzt stürzten sie über die vollen Eßtische in Scharen weg, und ein paar unglückliche Katzen, die angeschafft waren, um Jagd auf sie zu machen,
hoben die Pfoten auf, damit sie nicht von ihnen umgerannt wurden. Auf einmal war das Testament des Vaters der Gräfin von den Ratten gefressen, grade um die Zeit, als sie mündig wurde, und
zugleich meldete sich das Kloster, dem nach einer früheren Bestimmung, sobald kein anderes Testament da war, alle ihre Besitzungen zufielen, wenn sie nicht ins Kloster ging.
Nun war es aufgefressen und die Gräfin dadurch arm geworden. Da es nun nicht mehr so hoch herging im Schlosse und man allmählich wieder auf das lang verschmähte Grützenleben überging, so dankten
die treulosen Pagen ab; nur Peter blieb. Der Graf und die Gräfin wurden so von den Ratten geplagt, daß sie eines schönen Morgens auswanderten, den jungen Erbgrafen auf dem Rücken in einem
Leinwandsack, aus dem nur der Kopf hervorguckte. Sie schritten ohne Ziel in die Welt hinein und verdienten sich unterwegs ihr Brot mit Quirlschnitzen und mit einem kleinen Topfhandel, den die
Gräfin dazu angelegt hatte. - In jedem Ort, wohin sie kamen, suchte Peter nach Gritta umher unter den Kindern, die zusammenliefen, um den Mausefallenkrämer anzustaunen.
Sie standen jetzt auf und setzten den Majoratsherrn zwischen die Mausefallen auf des Grafen Rücken. Da sie nicht wußten wohin, so wanderten sie aufs Geratewohl zu; ein jeder kaufte gern eine
Mausefalle um des schönen Buben willen, der aus dem Korbe den Leuten entgegenlächelte, ohne sie zu sehen. Peter, der jetzt zur Familie gehörte, da die Gräfin klug und gütig und der Graf weniger
stolz durch das Unglück geworden war, unterstützte sie, so viel er vermochte. So kamen sie von Ort zu Ort und endlich nach einer Seestadt. Sie standen am Hafen, die Gräfin schaute sich ein wenig
um und steckte die von dem vielen Quirlschnitzen zerstochnen Hände unter die Schürze, und das Bübchen zwischen den Mausefallen jauchzte über das Wellengeräusch. Da kam ein Mann mit einem
Schifferhut auf sie zu und rief: "Was steht ihr da und seht? Kommt mit in ein feines schönes Land, wo euch die guten Früchte in den Mund wachsen, wo das Zeug gewebt von den Pflanzen fällt und ihr
über das Gold stolpert." Der Graf machte große Augen nach dem gelobten Lande, und der Gräfin schimmerten schon alle Herrlichkeiten in Gedanken vor. "Aber freilich, etwas Geld braucht ihr, um hin
zu kommen", sagte der Mann. Der Graf und die Gräfin blickten einander traurig an, als Peter mit dem Käsemesser den Ärmel auftrennte und einen stillverborgnen Schatz, seinen Lohn, aus ihm
hervorholte. "Das reicht zu", sagte der Mann. Gerührt schaute der Hochgraf den Peter an und rief. "Ich lasse nichts ohne Dank!" Peter hatte aber einen andern Grund als den Dank des Grafen, warum
er die Reise begünstigte: es war wegen eines Traumes, den er eines Nachts auf seiner Warte gehabt. Er saß und dachte an die kleine Hochgräfin; in Sinnen verloren blickte er nicht auf, bis eine
feine Stimme seinen Namen rief; verwundert sah er um sich. - Das Tal war belebt, weiße Nebelgestalten zogen hindurch, kamen hervor aus den dunklen Höhlenöffnungen in den Bergen und spielten im
Schaum der Wasserfälle, hingen an den Erlenbüschen, flogen zu den Sternen in die Höhe und zogen am Boden entlang tief im Tal. Noch einmal rief es: "Peter!" - und sieh - auf seiner Schulter saß
nicht eine Nachtmotte, für die er es erst gehalten, sondern ein feines Nebelwesen. Es sah wie Spinnweb aus, so fein, deswegen fürchtete er sich hinzusehen, und er blinzelte nur aus den
zugekniffenen Augen es an. "Du hast einen sehr rauhen Rock", sagte es, "aber dein Herz ist zart und lieblich. - Ich weiß wohl, du hast Sehnsucht nach dem kleinen Gräfinlein; aber es ist weit weit
über dem Meer, im Paradies, ganz gesund und fröhlich, das sei dir zum Trost gesagt, du mußt zu ihr wandern." Eben wollte Peter fragen, welcher Weg dahin führe. Auf einmal wurde ihm so schläfrig
zumut, das Spinnwebchen streute ihm wohl Mohn in die Augen; er verschlief die ganze Nacht und hatte am Morgen nur noch die Erinnerung eines Traumes. Unterwegs forschte er stets heimlich nach dem
Paradies, und um übers Meer zu Gritta zu gelangen, gab er das Geld. Am andern Morgen bestieg die hochgräfliche Familie das absegelnde Schiff.
Die Kinder waren auf ihrer Flucht im Wald noch nicht lange zugegangen, als er immer dichter und finsterer wurde. Gritta ging zur Seite an Buschwerk und alten Eichen vorüber, das sie den andern
einen Augenblick verbarg, als sie ein wunderbares Geklingel vernahm. Die Äste knackten neben ihr und rauschten, und aus ihnen hervor kam Wildebeere angesaust auf einem bunten Roß. - War es die in
den tiefsten Wäldern wachsende Springwurzel oder wirklich ein wunderbares Pferd? Sie konnte es nicht erraten. Vorn auf dem grünen Zweig mit roter Glockenblume saß luftig schwankend Wildebeere,
die Wurzeln setzten wild in die Erde, daß die roten Glocken flogen; schon war sie vorüber. Da hielt sie einen Augenblick, schaute Gritta tiefsinnig an, nickte und sagte lächelnd: "Sie wird bald
nicht mehr scheinen, die Sonne, sie sucht nur ihre goldnen Morgenschuhe, die sie verlor, als die Erdachse schief zu liegen kam und sie grade vorbeiging. Nun scheint sie in alle Täler und tiefsten
Tiefen, um sie zu finden; aber wo sind die hingerutscht bei der Verwirrung der Welt? Ist dir jetzt klar, warum die Sonne scheint?" Sie schnalzte mit der Zunge, schlug das Pferd mit einem
Blütenzweig, es bäumte sich und fuhr rauschend durch das Laub. - Gritta kam jetzt zur Besinnung; sie wollte sie ja rufen und ihr alles sagen, nun ritt sie davon und zog nicht mit ihnen. Sie
sprang ihr nach und rief. "Wildebeere!" - Bald hatte sie sie fast erreicht, doch sie entfloh dicht vor ihr ins Laub; bald eilte sie durch eine offne Waldgegend ihr nach, doch sie verschwand
hinter den Bäumen. Es schien, als winke und lache sie Gritta zu, auch war es, als unterhielten sich die Vögel mit ihr, wo sie durchflog, denn sie schrieen lustig untereinander. Gritta stolperte
über Wurzeln, fiel in Löcher, es wurde ihr ganz heiß, und sie erreichte sie doch nicht; auf einmal war sie fort. Gritta stand erschrocken und allein, sie rief nach den andern, nichts ließ sich
hören; nur der Specht klopfte an die Bäume, es wurde immer dunkler und eine immer tiefere Stille; sie ging schweigend durch die Bäume, da vernahm sie eine feine sanfte Stimme, die aus dem Boden
zu kommen schien: "Er sitzt schon wieder oben, und ich bin ganz allein, gefällt mir auch nicht mehr, denn die Vögel schweigen und es wird kalt." Dies sprach ein Kind in einem Rock von Schilf, es
saß auf der Erde, hatte wilde Blumen gepflückt und zerriß sie mit den Händchen. Gritta sah in die Höhe, denn sie hörte oben Geräusch. Es war ein freier einsamer Waldplatz, ein paar hohe Bäume
standen in der Mitte. Auf einem war ein großes Nest, viel größer als ein Storchnest; über des Nestes Rand hingen ein Paar lange Beine mit alten Stiefeln versehen, sie stachen grell gegen die
Abendsonne ab, die untergehend das Nest beschien. Gritta erkannte an diesen langen Beinen den alten Hochgrafen, ihren Vater; sie rief laut in die Höhe, der alte Hochgraf schaute schnell über den
Rand. Schier wäre er herabgesprungen vor Freuden, er hüpfte in dem Nest hin und her und guckte über den Rand, bis er sich endlich entschloß, herab zu steigen; er ließ eine lange Strickleiter von
Binsengras herunter und kletterte daran zur Erde nieder. Gritta bewunderte unterdes seinen Wams von grünem Moos, besetzt mit den schönsten Kienäpfeln, die Hosen, an denen kein Flicken gespart und
deren untere Hälfte mit zwei Ziegenfellköpfen verlängert waren. Endlich langte er an, nahm Gritta auf den Arm und konnte sie nicht genug küssen und ansehen. Gritta vergrub sich in seinen großen
weißen Bart, und ihre Tränen und seine Tränen hingen gleich silbernen Tropfen in den weißen Fäden. Eben kam die Hochgräfin mit einem Bündel Gras und Peter heim. Die Freude nahm gar kein Ende, bis
die Gräfin den kleinen Hochgrafen Tetel, das war das Kind im Gras, auf den Arm nahm und sie in die Hütte gingen, die von Reisig, Gras und Lehm zusammengeklebt war. Der Hochgraf nahm Gritta auf
den Schoß und rückte an das Feuerchen, das die Gräfin angezündet hatte. Gritta legte zum zweitenmal in ihrem Leben ihren Kopf an sein Herz und begann, alle Abenteuer zu erzählen; - während dem
rührte die Gräfin eine Milchsuppe; Peter hörte aufmerksam zu und wiegte im Hintergrund in einer aus Schilf geflochtnen Wiege, die an der Decke befestigt war, den kleinen Tetel, der ein
löwenzerreißendes Geschrei anstimmte aus Ankunftsfreude und Liebe zur Freiheit. Als Gritta geendet, erzählte der Graf von den Ratten, und wie sie auf dem Schiff gesegelt waren. Die Fahrt war gut
gegangen, nur hatte er immer an der schlimmen Seekrankheit gelitten; auch der kleine Tetel konnte das Wasserfahren nicht vertragen. - So hatten sie das verheißne Land aufgegeben, und als das
Schiff nicht weit von der großen Stadt Sumbona gelandet, waren sie gleich ausgestiegen und abgewandert. - In den Dörfern hatten sie gehört, daß kein Fremder das ganze Jahr in die Stadt
eingelassen werde; es sei nur möglich, wenn man dem Gouverneur ein Trinkgeld gebe. Sie erblickten schon in der Ferne das Stadttor, als ihnen ein Mann entgegen kam, der ein so schlechtes
diebisches Gesicht hatte, daß der Graf nicht umhin gekonnt, ihm eine Ohrfeige zu geben. Dies war grade der Gouverneur Pecavus. Der ließ sie nun verfolgen, bis in die tiefste Wildnis, wo kein
Verfolger noch hingekommen war. "O, liebe Gritta", fügte der Graf hinzu, "ich bin seit der Rattenzeit und seit des kostbaren Testaments Verschwinden in tiefem Nachsinnen über eine Geldschrank-
und Papierverschließungsmaschine. - Siehst du den Kasten, der dort in der Ecke steht? - Das ist eine ganz merkwürdige Maschine." Der Graf blickte mit der größten Liebe den Kasten an: "Siehst du",
fuhr er fort, "ich hatte bisher kein Material; so hab' ich ihn aus Kienholz gemacht. Sollte es irgend einer Ratte oder einem Menschen einfallen, den Geldschrank zu öffnen, so stürzt ein Balken
von oben herab und schlägt ihn nieder." "Ei, da brauchen die Ratten nur nicht grade vorne hereinzugehen. Wie geht's aber den Menschen, denen das Geld gehört und die davon haben wollen?" - "Ja,
Gritta, die werden auch geschlagen, das ist das Beste daran; die werden keine Verschwender. Willst du einmal probieren? Es tut nicht sehr weh, sind jetzt nur Kienäpfel darin, die kannst du dir
gleich heraus holen!" Gritta drückte fest die Augen zu. - "Ich glaube gar, das Kind schläft", sagte der Graf, und trug sie sanft auf das Mooslager von Peter.
.................................................................................
Die letzten Kohlen glühten auf dem Herde, und der Hochgraf schnarchte wie früher auf der Burg, wenn Gritta ihn heimlich an der Tür belauschte. Da ward ihr sehr wohl und friedlich, und nichts
drückte sie als die Sorge um die fernen heimatlosen Geschwister.
Der edle Hochgraf von Rattenzuhausbeiuns hatte das Nest auf dem Baum zu seinem eignen Zweck erbaut, es war nicht etwa das zurückgelassne eines Vogels. Er hatte die tief mystische Gedankenfolge
gehabt, daß man mit jenen fernen Sternwelten und dem Mond in Verbindung treten könne; ja, er glaubte sogar schon, in mehreren Nächten einen kleinen Mann auf dem Gestirn des großen Bären stehen
gesehen zu haben, der gleich ihm eine Stange mit Lappen bewegte. Nun machte er alle Tage Zeichen mit der Stange, und in der Nacht, nachdem er eine Weile geschlafen, sah er nach der Antwort. Auf
welche unermeßliche Höhe der Forschungen hoffte er zu kommen und welche unergründliche Tiefe der Ergründungen dachte er zu erreichen! - Am andern Morgen saß der Graf schon auf der Warte und
steckte eine Stange mit seiner früheren Ritterkleidung auf, die er, nachdem sie abgenutzt war, dazu gebrauchte. Bald ließ er seine Hosen wehen, bald einen alten Rock der Gräfin. Das war für die
Menschen auf der Welt eine unverständliche Frage, aber für den Mondmann sehr verständlich; der Hochgraf schrie dabei so laut, indem er wilde Gesten machte, daß Gritta aus ihren Träumen
auffuhr.
Gritta würde sich nun ganz wohl bei ihrem Vater befunden haben, hätte sie nicht an das Prinzchen und ihre Schwestern gedacht. Dann tat es ihr leid, daß die Gräfin traurig war über das Bübchen und
sich nach der Stadt sehnte, weil sie hoffte, dort könne ein großer Wunderdoktor es heilen; auch fehlte ihr ein Schloß mit vielen Herrlichkeiten; obwohl sie sich dies nicht merken ließ, so erriet
es Gritta doch. - Der alte Hochgraf war auch oft mißmütig, daß er keinen Stoff zu Maschinen hatte und alles aus Holz machen mußte. Die Kälte und Nässe auf dem Baume setzte immer mehr Rost bei ihm
an; sie fürchtete, nächstens würden Moos und Steinpilze auf ihm wachsen. Wie gern hätte sie ihm eine Sternwarte gebaut, von der er bequem das Firmament beobachten könne! Über dies alles
nachzugrübeln, vergaß Gritta nur dann, wenn sie mit Peter in den Wald lief, um die hochgräflichen zwei Ziegen grasen zu lassen; das Bübchen lief an ihrem Rock sich haltend immer hintendrein. Auf
dem Weideplatz legten sie ihn dann ins hohe Gras, er blieb zufrieden liegen und träumte. Während sie Reisig zum Feuer suchten, erzählten sie sich allerlei, was ihnen begegnet war; manchmal
setzten sie sich auch ins Gras und flochten Körbchen aus Weiden oder Binsengras und beklebten sie mit Tannenzapfen und Moos. Es war als helfe ihnen eine heimliche Macht dabei; denn die schönsten
Steinchen und bunten Käferflügel blitzten im Moos, ein leiser Wind trieb glitzernden Sand auf das Geflecht in zierlichen Arabeskenmustern von wilden Ranken, Eichhörnchen, Vögeln und fernen
Landschaften mit bunten Palmen. Gritta wußte, es müßten die Elfen sein; denn sie machten sich so gar oft merklich, flüsterten mit dem kleinen Tetel; eh' die Kinder sich's versahen, hatte er eine
Rohrpfeife im Munde und blies, so gut er konnte. Dann spielten sie in Grittas Haar, flochten es, und verwebten es mit dem Winde vereint in wilde Schlingen. Lachte Peter darüber, so fuhr ihm wie
vom Winde getrieben eine dornige Ranke übers Gesicht; freilich tat es weh, aber nachher hingen die schönsten rotgesprenkelten Äpfelchen daran. Die Ziegen standen meistens auf den Hinterfüßen und
schnappten nach unsichtbaren Leckerbissen. - Waren die Körbchen fertig, so trug Peter sie zum Verkauf in die Stadt. Ein Bauer, den er kannte, nahm ihn mit und gab ihn für seinen Sohn aus; mit dem
gelösten Gelde kaufte er alle Bedürfnisse ein und kam des Abends reich bepackt und mit vielerlei Neuigkeiten heim. Eines Abends brachte er die Nachricht, der König Anserrex leide an einem so
starken Stockschnupfen, daß jedesmal, wenn er genießt, ein Bülletin angeschlagen werde. Einen andern Abend erzählte er, der König habe auf die Gänse, die allmorgendlich zum Verkauf in die Stadt
hereingetrieben wurden, eine Steuer gelegt, nämlich daß er von jeder Gans den Leib bekomme, und die Verkäufer sollten nur Kopf, Hals, Flügel, Steiß auf den Pfoten eintreiben. Die Leute wollten
sich darein garnicht finden und schlugen großen Lärm; es sei aber befohlen, die Bäcker- und Fleischerläden der guten Stadt zu schließen, welche Maßregel gewiß den besten Erfolg haben werde.
Am andere Morgen saß Gritta unter den Weidenbüschen am Quell. Sie flocht einen Korb, Peter saß über ihr in einem Weidenbaum und warf die feinsten Zweige herab; dabei erzählte er ihr, was ihm
gestern im Walde begegnet war. Er hatte einen hellen Feuerschein im Gebüsch gesehen; als er etwas tiefer hinein gegangen war, erblickte er ein Kind, so groß wie Gritta, das vom aufwirbelnden
Rauch umgeben auf einem Laubzweig saß, der beinah ins Feuer hing. Unten sprangen kleine Elfenkerle hin und her und gruben in eine goldne Glocke wunderliche Figuren und Zeichen ein; es ging so
geschwind, sie hämmerten drauf los, daß die Funken umher stoben. Alle Zweige saßen voll Kerlchen, die ihnen zur Arbeit sangen. "Wart einmal, ich weiß noch wie es lautet!", sagte Peter.
"Du, aus goldnem Erz gegossen,
In ein edles Rund geflossen!
Feuerzungen dich durchdrangen,
Härteten die güldnen Wangen,
Daß, wenn du wirst oben hangen
Und es kommen dann die jungen
Wilden Winde angesprungen,
Wollen spielend Klänge rauben,
Artig nur zu schmeicheln glauben,
Du nichts fühlest von den wilden Scherzen,
Weil du reines Gold bist von der Wange bis zum Herzen."
Peter sah, daß Gritta nicht vergnügt war. "Was fehlt dir denn?" fragte er. "Ja, siehst du, das war gewiß Wildebeere", sagte sie, "dabei sind mir meine fernen Schwestern eingefallen. Ach, wenn es
das Prinzchen wüßte, er würde gewiß helfen sie suchen. Dann tut mir leid, daß die Mutter traurig ist um den kleinen Tetel; ach, wenn das der Prinz wüßte! - Und der Vater ist am allertraurigsten,
daß er nichts hat seine Maschinen zu bauen. Wenn der Prinz das wüßte!" - "Ach Gott, was so ein Prinzchen nicht kann!" sagte Peter, "ich will hinlaufen und ihm alles sagen." "Willst du das?" rief
Gritta und guckte vergnügt hinauf. In diesem Augenblick arbeitete sich etwas durch die Weidenbüsche; Scharmorzel war's, sein schwarzer zottiger Kopf guckte durch die Zweige; er sprang hoch auf
vor Freuden an ihr herauf, und sie liebkosten sich zärtlich; endlich bemerkte sie, daß um seinen Hals ein rosaseiden Band mit einem großen Brief befestigt war, sie band es ab. - Was war das für
eine Handschrift! - Als wäre eine Spinne aus dem Tintenfaß über das Papier gelaufen, und ein Siegel so groß wie der Mond, auf dem eine gebratne Gans, eine Zitrone in der einen und einen
Lavendelstengel in der andere Pfote haltend, abgebildet war. Peter kam eiligst herunter; sie buchstabierten lange hin und her und kriegten endlich heraus: "An meine herzallerliebste Gritta." -
"Ach, ein Brief vom Prinzchen!" rief Gritta, brach das Siegel und entzifferte mühsam die Schriftzüge. "Meine liebste Gritta, ich sterbe schier vor großer Sehnsucht! Mein Herz ist mir so schwer
wie ein Stein, der an einem Zwirnsfaden über dem Abgrunde hängt! Sollt' ich Dich nicht mehr sehen, so fällt es in den Abgrund der Traurigkeit! - Ich habe mich nun immer besonnen, wie ich Dich zu
mir bekommen könne. Scharmorzel durft' ich gar nicht heraus lassen, denn sonst wäre er zu Dir gelaufen, und das brachte mich eben auf eine kluge Idee an einem klugen Tag; ich habe nur einen in
der Woche. Den Montag muß ich arbeiten bei dem schwarzen Gouverneur Pecavus, am Dienstag muß ich spazieren fahren und die Untertanen grüßen, am Mittwoch lehrt mich der Vater regieren, auf
beiderlei Weisen: im königlichen Ornate und im Schlafrock. Am Donnerstag kann ich gar nichts denken, weil ich einen engen Säbelgurt tragen muß, weil Hofdiner ist; Freitag muß ich die
Briefkonzepte vom Pecavus abschreiben an das Prinzeßchen, das ich heiraten soll, und am Abend gelehrte Fragen an die Hofgelehrten tun. Aber am Sonnabend mach' ich mich davon und fliehe in den
alten Teil unseres Landschlosses, wo niemand ist, weil es dort spukt. Dort denk' ich denn an Dich, und dort fiel mir auch ein, daß, wenn ich Scharmorzel losließe, er Dich gewiß auffinden werde;
drum werd' ich ihm diesen Brief anbinden. Komm, liebste Gritta, besuche mich, ich darf nicht mehr fort vom Schloß. Wenn Du kommst, wart am Waldesrand, bis es Nacht wird; dann geh über die Wiese
bis zum Schloß, aber nicht zum Tor herein, sondern links nach dem alten Teil, da stehen zwei Türme, zwischen denen will ich Dir etwas herablassen, worauf Du Dich setzen kannst. Dann zieh ich Dich
zu mir herauf, dann wollen wir uns zusammen besprechen, was werden soll. Heute, morgen und übermorgen Abend harre ich auf Dich; kommst Du in dieser Zeit nicht, so denk' ich, Du bist rein weg von
der Welt, und mein Herz plumpst in die dunkelste Schwermut. Ach, wie gern entflöh' ich mit Dir! Aber ich verstehe gar nicht, meine feinen Halskragen einzupacken, daß sie nicht verderben. Ade!
Bonus."
Der alte Hochgraf hatte nichts dawider, daß Gritta sich auf den Weg mache; er meinte, sie solle durch den Prinzen auszuwirken suchen, daß sie frei in der Stadt leben könnten. Gritta flickte noch
alle Löcher in ihrem Röckchen, nahm ihr Bündel, von der Hochgräfin mit Brot gefüllt, küßte den kleinen Tetel und wanderte ab; der Hochgraf stieg auf sein Nest und schaute ihr nach. Peter
begleitete sie ein Stück Weges; er wäre gern ganz mitgegangen, aber Gritta wollte, er solle bei der Familie im Wald bleiben. Nachdem er genau den Weg beschrieben, schied er von ihr und kehrte
zurück. Scharmorzel lief mit, sie wanderten getrost zusammen durch den einsamen Wald. -
Bald ward es Nacht; der Mond spielte durch das Laub, es war wieder ganz so herrlich wie damals, wo sie die Geister sah. Als sie tiefer in den Wald kam, begegnete ihr ein Zug weißer Elfen, der an
ihr vorbei flog, sie verschwanden in den Bäumen. Es war alles so still, Gritta lauschte, die alten bemoosten Eichen schüttelten ihre Laubkronen im Nachtwind. - Sie wollte schon weiter gehen, als
ein Elfchen auf sie zugezogen kam; der kleine weiße Geist ließ sich auf ihre Schulter nieder. "Es ist gut, daß ich dich hier treffe", rief er. "Wie wußtest du denn, daß ich kommen würde?" fragte
Gritta. "O, der Großvater, der Mond, hat's mir gesagt. Er hat dich schon lange gehen sehen, er bewacht dich immer des Nachts und auch zuweilen am Tage, wenn er ganz unnütz vom Himmel herab sieht.
Doch komm, ich muß dich zu meiner Herrin führen." Das Elfchen flog voran durch einen dunklen Laubgang; am Ende desselben schlüpfte es in eine hohle Eiche. Gritta folgte, sie standen im Innern des
Baumes! - "Leise! - sagte das Elfchen und legte den Finger auf den Mund. Es war halb dunkel; eine blaue Glockenblume, in der ein Glühwürmchen ruhte, verbreitete ein sanftes Licht und hing über
einem weißen Bettchen, von Gold gedrechselt, mit Spinnweb überzogen; der gute Nachbar und Wirt, der Maulwurf, hatte sein Samtfellchen bei seinem Tode den Elfen im Testament vermacht: es war als
Teppich ausgebreitet. Die Wände waren rings mit grünem Moos tapeziert. Zur Seite saß die Elfenfürstin, ein Elfchen strählte ihr das Haar; der Tautropfen, der als Spiegel aufgehängt war, ließ ihr
nachdenklich trauriges Gesicht sehen. - Keins sprach ein Wort, es war so leise dämmerig im Gemach der sanften Elfe. Das Kammerelfchen winkte mit höchst bedenklichen Mienen zu schweigen; doch
plötzlich drehte sich die Gebieterin um; als sie Gritta gewahrte, winkte sie den Elfen, und sie verschwanden. "Liebe kleine Hochgräfin, setz dich auf die Erde, daß du besser hörst was ich dir zu
sagen habe!" rief sie freundlich. - Gritta hockte sich neben sie und bog den Kopf nieder. Ihr Haar bildete eine goldne Leiter bis zu der Elfe, sie stieg daran hinauf, hängte sich hinein und
begann: "Liebes Kind, schon lang bekümmere ich mich um dein Schicksal und führe über dich die treuste Aufsicht, du bist mir anempfohlen durch einen Geist; wir begegnen uns so oft auf dem Erdkreis
mit den Geistern der Menschen; weil sie wie wir zur Nacht ihre rechte Lebenszeit haben, so haben wir auch Freundschaft mit ihnen geschlossen. Als ihr ans Land getrieben wurdet nach jenem Sturm
auf dem Meer, haben wir euch errettet; der Schmetterling, der dich in die warme Mooshöhle, euern Wohnort, lockte, war von mir gesandt. Meine Elfen machten die zwei Ziegen eines Hirten wild, der
in der Nähe hütete, und jagten sie euch zu, damit ihr Nahrung haben solltet; ja, so manches haben wir für euch getan, wovon ihr nichts geahnt habt. - Jetzt, da ich vernehm', dass du zum Prinzchen
gehst, hab' ich dich vor einer Gefahr zu warnen, vor dem Gouverneur Pecavus: er ist niemand anders als der Pater Pecavi aus dem Kloster. Die alte Nonne Sequestra gab den Ratten jährlich eine
Speckabgabe, dass sie nie in das Kloster kommen durften, als wenn sie sie rufen ließ. Sie hatten ihr aber eine Nachricht zu bringen und hörten ungeahnt von ihr, wie sie mit dem Pater sich lustig
darüber machte, die Ratten betrogen und ihnen verheimlicht zu haben, dass dich die Gräfin richtig ins Kloster geschickt und nicht im Wald umbringen lassen oder in die weite Welt gejagt. Zu Anfang
ließen die Ratten ihren Zorn nicht merken, bis sie in einer Nacht mit allen Goldsäcken der Erbschaft deiner Mutter entflohen, die Sequestra im Kloster aufgespeichert hatte. Deinen Vater, von dem
sie meinten, er habe drein gewilligt dich zu verstoßen, hatten sie schon verjagt und konnten also nichts wieder gut machen. Aber von nun an hinderte nichts ihre blutige Rache an den alten Nonnen:
sie bissen ihnen des Nachts in den großen Zeh und in die Nase, zwickten sie, wo sie ankommen konnten, und zerstörten alles, so dass sie nicht mehr wussten, wohin. Dem Pater Pecavi ging's in
seiner Waldklause nicht besser; zuletzt löste sich das Kloster auf, die alten Nonnen wie die jungen gewannen einstweilen ihre Freiheit wieder, bis die Ratten vertrieben seien. Sie werden aber
dann gewiss auch nicht zurück gewollt haben. Der Pater Pecavi, der nun keinen Anhalt mehr hatte, reiste nach fremden Ländern, kam endlich hierher nach Sumbona und wurde Gouverneur." Gritta war
ganz verwundert: warum hatte sie das nicht gleich entdeckt, dass er das Paterchen Pecavi war? "Schöne, liebe Fürstin", rief sie, "nun ist keine Not mehr für mich, ich brauche bloß zu dem großen
König Anserrex zu sagen, der Gouverneur Pecavus ist niemand anders als das Paterchen Pecavi, eine tiefgesunkene Seele!" - "Und meinst du denn, der König würde das glauben?" unterbrach sie die
Elfenfürstin. "Eh' du es sagen kannst, erwischt dich auch der Gouverneur Pecavus und steckt dich ins schwarze Loch, und wenn du es sagst, macht er doch dem König weis, du lügst, aber hier", sagte
sie und langte aus dem Moos einen Brief mit großem Siegel hervor, "suche dem König diesen Brief heimlich beizubringen! Wenn er ihn liest, so ist dir und dem Volk geholfen; aber kannst du ihn ihm
nicht heimlich geben, so lässt er Pecavus ihn vorlesen, und der liest nichts heraus. Gehst du durch das Tor ein in das Landschloß, so erfährt es Pecavus, steckt dich entweder ein oder gibt acht,
was du machst. Dies alles muss ich dir überlassen, meine liebe Gritta, dir und deinem feinen Verstande. Bleib jetzt noch ein Weilchen bei mir, dann kannst du fortgehen." Vor der Baumhöhle
schimmerten weiße Gestaltchen, es waren die kleinen Elfen. Die Fürstin rief Gritta, ihr zu folgen, flog hinaus und schwebte dem Zuge voran. Gritta lief neben der kleinen Elfe, die sie hergeleitet
hatte. "Elfchen", sagte sie, "setz dich auf meine Schulter und sage mir, warum ist eure Gebieterin so traurig?" "Ach", erwiderte es, "ihr Bräutigam ist vom Mond bei seinem letzten Herbstschnupfen
weggeniest worden. Wer weiß, ob wir ihn je wiederfinden!" Sie langten auf einem mondbeschienenen freien Waldplatz an; die Elfchen setzten sich in luftigen Reihen auf die Grasspitzen, und Gritta
wurde neben die Königin gesetzt. Die kristallnen Becher klangen, die Elfchen schrieen untereinander, sanft vom Tau berauscht. Der Elfenkammerherr, im weißen Lilienblättersammet, mit Taudiamanten
besetzt, erzählte in einem fort Geschichten ohne Pointe und amüsierte damit den Hof. Eine Menge junger mondsüchtiger Elfenhofdamen wurden anmutig rot, wenn er feine Liebesanspielungen machte.
Alles schmeckte Gritta süß nach Blumen und Honig; dabei wurde eine sanfte Tafelmusik gemacht, die man kaum hörte. Der Mond schien besonders guter Laune, er lächelte zuweilen herab. Obschon ihr
alles sehr wohl gefiel, so meinte sie doch, sie müsse fort, und nahm Abschied. "Leb wohl!" sagte die Fürstin, flog in die Höhe und klopfte sanft der kleinen Hochgräfin die runde rote Wange. "Wenn
du mich nicht wiedersehen solltest, so werd' ich doch um dich sein. Sei weise und wandle wie bisher in den Kinderschuhen!" Gritta ging; am Waldesrand drehte sie sich noch einmal um und sah nach
dem wilden lustigen Fest, wo die Elfen im Mondschein gleich bis zum Himmel tanzten. Dann schritt sie schnell und eilfertig ihres Weges.
.................................................................................
Als sie aus dem dunklen Eichwald trat, lag vor ihr eine mondbeglänzte Ebne, auf der zuweilen kleine Nebel schifften. In der Mitte stand ein stolzes Schloss: seine Fenster und vielen Zinnen
blinkten im Mondlicht, der Wetterhahn auf dem Mittelturm leuchtete beim Drehen im Nachtwind wie gegoßnes Silber. Scharmorzel sprang lustig ihr voran durch das Gras, dass die hellen Tautropfen aus
den Blumen aufsprangen. Als sie an die Anhöhe gelangten, auf der das Schloss lag, klimmte Gritta links herauf; denn sie wusste, dass sie links vom Schloßtor abbiegen musste, das hinter jungen
Bäumen hervorsah. Sie ging an der Hinterwand des Gebäudes entlang; die Kellerfenster waren hell, neugierig blickte sie hindurch: vor dem prasselnden Küchenfeuer stand der Koch in weißer Schürze
und Zipfelmütze. Die Küchenjungen sprangen hin und her, kletterten in den Rauchfang nach den Würsten, zogen die Hasen ab, rupften die Hühner, brachten die Zutaten, hackten, backten, klopften,
stopften und lachten und stießen sich, wenn immer das Beste von allem in des Kochs Maul flog. - Gritta schlich weiter. - Noch ein Eckchen, so musste der unbewohnte Teil des Schlosses kommen, wo
es spukte. Es kamen alte graue Mauern, ein Turm und dann noch einer, der tief in das Gebäude hinein lag; sie waren wild mit Ranken überwachsen. Gritta übersprang Steine, Dornen und Brennnesseln.
Außer Atem hielt sie an und lauschte; da erblickte sie etwas Schwarzes zwischen beiden Türmen hängend. Es war der Brustharnisch eines Ritters; das Prinzchen hatte ihn zur größeren Sicherheit mit
einem Netz in manch heimlicher Stunde umknüpft. Sie hockte sich hinein, er setzte sich in Bewegung, und es ging hinauf, der Strick raspelte an der Mauer; sie getraute sich nicht, hinab zu sehen
in die schwindelnde Tiefe nach Schamorzel, der leise knurrte. Der Harnisch stieß an, Gritta steckte den Kopf heraus, sie war an einer Fensteröffnung angelangt. Kaum hatte sie sich umgeguckt, so
sprang sie hinein, denn es schaute sich schrecklich tief hinab. -
Sie war in einem düstern Kreuzgang. Vor ihr stand das Prinzchen, seine Augen leuchteten vor Freude durch das Dunkel. Wie schön war's, dass sie ihn wiedersah! - "Ach, Gritta", sagte er, "ich seh
dich wieder!" - Er fasste sie zärtlich am Rock und zog sie mit sich. "Komm, dort in die Stube!" Er holte einen Schlüssel heraus und Schloss ein Türchen in der Mauer auf; es knarrte und öffnete
eine gewölbte Kammer. Ein alter Tisch stand darin; die Überbleibsel der Rüstung lagen in der Ecke, und ein mächtig großer Schrank schnitt ärgerliche Gesichter über die herumschwärmenden Geister.
Der Prinz kletterte an der schrägen Wand herauf und machte ein kleines Fenster auf - nun wurde es heiter; der gestirnte Nachthimmel sah herein. Sie setzten sich auf den Tisch, schwiegen eine
lange Weile still und schauten einander an. - "Ei, dir ist's gewiss wohl gegangen" sagte endlich das Prinzchen, "du hast eine so schöne lange Nase bekommen! - Ich bin dir so von Herzen gut - so
lange warst du fort! - Deine Zöpfe sind viel länger gewachsen! - Aus Sehnsucht hab' ich manchmal wirklich nichts gegessen in dieser Zeit der Trennung. Wenn du willst, bleibe hier in dem alten
Turm, bis ich König werde, dann wirst du Königin." - Gritta meinte, das gehe doch nicht; das wäre, als sei sie ein wildes Tier, und im Winter würde sie einfrieren. - "Ach nein", sagte das
Prinzchen, "es soll schon schön hier oben sein! Ich stelle meine Blumen um dich her, ich hole meine goldne Krone und alle meine Edelsteine, und du bist in der Mitte der schönste Edelstein und
auch die schönste Blume." - Gritta lachte und sagte, sie wollten lieber in den Wald zusammen gehen. Sie flüsterten noch lange und erzählten einander, was sie erlebt hatten; doch die Zeit verging,
das Prinzchen sprang endlich vom Tisch herab, um zur Tafel zu gehen, bei der es nicht fehlen durfte, denn der König hielt streng auf die rechte Zeit. Kaum konnte er scheiden, so viel hatte er
noch zu sagen, bis Gritta ihn sanft zur Tür heraus schob. Er drehte den rostigen Schlüssel um, und sie war allein in der Kammer. Sie setzte sich wieder auf den hohen Tisch, rieb die von der
Nachtkälte erfrornen Finger und zählte die verschwindenden Augenblicke.
Das Prinzchen Bonus lief schnurstracks nach dem Speisesaal. Der Koch hatte alle Prozesse mit den Speisen vollendet, sie prangten schon auf der Tafel. Mit weißgepuderten Zöpfen standen die Diener
hinter dem Tisch und beobachteten den Dampf, der von den silbernen Schüsseln aufstieg. - Man hörte jede Fliege summen; augenblicklich entfernte auch der Leibkammerdiener solch einen Störenfried,
ließ er sich hören, mit der Serviette; dann stand er wieder wie eine Mauerparade und lauschte, wie zuweilen der goldne Sessel mit den schwellenden Kissen nach seiner königlichen Last seufzte. Das
Prinzchen setzte sich zur Rechten des königlichen Platzes auf seinen goldnen Stuhl nieder und amüsierte sich damit, bis der König kam, Brotkügelchen zu drehen, sie anzufeuchten, zu zielen und auf
die lange Reihe zur Jagd ziehender oder tafelnder Vorfahren, die die Wand entlang gemalt, zu werfen. Schon mancher von den alten steifen Herren besaß eine Warze: er wusste nicht wo. - Eben hatte
er die Nase eines dicken Herrn auf dem Korn, und die Diener duckten ehrfurchtsvoll den Kopf, dass die Kugel nicht in der Puderperücke hängen bleibe, als die Tür knarrte. Der Oberkammerdiener
strich zum letzten Mal die Falten vom königlichen Sitzkissen, und der König trat ein. Alles flog herbei! - Der König sank in den Stuhl. Nachdem er den Tisch überblickt hatte, schaute er
ungeduldig nach der Tür, denn die braungerösteten Semmelbröckchen zur Suppe --- sie fehlten! - Da kriegte das Prinzchen Bonus eine so große Sehnsucht nach Gritta. - Es fiel ihm eine List ein
fortzukommen. Er wollte nur erst etwas für Gritta zum Essen stehlen; während die königlichen Blicke noch auf der Tür ruhten, langte er mit geschwinder Hand einen großen braunen Pfefferkuchen
unter dem Konfekt hervor und brachte ihn glücklich unter das Tischtuch. - Der König wandte sein Antlitz, da wankte der untergrabne Konfektturm; die Diener sprangen herzu, er stürzte und die
Süßigkeiten rollten umher. "Was hast du gemacht?" fragte der König, Unrat merkend. Das Prinzchen errötete und haschte nach dem fallenden Konfekt. - Der König ließ es dabei bewenden, schielte aber
seinen Sohn von der Seite an, und da er ihn so aufgemuntert wie noch nie sah und auch die zerknitterte Halskrause bemerkte, fasste Verdacht in seiner Seele Raum. "Mir ist sehr schlimm", sagte der
Prinz und sprang auf, "ich muss fort." "Gehe", sagte der König - aber er wollte nur sehen, wohin er ging. Kaum war er fort, so warf der König auf die dampfende Suppe einen letzten Blick, lief in
sein Geheimkabinett, warf seinen Pudermantel über und schlüpfte zur Hintertür hinaus. Eben schlüpfte vor ihm her das Prinzchen aus dem Vorsaal in einen Gang hinein; der König schlüpfte nach, es
ging durch viele dunkle Gänge, - nicht in des Prinzleins Gemach, nein, in den Gespensterteil des Schlosses. Den König ängstigte es, dass die Geister ihn in dem weißen Pudermantel für
ihresgleichen halten könnten; da sah er, wie sein Söhnlein auf eine Tür zulief, um sie zu öffnen. Rasch sprang er auf ihn zu, wickelte ihm sein Taschentuch um den Mund, band ihn mit seiner
Leibschärpe, nahm ihm den Pfefferkuchen ab und praktizierte ihn in eine dunkle Ecke. Nun besann er sich, was konnte in der Kammer sein? - Sollten es vielleicht ein paar von den kleinen
Landstreichern sein, von denen ihm der Gouverneur Pecavus so viel Schlimmes erzählt hatte, um die der Prinz so viel trauerte, als man ihn gewaltsam von ihnen getrennt und nicht mehr allein in den
Wald gelassen, weil man sie nicht fangen konnte? Was sollte es anders sein? - Der König Schloss die Tür auf.
Gritta hatte unterdes auf dem Tisch gesessen und gelauscht. Sie hörte draußen ein Geräusch, als wenn etwas niederfalle; es folgte eine kleine Stille, dann öffnete sich die Tür, und ein Kopf
guckte herein. Nicht der des Prinzchens, nein, - ein runder, mit einem majestätischen Doppelkinn und großen glänzenden Augen. Gritta war pfiffig; - als die Gestalt nachfolgte und sie unter dem
weißen Pudermantel etwas blitzen sah, wusste sie gleich, wer es war. - "Ich bin ein Diener", sagte der König, der erst die Sache untersuchen wollte, - "weil der Prinz nicht kommen kann, schickt
er mich mit einem geeigneten Gruß und Pfefferkuchen. - Diese wohlgesetzte Rede machte Gritta noch sicherer. "Hör!" sagte sie, "mir ist sehr kalt, der Wind bläst hier so um das Schloss herum. Hole
dort aus jenem Schrank den Pelzrock! Ich will mich drin einhüllen." Der König hielt den Pudermantel zusammen, öffnete die große Schranktür, überwand seine Würde, und stieg über die Außenwand in
die schwarze Finsternis des Schrankes, um nach dem Rock zu fühlen. Aber paff, fuhr hinter ihm die Tür ins Schloss, und der erstaunte König war allein mit sich und den Schrankwänden. Gritta
draußen schwieg mäuschenstill, kletterte an der schrägen Wand in die Höhe und öffnete das vom Winde geschlossene Fenster, schaute einen Augenblick in den Sternenhimmel und dachte nach, ob der
Prinz wohl wegen ihr die Rute bekommen habe; dann nahm sie sich einen frischen Mut und stieg herab.
Sie spazierte mit dem großen Schlüssel in der Hand vor dem Schrank auf und ab; sie hielt ihn fest zwischen den Fingern, als hinge der König daran. Was kamen ihr nicht alles für Gedanken, was sie
verlangen könne! Aber, zu großmütig, um von der eingeschränkten Position des Königs Anserrex Vorteil zu ziehen, dachte sie nicht weiter daran, räusperte sich schnell und begann: "Höre, König, du
hast unrecht getan!" "So mach auf!" rief der König zornig, nachdem er sich von seinem Schreck erholt hatte. "Ich mache nicht auf!" sagte Gritta, "ich denke mir wohl, dass jetzt auf dem
königlichen Tisch die Schüsseln prangen. - Sie dampfen, alles wartet auf dich. Doch du kommst nicht, wenn du mir nicht etwas versprichst." -- Gritta lauschte, was der König mache. - Seufzte er
nicht nach den Speisen? - Der Gedanke nichts zu essen, erschütterte ihn gewiss sehr stark, denn der Schrank knarrte. "Du musst mir versprechen, freien Ausgang zu meinen Eltern zu lassen, und mir
und ihnen erlauben, ruhig in der Stadt zu leben, sonst lass ich dich nicht heraus! - Dann sollst du die armen gedrückten Gänsebesitzer frei von der Steuer geben. Du kennst nicht ihre Not, weil
der Gouverneur Pecavus dir nicht die Wahrheit sagt! - Er wird dir gewiss gesagt haben, der Kopf, die Füße, der Steiß und die Flügel seien die Hauptsache an der Gans, darum müssest du dir den Leib
immer als Steuer geben lassen. Wenn die Gänsebesitzer ihre Gänse eintreiben, so wird ihnen am Tor schon die Hauptsache ihrer Gänse genommen: denn glaubst du, dass man aus dem Kopf, Füßen und
Flügeln einen Braten oder eine Gänsebrust machen könne?" -- "Gänseklein!" ertönte es aus dem Schrank. Gritta schwieg. "Ach!" sagte der König mit schwacher Stimme, "wenn ich die Gänsesteuer
freigebe, so hab' ich keine Gänsepasteten mehr!" - "Was?" - sagte Gritta, eilig vor den Schrank schreitend, "dir macht sogar der tiefgesunkene Gouverneur Pecavus weis, dass die Früchte dieser
Steuerhärten alle in deinen Magen kommen? - Er treibt ja schon seit langem einen sehr ausgebreiteten Handel mit Spickgänsen! - Ich lasse dich nicht heraus, versprichst du mir nicht alles, was ich
verlange. - Der Staub wird auf den Schrank fallen viele Jahre lang, und der Holzwurm wird deine Stundenuhr sein, wenn du herauskommst, - das heißt - wenn er den Schrank aufgefressen hat. -- Ja,
König! - Hundert Jahre werden darüber vergehen, die Türme der Burg fallen, und die Pasteten in Staub zerbröckeln, wenn sie nicht vorher aufgespeist sind; und du wirst noch nicht heraus sein! -
Wer wird dich hier in dem Gespenster-Zimmer des Schlosses suchen?" - Sie legte das Ohr ans Schlüsselloch! - Alles war still! "Versprich!" sagte sie und klopfte mit dem Schlüssel ernst an die Tür.
"Kind, mach auf!" rief der König, "alles, alles erfüll' ich dir, du sollst selbst mit dem Prinzen Bonus Thronfolger spielen dürfen, wenn du aufmachst! -- Der Staub ist so stark im Schrank, oder
es steckt Nieswurz zwischen den Ritzen; ich muss niesen und kann nicht. O Kind, mach auf - ich - ich habe Hunger!" Gritta Schloss auf, unbekümmert, ob der König sein Wort halten werde, obwohl ein
König gewiss ein ganz anderer im Schranke ist, denn sie konnte ihn doch nicht länger hungern lassen, und sie hätte gewiss auch ohne Versprechen ihm geöffnet.
Er steckte den Kopf hervor, schob langsam nach, dehnte sich und schaute vergnügt umher. "Herr König!" sagte Gritta und zupfte ihn am Rock. Der König zog schnell den Schlüssel aus dem Schrank und
steckte ihn in die Tasche. - "Da ist ein Brief!" Sie übergab ihm den Brief der Elfenfürstin, er steckte ihn zu dem Schlüssel und schritt zur Tür hinaus. "Wisst Ihr, Herr König", sagte Gritta und
lief dicht neben ihm her, "der Gouverneur Pecavus ist kein redlicher" - sie wollte weiter erzählen, aber er lief so schnell, dass sie außer Wort kam. Beinah wäre Prinz Bonus von ihm vergessen
worden, so beeilte er sich der Suppe entgegen, hätte dieser nicht, als sie an ihm vorbei kamen, wild gegen die Wand gestrampelt; er band ihn los - und rannte dann noch schneller, dass die Kinder
nicht eilig genug nachtrampeln konnten.
Im Speisesaal harrten die Diener, in Aufregung über den wunderbaren Einfall des Königs, vom Essen wegzulaufen. Getröstet durch seine Wiedererscheinung sprangen sie herbei und rückten den Stuhl zu
seinem Empfang zurecht, wobei der Leibkämmerer nicht ermangelte, eine Freudenträne über die glückliche Zurückkunft auf des Königs Hand zu vergießen. Der König entfernte den lästigen Pudermantel
und ließ sich nieder. Auf seinen Wink erhielt Gritta ein Stühlchen dem Prinzen Bonus gegenüber. Sie konnten sich nur zuweilen anlachen, wenn sie sich streckten, denn eine große Kuchenpyramide war
die Mauer vor ihren Blicken. Man speiste ganz still. - Gritta wusste nicht, ob der König gnädig oder zornig gesinnt sei; er schien alle weitern Gefühle bis nach dem Essen aufzusparen. Endlich
erreichte dies sein Ende. Der König steckte das Schnupftuch in die Tasche und kriegte dabei den Brief zu fassen; er legte sich in den Stuhl zurück und brach das goldne Siegel von dem
feinduftenden Papier. Eilig schnäuzte der Leibdiener die goldne Kerze. "Aber das ist Augenpulver!" sagte der König. "Der Prinz lese, er putze sich aber vorher die Nase!" Der Prinz las:
"Großmächtigster König! In Deinem Lande lebt, was Dir bis jetzt unbekannt sein wird, eine Königin. Sie herrscht in ihrem Reich, im Wald, und was für Dich nur ein kleiner Fleck sein würde, ist für
sie ein Land. Du kennst das Geschlecht der Elfen nicht, aber Du wirst erfahren haben, dass sie Freunde Deiner Voreltern waren."
"Was?" sagte der König, "der Brief ist nicht von dem Kinde dort, sondern von einer Königin, die sich in meinem Lande ansässig gemacht hat, ohne mir etwas zu sagen?" -
"Wir sind von Uranfang hier gewesen", fuhr der Prinz zu lesen fort, "und also lange vor Dir, denn Dein Land ist das Paradies, deswegen es auch nur selten Winter wird, und wenn die Blüten fallen,
kommen schon wieder Blüten." "Also stamme ich von der Familie Adam ab!" sagte der König. - Der Prinz fuhr fort: "Gott-Vater, nachdem sein Zorn über Adams verbotnen Apfelbiß sich gelegt hatte,
versetzte es wieder auf die Erde. Alle Engel und Geister, deren Spielplatz es im Himmel gewesen, flohen nun nach allen Seiten aus seinen duftigen Büschen und schwangen sich auf andre
Himmelswiesen, um nicht mit hinab versetzt zu werden. Wir kleinsten Geister aber schliefen in den Blüten und Blumen, und als wir aufwachten, da waren wir schon in irdischer Luft und konnten nicht
mehr hinauf. Das war die Strafe dafür, dass wir genascht hatten aus Gott-Vaters Bierkrug. Das süße Honigbier lockte uns an wie die Fliegen, wir konnten nicht widerstehen." "Ich hätte nicht so
viel Wesen gemacht um ein bisschen Bier", meinte der König, "aber was steht nun noch mehr in dem Brief?" -
Der Prinz las weiter. "So klein mein Land ist, so vermag ich doch viel. Wenn Du mich vertriebest, würden die Quellen nicht mehr frisch rauschen, die grünen Wiesen verdorren, und die Zweige auf
den Bäumen würden nicht mehr schwer belastet von Früchten sein. Das Laub würde nicht mehr die Sonnenwege beschatten, es würde verzehrt werden von den giftigen Insekten, auf die mein Volk stets
Jagd macht, denn aller geheimen Naturkräfte bin ich mächtig, und vergnügt, Dir durch sie zu nützen." -- "Eine artige kleine Person, die Königin! Wir wollen sie lassen, wo sie ist!" rief der
König. Prinz Bonus fuhr fort:
"Ihr seid ein guter Regent, König, alles könnte unter Eurem Zepter gedeihen; nur eins ist Euer Unglück: - der Gouverneur Pecavus. - Schon lange sehe ich, wie drohende Stürme Eurem Haupte nahen;
aber heute bin ich zur Gewissheit gekommen, von wem sie ausgehen. Heute um Mitternacht hat mein Großvater, der Mond, eine Eule, die über den Wald nach dem Meere zuflog, aufgefangen; sie trug
einen Brief unter dem Hals an eine Klosterfrau, von niemand anders als dem Gouverneur Pecavus geschrieben. Er war früher Mönch in einem fernen Land und hat dort schon sehr schwarze Taten
vollbracht. Ich hoffe, dass, nachdem Ihr die Wichtigkeit des Briefes eingesehen, werdet Ihr die Botin, die kleine Hochgräfin aus dem alten Stamme der Rattenzuhausbeiuns, ehren und ihr um
meinetwillen das zulieb' tun, was sie wünscht. Jeden, der ihr etwas zuleide tun sollte, warne ich vor meinem Zorn. Ich grüße Euch und bin Eure ergebene Freundin und Landesverbündete." - "Lies den
Brief unseres Pecavus! Es wird nichts Übles darin stehen", sagte der König. Prinz Bonus las:
"Sequestra! Ihr lebt doch noch im Wald, bei dem großen Eichbaum, nach dem Ihr hingezogen seid, als die Ratten Euch vertrieben haben, und ich hoffe, dieser Brief kommt zu Euch. Mir geht es
glücklich. Ich sitz' in der Wolle, das heißt in dem Königspelz. Nachdem ich meinen Weg durch fremde Länder genommen, bin ich hier angelangt bei einem sehr dummen König!" - "Was?" rief der König.
- "Bei einem sehr dummen König!" - wiederholte Prinz Bonus, mit ausdrucksvoller Betonung. - "Obschon ich nun recht warm sitze, so suche ich mich doch noch höher zu schwingen durch einen Aufstand
unter den Gänseverkäufern, indem ich den König dazu bewege, sie zu drücken. Vielleicht, wenn meine Pläne gelingen, werde ich selber bald König sein; dann könnt Ihr kommen mit allen Nonnen, und
ich will Euch ein Kloster einrichten. Jetzt müsst Ihr auch wissen, dass ich die elf entflohenen Kinder entdeckt habe; die könnt Ihr gleich einstecken, wenn Ihr kommt. Allergeliebteste Sequestra,
schickt mir doch ein Schmalztöpflein für den dummen König!" - "Halt ein!" rief der König, "ich weiß genug. Diener! - Ruft mir den Gouverneur Pecavus in mein Geheimkabinett!" - Er sprang auf und
ging selbst hinein. Alsbald erhob sich drin ein fürchterliches Toben, als werde alles umgeworfen. Gritta und der Prinz lauschten an der Tür, sie konnten nichts deutlich hören, es ertönte bloß ein
wildes Geschrei durcheinander; auf einmal geschah ein Knall. - "Ach, wenn er nur meinem Vater nichts getan hat!" rief der Prinz und öffnete. Da stand der König und zog eben noch zweimal mit
seinem goldnen Zepter dem Gouverneur Pecavus etwas über. - Dieser hatte sich halb versteckt hinter eine Marzipankiste, das Hauptstudiermaterial im Geheimkabinett. Der Staub fuhr aus seiner
Perücke, und seine Augen funkelten glühend hindurch; jämmerlich gekrümmt sprang er hervor und floh vor dem ihn verfolgenden König hin und her. Bald wollt' er sich auf den Schrank retten, bald
kroch er unter dem Sopha durch; wie Flügel schwebte der schwarze Mantel in der Luft herum, wenn er die Hände weit vorausspreizte und allerlei unerhörte Worte schrie, wie "König Gänserich!" und
dergleichen. - "Ja, ins Loch lasse ich Sie setzen, schändlicher Pecavus!" rief der König erschöpft und blieb stehen. "Die Stadtmiliz steht schon vor der Tür." - "Glaubst du, ich könne nicht fort?
- König Anserrex!" rief Pecavus, "ich bin stets frei und gehe allein fort auf einem Wege, wo deine Stadtmiliz mir schwerlich nachkommen wird." Bei diesen Worten fuhr er durch den Kamin in den
Rauchfang hinein - er lachte noch einmal schauerlich - das Feuer flackerte auf, und er war verschwunden. Ja, es war der Pater Pecavi leibhaftig! Damals hatte ihn Gritta durchs Kamin herein- und
heute durchs Kamin hinausfliegen sehen.
Der König, froh, dass er ihn los war, freilich auf eine sehr unheimliche Weise, steckte das Zepter wieder hinter den Spiegel und wischte sich die Asche vom Gesicht, die ihm angeflogen war, da ein
großer Wind bei Pecavis Flucht aus dem Schornstein hereinblies. Dann nahm er seinen Nachtleuchter und sagte sanft: "Geh zu Bett, kleine Hochgräfin, ich werde dir ewig dankbar sein!" Er küsste sie
auf die Stirne und ging; Gritta winkte dem Prinzen heimlich "Gute Nacht"; zwei goldbordierte Bediente sprangen mit goldnen Leuchtern vor ihr her bis zur Schlafzimmertür, die sie sehr weit vor ihr
öffneten, dann mit ihren Wachslichtern der Ersparnis wegen wieder fortliefen und sie im Dunkeln allein ließen. Aber ein kleines Lämpchen brannte doch und erleuchtete halb das Zimmer. Es war sehr
herrlich, so herrlich wie Gritta es noch nie gesehen: die Wände waren golddurchwirkt und voll bunter Gemälde, in denen immer die Hauptperson ein Gantvogel war auf einer zackig geformten, goldnen
Schüssel, in der einen Pfote eine Zitrone, in der andern einen Lavendelstengel haltend. Sie vermutete, es möge wohl des Königs Lieblingsgericht sein; denn auch oben an der Decke, wo die
lieblichen Göttinnen mit langen Beinen hinter weißen Wolken sich versteckten und zärtlich herab sahen, hielt eine in der Mitte derselben mit feierlichem Anstand solch eine Schüssel. - Aus dem
königlichen Schlossgarten strömten Düfte herein, und hinter dem dunklen Laub plätscherten die Springbrunnen. - Es war doch gar zu schön! Gritta verlor sich ganz im Anschauen. - Da öffnete sich
leise eine Tapetentür, und eine allerliebst zierliche Hofmeisterin oder Schloßdame trat ein; sie praktizierte Gritta auf eine artige Weise Röckchen und Jäckchen aus und steckte sie in ein schönes
kleines Bett; das Prinzchen mochte wohl früher darin geschlafen haben, denn es war fein gedrechselt und ganz übergoldet. Die Hofdame Schloss die seidnen Wände der Gardinen und trippelte davon,
mit einem "Gute Nacht, liebes Kind!" Gritta lag ganz still in dem seidnen Paradies; Düfte wehten zum Fenster herein und stahlen sich durch die Ritzen der Gardinen. Behaglich dehnte sie sich, so
lang sie konnte, und legte sich von einer Seite auf die andre, bis sie still liegen blieb, nachsinnend über den alten Hochgrafen und die Mutter. - "Wie glücklich werden beide nun sein!" dachte
sie, "wenn sie eine schöne Heimat haben. Der König lässt sie gewiss holen; es wird mir nicht mehr Leid tun, dass der Vater nichts hat zum Maschinenbauen, und die Gräfin wird nicht mehr traurig
sein, denn sie werden alles haben. Aber der kleine Tetel!" - - Da raschelten die seidnen Gardinen und öffneten sich. Eine weiße Gestalt stand vor dem Bett, ihre wunderbaren Augen leuchteten durch
das Dunkel: "Liebe Gritta", sagte sie sanft, "ich bin die Ahnfrau vom Rutenbaum! Du hast mich erlöst, denn du bist die erste meines Geschlechts, die gewandelt, ohne die Rute zu verdienen, drum
sei von mir gesegnet! - Bald verlasse ich die Erde. Hast du irgendeinen Wunsch?" "Ach nein", sagte Gritta -- "nur der kleine Tetel" --- Die weiße Frau nickte, deckte sanft das verschobne
Federbettchen über Gritta, blickte sie mit den dunklen Augen segnend an und war verschwunden; die Vorhänge rauschten zu. Gritta schlief ein, und goldne Träume spielten mit ihr.
Am andern Morgen flog ein frisch betauter Apfel in die Bettgardinen; Gritta erwachte, ein zweiter flog zum Fenster herein. Sie schlüpfte schnell in ihre Kleider, eh' die artige Hofmeisterin käme,
der sie lieber selbst Dienste getan hätte. Es waren aber nicht mehr ihre Kleider, sondern neue von schöner Seide; als sie heimlich sich dreimal darin im Spiegel angeguckt, lief sie ans Fenster.
Prinz Bonus wandelte ganz herrlich geputzt zwischen den morgentauigen, von des Königs eigner Hand gepflanzten Kohl-, Rüben- und Spargelbeeten und suchte aus Artigkeit für ihn die Kappes aus, die
er auf ein grünes Blatt gelegt, ihm später präsentieren wollte. Er schrie: "Gritta, steh auf! Wie kannst du so lange schlafen, wenn die Welt schon ihr goldnes Taggewand angelegt hat?" - Gritta
war schon auf dem Weg zu ihm, als sie den Türmer blasen hörte; voll Ahnung lief sie an die Schloßpforte. Da stand der alte Hochgraf und die Hochgräfin vor dem Gittertor, und über der Hochgräfin
Schulter schwebte auf seinem Reiseplatz der kleine Tetel; hinter ihnen stand Peter, und Scharmorzel, der die ganze Nacht ausgesperrt gewesen war, bellte mit freudiger Ungeduld. Unten lag die
sonnige Au im Morgennebel, und Gritta meinte, sie sähe etwas Weißes flimmern, doch merkte sie nicht drauf, weil sie nicht schnell genug in dem dunklen Torweg an der Wand in die Höhe konnte, um
den Schlüssel aus dem Mauerloch zu langen, in das ihn der Torwächter legte, weil, wenn geklopft wurde, gewöhnlich alle Leute früher aufwachten als er. - Bald lag Gritta dem Hochgrafen um den
Hals.
"Weißt du, warum wir kommen, Gritta?" sagte die Hochgräfin. "Heute Nacht im Traum hab' ich eine weiße Frau gesehen; die sagte, wir sollten hierher gehen, es sei alles herrlich und schön mit dem
König. Da haben wir uns denn aufgemacht."
Sie traten nun durch den Torweg in den Schlosshof herein. Während sich der Hochgraf erkundigte, wie alles gegangen mit Gritta, schaute die Gräfin nach den Zinnen. Sie leuchteten in der Sonne, und
die Tauben umflogen sie in Schwärmen; ihr weißes Gefieder blinkte beim Wenden, dann ließen sie sich nieder zu den Hühnern, die auf den reinen Steinen des Hofes geschäftig hin und her eilten. Vor
einer kleinen runden Tür mit Steintreppe sammelten sie sich alle. Die kalekutischen Hähne kullerten, als erwarteten sie etwas; die Hähne stolzierten voll Aufmerksamkeit auf und ab. Perlhühner und
Haubenhühner liefen gackernd durcheinander und legten ihre Eier im Kreis vor die Tür zierlich in den weißen Sand. In der Mitte des Hofes trieb der Brunnen seinen Silberstrahl in die Luft; die
runden Spiegelscheiben in den Fenstern blinkten, und wo sie offen standen, trieb der Wind mit den seidnen Vorhängen sein Spiel und ließ die bunten Scherben sehen, in denen die Schloßjungfern
dunkelrote Nelken zogen.
"Ei, wie herrlich ist hier alles! - sagte die Gräfin, "und wir? - Wir sind zwar rein gewaschen, aber schau einmal, Gritta, was da viel Löcher in deines Vaters Rock sind! Ich hatte keine Seide zum
Nähen und" -- Sie schwieg erstaunt. - Aus der Turmtür, um die sich das Hühnervolk drängte, trat der König heraus, in einem goldnen, mit roten Tulpen bestickten Schlafrock. Mild und blühend lachte
sein Antlitz, wie die Hoheit selbst und doch so heiter, nicht ermüdet, wie man vermuten sollte nach einer so geschäftsvollen Nacht, denn der Koch hatte eine Morgenpastete sondergleichen gemacht.
Schnell warf er die goldnen Weizenkörner unter das Gefieder, als er den Grafen erblickte. Er nahm sich kaum Zeit, ein paar weiße Eier der artigen Hühner in den Rockärmel zu stecken, kam auf ihn
zu und sagte, er habe gleich erraten, wer der liebe Gast sei, und bedaure höchlich, dass der Hochgraf zu Rattenzuhausbeiuns schon so lange in seinem Land sei, ohne zu ihm zu kommen. Er war so
mild und gnädiglich und spazierte die Treppe nicht eine Stufe voran beim Hinaufsteigen, und auf seinen Lippen war ein unerlöschbares Lächeln. Der Graf folgte mit tiefen entzückten Verbeugungen.
Oben angelangt, ließ der König noch einmal auftragen, der Gäste wegen. Der Hochgraf und die Hochgräfin mussten zu seiner rechten und linken Seite Platz nehmen, er fischte mit seiner Gabel den
besten Stücken in den Pasteten nach. Unterdessen erzählte der Graf von einer Maschine, junge Kükel, Hasen, Rehe und Gänse auszubrüten. Die Gräfin wollte mehrmals sagen, dass Hasen und Rehe nicht
in Eiern auf die Welt kämen; aber der Graf, der in gelehrten Ansichten keinen Spaß verstand, gab den Bescheid, die Frauen verständen davon nichts.
Gegen Ende der Mahlzeit machte der König ein tiefernstes Gesicht, räusperte sich und sprach mit tiefgefühltem Wohlwollen und Liebeslächeln zum Grafen. "Umarmen Sie mich, edler bewährter Freund!
Ich erkenne Ihren großen Genius! Vermählen wir unsre Kinder mit einander! Dies wird das schönste Band zwischen mir und Ihnen sein, fester als alle Kükelmaschinen. Zwar hatte ich meinem Prinzen
eine ernstere Staatsverbindungsvermählung zugedacht; aber sehen Sie, Lieber, diese Ihre große Fähigkeit der Staatsmaschinenkunst würde ja alle politischen Staatsverbindungen bei weitem
übertreffen. Sollten Sie nicht als königlicher Hofschwiegervater Ihren Wirkungskreis haben? Das sollte mir Leid tun! Zweitens, da das Äpflein nicht weit vom Stamme fällt, so vermute ich, dass das
Töchterlein eine talentvolle Königin werden wird; ja, gestern hat sie schon vor mir ihr Licht nicht unter den Scheffel gestellt." Der Graf verbeugte sich tief. - Gritta war über alle Maßen
erstaunt; sie legte einen Pfefferkuchenmann, dem sie soeben den Kopf abgebissen, erschrocken auf den Teller. Aber das Prinzchen neben ihr reichte ihr mit bittendem Blick eine verzuckerte
Pomeranze und fragte: "Willst du? - Ich langweile mich so sehr allein!" - Sie nickte und nahm die Pomeranze.
Eben fischte der König dem letzten Brocken in der Sauce nach, als der Turmwart von neuem blies. Gritta lief zum Fenster, um zuerst zu erfahren, was es neues gäbe. O Wunder! Vor dem Tore standen
zehn Mädchen! - Schier wär' die kleine Hochgräfin zum Fenster herausgesprungen, denn die voran an dem Schloßtor rüstig klopfte, war niemand anders als Margareta! Gritta sprang die Treppe herab
und lag in ihren Armen. Was war sie lang geworden! - Gritta wünschte sich ein Schemelchen, um hinauf zu steigen und ihr ins Gesicht zu sehen, in die braunen Augen, so freundlich wie immer, und
ihre Wangen zu küssen, so rot wie der schönste Apfel. Sie lief nun von der einen in der anderen Arme, bis sie endlich außer Atem stille stand. Eben wollte sie anfangen zu fragen, da erschien der
König an der Pforte. "Ach, was für artige kleine Jungfern!" rief er, "das sind also die Landstreicher! - Ach, hätte ich doch noch zehn Söhne! Nun, so wollen wir gleich heut Nachmittag Hochzeit
halten, ohne Vorbereitung von großen Spargelkrautpforten und Volksgeschrei, denn es wird nichts davon erfahren. Ich muss so immer, wenn ich von meinen Reisen komme, acht Tage inkognito bleiben,
bis sie sich zum Schreien zurecht gemacht haben, und dann hinaus spazieren fahren, um zum Empfangstor wieder hereinzukommen. - Aber in die große Stadtkirche muss gleich geschickt werden, um alles
zurecht zu machen!" "Nein, Euer Majestät!" - sagte Margareta zum König, indem sie ein solches Knixchen aus ihrem Sittenspeicher holte, dass er ganz gerührt wurde. "Wenn Gritta heiraten soll, so
lasst die Trauung bei uns sein in unserm Waldkloster!" Der König nickte, etwas verwundert über das Waldkloster, und ging nachgrübelnd umher, ob er es nicht eigentlich auflösen müsse, weil sie ihm
sonst die Gänseweide im Wald niedertreten könnten; aber großmütig ließ er später den Gedanken fallen. "Was ist das für ein Waldkloster?" fragte Gritta. "O, wir haben uns ein Kloster im Wald
gebaut", sagte Margareta, "schön und zierlich, von Rohr, Lehm und Feldsteinen, mit kleinen Zellen und Fensterchen! Es ist alles rings herum dicht verwachsen, und ein Gänglein ist in der Mitte des
Klosters, da fliegen die Vögel aus und ein und bauen ihre Nester an die Wand." - "Wie kommt ihr zu dem allen?" rief Gritta, voll Freude, dass es ihnen immer wohlgegangen war. "Das will ich dir
erzählen! Wir wollen uns dort auf die Turmtreppe setzen, das Prinzchen hat doch schon die andern hinaufgelockt auf den Taubenschlag. Es wär' uns auch gar nützlich, hätten wir zwei Zuchttauben. -
Also du warst uns abhanden gekommen, und wir liefen überall herum nach dir, doch alles vergeblich. Wie wir nun so ganz unglücklich in die kreuz und quer rannten, erblickte ich etwas Weißes aus
Blumen und Distelkraut ragen. Es sah seltsam aus; ich dachte erst, es wär' eine große weiße Pusteblume; aber - Gritta, ich bitte dich, erschrick dich nicht - sie bewegte sich, der alte Jude
Abraham vom großen Meerschiff erhob sein weißhaariges Haupt und sah uns an! - Was das für eine Freude war! - Er erzählte uns, sie hätten sich damals alle vom Schiff auf einen Kahn gerettet; er
wär' aber so voll gestopft gewesen, dass, als Frau Maria uns noch habe holen wollen, die Leute sie fest gehalten hätten, weil es nicht möglich gewesen sei, dass das Schiff uns noch tragen konnte.
Sie seien nun vom Sturm unweit der Stadt Sumbona ans Land verschlagen worden, von wo bald alle wieder abgereist waren, weil der Gouverneur niemand in die Stadt ließ. Nur er sei da geblieben, um
sich erst eine kleine Summe mit Weben zu verdienen vor seiner Abreise, weil er immer gehofft, in die Stadt zu kommen. Da dies ihm nicht gelungen, zog er sich in den Wald zurück, und lebte jetzt
in einer kleinen Hütte. - Wir blieben nun beim alten Abraham und waren die erste Zeit sehr traurig um dich; - doch fort wagten wir uns nicht, um dich zu suchen, denn der Gouverneur Pecavus ließ
im Wald Jagd auf uns machen. Den Jägern war befohlen, jegliches Wild unserer Art einzufangen. So bauten wir uns denn ein Kloster; - hätten die Elfen nicht dabei geholfen, so wär' es wohl nie
fertig geworden. Wildebeere kam nämlich eines Tages zu uns, und seit der Zeit war des Nachts immer ein heimliches Treiben: es pochte, hämmerte und bohrte, und immer war am andern Tag darauf das
Kloster wieder weiter fertig, und immer schöner ward es. Als es ganz fertig war, machte uns der alte Abraham einen Webstuhl nebst Spinnräderlein und lehrte uns Spinnen und Weben; dann nahm er zu
unserm großen Leidwesen Abschied, um in sein Vaterland zu gehen. Wir gaben ihm Briefe mit an unsre Eltern; er versprach, bald wieder zu kommen und uns Nachricht von ihnen zu bringen, und dann
wollte er für immer bei uns bleiben, um seine Knochen unserem Kloster als Reliquien zu schenken. So haben wir uns denn ganz eingesponnen und eingewebt im Wald; viel dachten wir an dich, und die
Zeit verging. Vor ein paar Tagen noch schenkten uns die Elfen eine goldne Glocke in unsern Klosterturm, mit schönen Figuren drin eingegraben, die sie selbst in dem Wald des Nachts gegossen und
graviert haben. Heute Morgen auf einmal kam Wildebeere, rief uns wach und erzählte alles, was dir begegnet ist; sie hatte alles von den Elfen erfahren. Früher hatte sie uns nie Nachricht von dir
gebracht, wahrscheinlich weil sie sich bloß um die Wissenschaft bekümmerte; wir machten uns gleich auf den Weg hierher. Aber wie schön ist es jetzt im Kloster! Ein jedes hat sein eignes Geschäft:
Reseda läutet alle Morgen und Abend, Petrina muss das Kapellchen ausfegen; Lieschen muss es schmücken mit Blumen, sie kann die so schön aus bunten Federchen zusammenbinden, die die Vögelchen vor
der Klostertüre fallen lassen, wenn Elfried sie füttert u. s. w. Sonst arbeiten wir zusammen, schwingen den Flachs und spinnen ihn; dazu kommen öfters in den Dämmerstündchen die Elfchen und
erzählen uns die schönsten philosophischen Gedanken, und wir spinnen alle so vergnügt im Mondenschein. Dann weben wir und bleichen, wobei wir sehr vorsichtig zu Werke gehen, weil wir bemerkten,
dass die kleinen Elfchen gern unter der Leinwand sitzen und allerlei Spuk darunter treiben. Harmoni hat ein wunderbares Instrument zustande gebracht, bei dem ihr die Elfchen beigestanden; darauf
musiziert sie in der Kapelle und hält alle unsre Stimmen zusammen. Maieli hat die Kapelle gemalt; aus den beiden wird etwas. Du glaubst nicht, wie schön die Kapellenbilder sind. Ich bin nun die
Äbtissin und wünsche nichts, als dass du als Königin unser Kloster genehmigst und es "Zu den zwölf Landstreicherinnen" nennst. Wir besitzen einen Klosterschatz von Bienen, die sich bei uns
eingewohnt und ganz zahm und verständig sind; wir brauchen sie als Boten, sie schwärmen von uns zu den Elfchen und von dort wieder her und von einem zum andern, um uns bei Gelegenheiten und
Geschäften zu rechter Zeit zusammen zu rufen; von denen sollst du jährlich ein Töpfchen ihres klarsten Honigs als Abgabe haben. Doch jetzt muss ich fort ins Kloster. Wir haben heute das erste
Elfenbier gebraut, das möchte überlaufen; dann muss ich auch noch helfen, in der Kapelle die Hochzeitsanstalten machen, und wir müssen uns putzen: da habe ich keine Zeit zu verlieren." Sie rief
die andern vom Taubenschlag und zog eilig mit ihnen ab, außer Kamilla, die zurück blieb, um den Weg nach dem Kloster zu zeigen.
Am Nachmittag, als der Wald vom Sonnenschein durchglänzt in voller Pracht stand, zog der Brautzug nach dem Klösterchen. Ihm voran ging der alte Hochgraf mit Gritta und Scharmorzel, auf Kamillas
Schritte achtend, die als Wegweiser durch den Wald sprang. Sein Bart glänzte weiß und gestrählt über ein neues Wams, und er sah vergnügter als je aus. Dann kam die Hochgräfin mit dem kleinen
Tetel; sie war ein wenig still und traurig, trotz ihres prächtigen Seidenrockes mit langer Schleppe, denn sie dachte daran, dass der kleine Tetel nicht die Herrlichkeit des Waldes sähe. Nach ihr
kam der König und das Prinzchen mit Peter Hand in Hand. Der König hatte das Gefolge am Waldessaum zurückgelassen. Dieser Umstand und ein leichter Sommerschlafrock, nicht der schwere Thronpurpur,
stimmte sein weiches Gemüt zu einer milden Fröhlichkeit. "Sieh! Prinz", sagte er, "was meine Pantoffeln nass werden auf dem grünen Boden; was ist das?" "Das ist Tau, lieber Herr Vater!" - "Ach
so! Ich bin seit so vielen Jahren nicht in einem Wald gewesen! - Ich glaub', ich war mein Leben kaum einmal drin; man hielt das sonst nicht für einen passenden Ort für die Königswürde, weil
Krone, Zepter und Thronmantel gar leicht konnten an den Sträuchern hängen bleiben. - Was ist das? - Wiegt sich dort auf dem schwankenden Zweig in der Sonne ein Krammetsvogel?" - "Das ist ein
Zeisig!" sagte der Prinz - "Ach was!" rief der König, "was heißt das, Zeisig! - Solch einen Vogel gibt es nicht; ich weiß wohl von dem Rebhuhn, von der Schnepfe, dem Wasserhuhn, der Wachtel, dem
Krammetsvogel, der Lerche, dem Haselhuhn, dem Birkhuhn, Fasan und dergleichen, aber von keinem Zeisig hab' ich je gehört. - Horch wie es pfeift!" - und einem unwiderstehlichen Drang nachgebend
legte er sich ins kühle Moos. - "Was pfeift da so süß?" - "Eine Nachtigall!" sagte der Prinz. - "Ach", rief der König, "gewiss ein Rebhuhn! Ja, es schmeckt meinem Ohr zu gut!"
................................................................................
Was den König zum Weitergehen brachte, war ein Ameisenhaufen unter ihm, der sich wild widersetzte gegen die schnelle Besitznahme. - "Gott!" rief er, "ich kenne die Freuden des Waldes noch gar
nicht! - stand auf und rieb sich die gebissenen Stellen. Der stockende Hochzeitszug wanderte weiter. Immer vergnügter wurde der König und fing an zu singen: "Die Pinschgauer wollten wallfahrten
gehen!" Ob dieser grausamen Tonsätze, bei welchen des Königs Stimme lustig auf den höchsten Höhen irrte und in die tiefsten Abgründe stürzte, entflohen alle Vögel. - Sie sahen endlich das
Klösterchen. Es lag tief versteckt im Wald, die runde Tür war umrankt mit wildem Kreuzblatt; aus einem kleinen, dicht mit dunklem Grün bewachsnen Fenster steckte Margarete ihren Kopf; ihr braunes
Haar lag so glatt, gleich einem goldbraunen Mützchen um ihr Gesicht, sie sah so weise wie noch nie aus. Schnell verschwand sie, als sie den Zug kommen sah, und bald unterbrach Glockenklang die
Waldesstille. Gritta schritt mit dem Grafen über die Steinschwelle. Ein zwitscherndes Vogelpaar über der Tür sendete ihr seinen warmen Gruß aus dem Nest auf das Schleierchen herab, sie schaute
freundlich empor und lockte sie - der Zug geriet ins Stocken. Die alten Vögel schickten ihre jungen, sie flatterten um sie her, sperrten ihre gelben Schnäbel auf und wollten Futter haben, bis der
Hochgraf ärgerlich wurde über das zärtliche Gezwitscher, Gritta sanft einen Stoß gab, mit der Hand unter die Vögel fuhr und sagte: "Bedenke doch, Gritta, dass du eine Braut bist!" Sie warf sich
schnell wieder in die Brust, dass das Brautkrönlein auf ihrem Haupt zitterte, und trippelte in das dunkle Kreuzgänglein hinein. Sie zählte die Türen an der Seite: es waren grade zwölf, zu jeder
Seite sechs, also auch für sie war ein Zellchen bestimmt. Sie machte die Augen zu, um es nicht zu sehen, denn es tat ihr leid, nicht darin wohnen zu können; doch sie wollte das Heiraten dem
Prinzchen einmal zu Gefallen tun. "Ach, wie schön!" rief da alles um sie her. Und der König sprach ganz entzückt: "Ei, da ist ja gar etwas in meinem Lande, wovon ich nicht weiß! Die artigen
Klosterjungfern, sie sollen einen kleinen Orden haben!" Gritta sah auf, es fiel ein helles Licht in den dunklen Gang, aus dem von Margarete geöffneten Kapellchen, das am Kloster wie eine Blume am
Stängel hing und in bunter Pracht schimmerte. Sie gingen hinein, eine liebliche Musik begann, und im Chor fiel der Kindergesang ein. Der Hochgraf von Rattenzuhausbeiuns wurde nach einer Weile,
als das Entzücken zu lang dauerte, unruhig und räusperte sich. Das Prinzchen stellte sich schnell an Grittas Seite vor den Altar, und Scharmorzel setzte sich in die Mitte und kaute an der
Altardecke. Doch der Graf sah immer noch zornig vor sich hin. "Was fehlt dir denn?" fragte Gritta. "Nichts als der Pfarrer!" - Alle sahen sich verwundert an. "Lieber Hochgraf!" sagte der König,
"ich ernenne Sie zum Hofprediger dann und wann bei besondern Gelegenheiten, wenn wir ihn nicht entbehren können." Der Hochgraf stellte sich vor den Altar in Positur und hielt eine lange,
ergreifende Traurede. Unterdessen sah sich Gritta um. Das Kapellchen war bunt gemalt. Zwischen beiden Fenstern, vor denen die Baumzweige, vom Wind geschaukelt, sich neigten, war das Bild der
Mutter Gottes gemalt; unter dem blauen Sternenmantel lachten die zwölf Bilder der Kinder hervor. Auf dem geschmückten Altar blühten die Waldblumen, und dazwischen brannten die weißen Kerzlein von
dem Klosterwachs. Kamilla schwenkte in einem fort das Rauchfass, es war ein sanfter Schein und ein süßer Duft in der ganzen Kapelle, so dass allen das Herz aufging vor Freuden und Wohlgefallen.
Prinz Bonus stand mit offnem Mund und sah den Grafen an, ganz mit Andacht übergossen, sein goldner Haarschein strahlte; Gritta, in ihr Schleierchen gehüllt, stand tief in sich versunken. Da
raschelte Margareta mit dem Schlüsselbunde hinter ihr. - "Wie schön ist alles!" sprach Gritta leise, um den Grafen nicht zu stören. "Ja! Siehst du! Das vermögen fleißige Hände", erwiderte
Margareta mit Äbtissinnenwürde. "Wie schön die Farben auf den Bildern sind!" "Sie sind von den Elfen von lauter Blumen zubereitet. Aber sieh einmal, was rührt sich denn da auf dem Boden?" Gritta
sah hin. - Die Erde wurde dicht vor dem Altar von innen aufgewühlt, und der graue Kopf einer Ratte bohrte sich durch. Sie fraß sich ganz gemütlich einen runden Ausgang, dann sprang sie heraus und
zog an ihrem Schwanz eine zweite nach, diese eine dritte und so fort. Die erste führte den Zug im Tanz zu einer zierlichen Karmagnole um des Grafen Füße, dann zwischen ihnen durch um Gritta und
Bonus herum. Der Graf haschte nach Gedanken, wie jemand, der mit der Fliegenklatsche in der Luft nach Fliegen schlägt; sie flogen jedoch ganz fort, als zuletzt drei Ratten mit dem Wappen der
Rattenzuhausischen Familie, das über der Burgtür befestigt gewesen, über seine Füße sprangen und es aufstellten. Dann folgten ihrer noch achte mit schweren Goldsäcken beladen. Die Ratten hatten
sich einen Tunnel gebaut unter dem großen Meere weg und sich mitten durch die Erde gefressen, um ihr Unrecht wiedergutzumachen, dem Grafen das Wappen seines Stammes und das Erbteil der Gräfin zu
bringen. Die weissagende Ratte sagte genau Ort und Stunde der Vermählung Grittas voraus, und sie hatten möglichst präzis gesucht, vor des Grafen Traurede anzukommen. Sie machten nun die artigsten
Gesten, worin sie alles dieses deutlich ausdrückten, und demutsvoll um Verzeihung baten.
"O ja!" rief der Hochgraf, "ich verzeihe euch! Sonst wissen die Adligen ihren Adel kaum vor dem Rattenfraß zu retten, und ihr rettet mir meinen Adel. Denn der Oberhofzuckerbäcker, der am
allermeisten gilt, hat dem König so schon heimlich Zweifel gesetzt über das Wort Hoch, vor dem Grafen, obwohl er noch kein anderes als des Königs Wappen in Zucker gebacken, was seine heraldische
Kunde sehr in Zweifel stellt; aber nun, o König! bin ich vor deinen Augen gerechtfertigt, denn sieh, auf dem Wappen sitzt hoch auf dem Berge eine Ratte in den Wurzeln unseres Stammbaumes." - "Es
ist sehr verwischt", sagte der König. Die Ratten legten einen kleinen Wintermuff von dem Felle gestorbener Lieben, ein Hochzeitspräsent der Königin, vor Gritta hin; dann brachte Margareta ihnen
unter den Altar ein Töpfchen mit Eingemachtem, woran sie sich erfrischen sollten, um die Reise gestärkt wieder zurückzumachen.
Der Graf hielt seine Rede ohne weitere Unterbrechung zu Ende und Gritta war Kronprinzessin von Sumbona. Als die Glückwünsche vorbei waren, zerstreuten sich alle im Kloster, um es zu besichtigen.
Die Klosterfräulein wussten sich auf artige Weise beim König einzuschmeicheln. Margareta führte ihn in ihre Zelle; zwar konnte er seiner ansehnlichen Person wegen kaum durch die Tür, aber sie
schoben alle nach, bis sie ihn drin hatten. Dann langte Margareta aus einem Schränkchen guten, duftenden Honigkuchen, Nonnenseufzerchen und andre berühmte Klostersüßigkeiten. Der König machte es
sich bequem und setzte die goldne Krone unter das Bett, auf dem er in Ermanglung seines breiten Thronstuhls Platz genommen. Margareta band ihm ein weißleinenes Vortüchlein um, dass er sich nicht
beschmutze. Kamilla kraute ihm auf sein Verlangen sanft auf dem Kopf herum; dabei aß er und ließ sich von den Klosterfräulein etwas erzählen. Nur eine Fliege, die von seiner Nase nicht lassen
wollte, gab drei Fliegenwedeln, anmutig im Takt geführt von Elfried, Anna und Lieschen, fortwährend Beschäftigung. - Dies ergötzte den guten König sehr, der für jede Attention eine großmütige
Anerkenntnis hatte, obschon dies nach seiner großmächtigsten Gewalt nicht nötig gewesen sein würde. Als er das Beste gekostet, einen süß gerührten Rosinenmatzen, brach er unaufhaltsam in die
Worte aus: "Meine lieben, kleinen Klosterjungfern, ihr sollt einen großen Orden haben."
Reseda hatte das Prinzchen Bonus hinaufgelockt auf den Turm, um ihm die goldne Glocke zu zeigen, und Veronika unterhielt sich mit dem Grafen über eine Maschine, das Kloster auf Rollen zu setzen
und im ganzen Wald herumzufahren; nur die Bäume waren hinderlich bei ihren Plänen, sonst nichts. Die Gräfin und Peter hörten mit zu. Also dachte niemand an Gritta; diese war in der Kapelle
zurückgeblieben mit dem kleinen Tetel. Er wollte nicht aus der Kapelle, wo es so lieblich duftete, und kroch auf der Erde umher. Es war still und kühl, Gritta lauschte dem Vogelgesang draußen im
Wald und sann über ihr Leben nach, wie es gleich einem reinen, wilden Quell durch die Lebensufer dahin geeilt. Alles schwebte ihr wieder vor: die Kindheitsereignisse so deutlich. - Sie saß in der
Küche, Müfferts graue Augen blickten durch den Rauch liebreich zu ihr nieder. Wie hütete er sein Pflänzchen mit Sorgfalt, wünschte ihm jeden Sonnenstrahl, der die feinen, jungen Blätter zu
lustiger Pracht entfalte. Sie saß auf dem Herd hinter dem rußigen Kochtopf und hatte schöne Zukunftsträume; jetzt war alles da, und Blüten und Früchte fielen über sie, und doch fiel ihr ein, sie
wolle zum Kapellenfenster hinaus in den Wald zu dem wunderbaren Vogelsang, und sie hatte keinen Wunsch mehr, als dass der kleine Tetel sehe, und dachte daran, ob die Ahnfrau ihr Versprechen
halten werde. Die Sonnenstrahlen spielten mit den Blüten ihres Brautkrönchens und zogen einen Streif über ihr rotes Atlasröckchen. - Wie sie so ruhig saß, flog das Fenster oben auf, und
Wildebeere guckte herein. Auf ihrem Kopf trug sie eine große Zwiebel so, dass die Wurzeln gleich einer großen Perücke um sie herabhingen. Sie nickte lächelnd Gritta zu, und kam herabgesaust, als
wär' ein hoher Sprung eine Kleinigkeit. Sie ging auf den kleinen Tetel zu, langte eine wunderseltsame Blume aus ihrem Rock, und strich ihm damit sanft über die Augen. Gritta sah aufmerksam zu. -
"Siehst du, Gritta", sagte Wildebeere nach einer Weile, "dies Mittel hat mir nur noch gefehlt; ich habe lange geforscht, was die rechte Heilung kranker Augen sei, und nun hab' ich's gefunden. Als
ich heute Morgen nach Kräutern suchte, blickte mich von ferne eine blaue Blume an, und trug in ihrem Kelch eine große Tauperle. Ich betrachtete sie nachsinnend, was sie wohl für eine Kraft haben
könne, da stand plötzlich eine schöne, stolze Frau vor mir, und sagte: 'Brich sie, es ist Augenheilung. Heile den kleinen Tetel damit und bringe Gritta meinen Abschiedsgruß, denn ich scheide nun
von der Erde!' -- Aber jetzt muss ich wieder fort in den grünen Wald", fuhr Wildebeere fort. "Die Blume wird wohl bald ihre Wirkung tun. Du kannst mich einmal besuchen; es ist so schön dort in
meiner Höhle, wo die Blätter im Düstern rauschen und selten ein Sonnenstrahl das feuchte Gras küsst. Da hab' ich meine Spiritusgläser, in denen die wunderbaren Kräfte eingesperrt sind, und wo die
Sonne hell scheint. Da sitz' ich auf den Spitzen der beleuchteten Zweige und sammle das Sonnengold, und wo ein Baum rauscht geheimnisvoll, da weiß ich, was er erzählt." Margareta trat in diesem
Augenblick in die Kapelle, um Gritta zu suchen. "Aber! Wildebeere!" rief sie, "so verunstaltest du dich? Achtest du denn nicht dein schönes braunes Haar?" -- Wildebeere warf ihr die
Zwiebelperücke ins Gesicht und war an ihr vorbei zur Tür heraus. Als sie sich aus den verwirrten Wurzeln losgemacht, saß Gritta schon bei dem kleinen Tetel. Er hielt eine Blume gegen das Licht
und lächelte freudig über die bunten Farben; in demselben Augenblick traten der Hochgraf und die Gräfin herein. Gritta trug ihr das sehende Gräflein in die Arme. Der Hochgraf machte einen solchen
Freudenlärm, dass der König, der Prinz, Peter und alle zusammenliefen. Jetzt ging der Hochzeitjubel recht los, Harmoni spielte auf ihrem Orgelinstrument dazu, - bis der König daran erinnerte, man
müsste nach Hause. Die Klosterschwestern nahmen zärtlichen Abschied von Gritta und sie versprach ihnen, manche schöne Sommerzeit bei ihnen zu wohnen. Sie standen noch lange an der Tür, schauten
dem Zug nach und sprachen untereinander: "Was das für ein artiger, lieber König ist!" sagte Margareta, "er hat wirklich den Honigkuchen und alles gegessen und hat so artig dabei gelächelt!" -
"Ja, ja, das zeigt, dass wir einen Orden kriegen sollen!" rief Kamilla, "den wollen wir über die Tür nageln." - Der Zug verschwand hinter den Bäumen; sie machten die Pforte zu und kehrten ein in
ihre Zellen.
Als der Zug das Ende des Waldes erreicht hatte, standen mehrere goldgeschmückte Kutschen davor. Die Bedienten warfen alles in die Wagen und fort ging es, dass die Rösslein nur so wieherten, durch
die fruchtbaren Felder und grünen Wiesen, bis an den Kreuzweg, wo der König nach Sumbona abbiegen musste, denn er hatte schon sehr lange das Regieren verschoben.
Doch was war das? - Schon von Ferne sahen sie dort einen großen Volkshaufen. Es waren alle Gilden der Stadt Sumbona und sonstiges Volk. Sie hatten sich am Kreuzweg aufgestellt, denn sie hatten
etwas gemerkt. Da stand die werte Schneidergilde, die Schuster, die Rademacher, Lackierer, Vergolder, Glaser, Böttcher und so weiter, mit fliegenden Fahnen, aber voran die Bäcker und Fleischer
und die Gänsehirten mit den größten Fahnen. Die kleinen Buben waren auf die kleinen Kirschbäume der Oberhofschattenanlegung gekrochen. Ob aus Attention für den König oder die roten Frühkirschen
1) bleibt zweifelhaft. Ein Mann mit einem Stock, der sie herabwinkte, meinte, sie sähen unten viel besser; sie aber meinten das nicht, es sei ein zu naher Standpunkt. Die Wagen langten an, da
ertönte das gesamte Volksgeschrei und der Gassenjungen Geschrei dazu, "Heil unserm König Anserrex, dass er die bedrängten Gänsbrüste freigegeben!" -- Der König lächelte, denn er hatte heute
Morgen heimlich einen Boten mit dieser erfreulichen Regierungsmaßregel in die Stadt geschickt. -- "Heil dem Prinzen Bonus - und Heil der Prinzess Gritta zu ihrer glücklichen Vermählung! Vivat
hoch!" -
Es ward ein so allgemeiner Jubel erhöhter Volkslust, der erhabnen Vaterlandsgefühle der geliebten Bürger, dass der König sich die Ohren zuhielt und Goldgroschen austeilen ließ, worauf die
allgemeine Volksbrusterregung in stillschweigender Keulerei endete. Der König fuhr links ab, die andern fuhren nach dem Sommerschloß, und das Prinzchen Bonus führte seine Gritta in die stille
Wiege eines glückseligen Lebens, bis sie beide ans Regieren mussten, wenn der König müde war. Der alte Hochgraf hatte genug Stoff zu Maschinen, so dass er bald das ganze Land damit hätte regieren
können, was auch später bei verfeinerter Volkskultur geschehen sein soll.
Der alte Müffert kam nach einem Jahr mit Frau Rönnchen, die er abgeholt hatte, um sie zu heiraten, weil Gritta sich nach ihr sehnte. Sie wurden mit dem größten Jubel empfangen. Schon lange hatte
der Hochgraf Boten nach ihm ausgesendet, von Reue getrieben, da er aus Grittas eignem Mund gehört, dass sie ihm davongelaufen. Die Hochgräfin sah in die klaren Augen des kleinen Tetel und erzog
ihn zu einem besonders liebenswürdigen Grafen, wurde wieder so mutwillig wie früher und machte mit ihm zusammen unartige Streiche gegen den Hochgrafen. Die Klosterfräulein sollen weit den Segen
über das Land verbreitet haben. Ihre Eltern schickten ihnen Nachricht, und einige kamen später selbst und siedelten sich an. Peter, Gritta und Bonus liebten sich alle drei gleich. Peter ward wie
früher in Rattenzuhausbeiuns Turmwart im Schloss und übernahm dazu das Geschäft eines großen Gänseverwalters. - Wildebeere blieb im Wald und wurde Medizinalrat bei besondern Gelegenheiten, und
wo's im Lande wirklich ans Sterben ging, erschien sie zur Hilfe. Deswegen starb auch niemand außer denen, die so krank waren, dass es nicht anders ging.
Hier endet das Lebenbeschreibendemanuskript der Hochgräfin Gritta von Rattenzuhausbeiuns - dem weißen Wickelkinde, dem klugen Kinde und dem Muster aller Bräute, die später ein Muster der
Königinnen ward und ihr Licht nie unter den Scheffel stellte, woran ein jedes Kind ein Exempel nehmen kann.
Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Gott-Vater das Paradies Sumbona wieder an den Himmel geklebt, weil die Menschen unter Grittas Regierung dort so weise geworden sind, dass sie sich sehr dazu
eigneten, ein himmlisches Amt zu übernehmen. - Sonst würde ich einmal raten, auch hinzureisen.
Bettina und Gisela von Arnim
